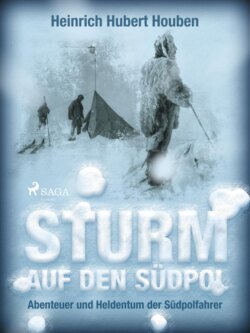Читать книгу Sturm auf den Südpol. Abenteuer und Heldentum der Südpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vor der grossen Eisbarriere
ОглавлениеEin feuerspeiender Vulkan in dieser von Menschenaugen nie gesehenen Eisurwelt ist ein phantastisch grossartiger, überwältigender Anblick, doch für ein beabsichtigtes Winterquartier nicht gerade eine wünschenswerte Nachbarschaft. Daneben wirkt die merkwürdige Eismauer, die vom Fuss des Terror schnurgerade wie ein weisses Lineal bis an den östlichen Horizont läuft, zunächst fast harmlos. In Wirklichkeit ist sie viel gefährlicher. Diese gläserne Festungsmauer speit zwar nicht Feuer, aber an ihrem Fuss steht eine unheimliche Brandung, die mit gewaltigen Eisblöcken Fangball spielt. Das Fahrwasser nach Osten ist zwar auf weite Sicht eisfrei, und bei frischem Westwind da entlangzufahren wäre höchst verlockend. Aber Wind und Strömung wechseln hier nach unbekannten Gesetzen verteufelt schnell! Ein plötzlicher Nordsturm kann unermessliche Scharen Eisschollen und Eisberge zum Angriff heranführen, dann sitzen die Schiffe rettungslos in der Falle; bei Windstille kann eine unberechenbare Strömung sie der saugenden Brandung zutreiben, und selbst bei Südsturm wird der Schutz dieser steilen Wand zum sichern Verderben; sie ist über Wasser 50 bis 70 Meter hoch, überragt also die Masten um das Dreifache und schnitte den Segeln allen rettenden Wind ab; die Schiffe würden ihre Bewegungsfreiheit vollkommen verlieren. Und so unerschütterlich fest diese gigantische Mauer dazustehen scheint, augenblicklich wenigstens ohne Risse und Lücken, ein wunderbares Phänomen, das in der Welt nicht seinesgleichen hat — sie besteht doch schliesslich nur aus einem Material, das, wie jeder Polarfahrer weiss, bei Temperaturwechsel, Sturmflut und ähnlichen Einwirkungen urplötzlichen katastrophalen Veränderungen unterworfen ist, die bei den nie erlebten Dimensionen dieser Eismasse hier alle menschliche Vorstellung übersteigen müssen. Eines ist gewiss: die eigenartigen, gleichmässig hohen Tafeleisberge, die schon auf dem Polarkreis den Schiffen entgegenkamen und sie bis zum Eingang in das Rossmeer stündlich bedrohten, zeigten in Höhe und Aufbau eine unverkennbare Ähnlichkeit und Verwandtschaft mit dieser Eismauer. Und wie von jenen schwimmenden Festungen, die eine geheimnisvolle elementare Kraft Tausende von Kilometern nach Norden entführt, so oft und plötzlich gewaltige Trümmer abbrachen und mit Donnergepolter ins Meer stürzten, so haben sie selbst sich von dieser Eismauer abgelöst, die offenbar ihrer aller Mutter ist. Die Mauer ist also der stets veränderliche Rand einer ungeheuren Eistafel von 300—400 Meter Dicke, die teilweise im Wasser schwimmt, irgendwo gewiss auf festem Grund verankert ist, aber viele Kilometer weit sich nach Süden noch hinziehen muss, wie der klare blaue Eishimmel in dieser Richtung verrät.
Bei günstigem Südwestwind fährt Ross am 29. Januar 1841 nach Osten. 300 Kilometer machen die Schiffe an diesem Tag, aber die Eismauer nimmt kein Ende, sie läuft immer noch nach Ostsüdost bis zum Horizont weiter. Bei eintretender Windstille liegen die Schiffe etwa 20 Kilometer weit von ihr entfernt; das Senkblei findet hier in 750 Meter Grund und bohrt sich einen halben Meter tief in weichen, grünen Schlamm ein; auf einer Felsbank scheint also wenigstens der äussere Rand der Eisbarriere nicht zu ruhen. Nebel, Schnee und widriger Wind zwingen am nächsten Tag, nach Nordosten abzubiegen. Ross will einstweilen diesen nie befahrenen Meeresstrich untersuchen und sich erst wieder bei klarem Wetter an die Eisbarriere heranwagen. Am Abend gerät er in loses Eis und zwischen Eisberge von der schon bekannten Form, Stücke der Barriere also in ihrer unmittelbaren Nähe; aber sie sind ungefährlich, sie liegen unbeweglich, haben sich offenbar festgefahren; das Senkblei bestätigt, dass hier in nur 450 Meter Tiefe eine Schlammbank ist, worin der Unterwasserfuss der Eisberge festsitzt. Am 31. macht auf 168 Grad westlicher Länge schweres Packeis, das die Kupferböden der Schiffe beschädigt, dem weiteren Vordringen nach Nordosten ein Ende. Also zurück auf demselben Wege! Windstillen und Schneenebel halten die Fahrt auf; die Kapitäne müssen sich bei dem völlig unsichtigen Wetter durch Flintenschüsse miteinander verständigen. Am Mittag des 2. Februar klärt es sich wieder auf, ein leichter Nordwind weht — nun mit vollen Segeln nach Süden! Die Schiffe erreichen an diesem Tag 78° 4′ südlicher Breite, können sich aber der Eisbarriere nicht nähern, ein undurchdringlicher Gürtel Packeis hat sich vorgeschoben. Die Lage des Eiswalles berechnet Ross jetzt auf 78° 15′ und seine Höhe auf 50 Meter; er scheint hier, 450 Kilometer von Kap Crozier entfernt, etwas niedriger zu sein, setzt sich aber nach Osten hin ununterbrochen fort. Die Schiffe umfahren das Packeis und dringen nochmals östlich vor; auf 167° 8′, etwas weiter als am 31. Januar, ist das Eis locker und das Meer ruhiger; sie steuern wieder nach Süden, sitzen aber bald im Eise fest und können nur in einer offenen Lache hin und her lavieren, um nicht einzufrieren. Lockerung des Packeises befreit sie am Abend des 6. Am 7. kommen sie langsam vom Packeis los, und obgleich sich schon überall junges Eis bildet, macht Ross noch einmal den Versuch, dicht an die Eisbarriere heranzukommen, obgleich sich das Packeis ihr wieder bedenklich nähert. Er hat in dem Eisrand einen ersten buchtartigen Einschnitt gesichtet, auf den er zuhält, und am Morgen des 9. Februar schwimmen die Schiffe kaum 500 Meter entfernt von einer Eishalbinsel, deren Spitze ein Kap von 55 Meter Höhe bildet; die schmale Zunge, die es mit der Eismauer verbindet, ist einige Meter niedriger, dadurch lässt sich von der Ausgucktonne zum erstenmal die Oberfläche der Barriere, die nach Süden zu ansteigt, überblicken; sie ist ganz glatt, berichtet Ross, und erinnert an eine „unermessliche Ebene von gefrorenem Silber“. Von jedem vorspringenden Punkt der senkrechten Eiswand hängen riesenhafte Eiszapfen herab, ein Beweis, dass es auch hier manchmal taut. Wann mag das sein? Bisher ist die Sommertemperatur noch nicht über — 10° Celsius gestiegen!
Ross hat die Schiffe, sobald sie bis auf 500 Meter heran waren, sofort wenden lassen. Aber schon ist das Packeis so dicht herangetrieben, dass er einige Stunden lang selbst daran verzweifelt, aus dieser Falle, in die ihn sein Forschungseifer gelockt hat, je wieder zu entschlüpfen. Vom Mastkorb aus ist offenes Wasser nirgends mehr zu erblicken. Die Boote herunter! Die Matrosen müssen das Eis vor dem Bug des „Erebus“ aufhacken und so meterweise einen Weg brechen, auf dem der „Terror“ ihm folgen kann. Ein günstiger Wind hilft ihnen; in dem Augenblick, als sie endlich freie Bahn haben, schlägt er um. Hätte er sich eine halbe Stunde früher gewendet, so wären die Schiffe hoffnungslos zwischen Eisbarriere und Packeis eingefroren, und die Expedition hätte hier ein schreckliches Ende genommen. Obgleich sich Ross über diese Gefahr durchaus klar ist, will er durch Umfahren des Packeises noch einmal nach Osten durchbrechen; aber nach mehrtägigem schwerem Kampf mit den immer fester werdenden Eismassen muss er den Versuch aufgeben und kann noch von Glück sagen, dass es ihm gelingt, die beiden Schiffe bei dichtem Schneegestöber und hoher See aus einem furchtbaren Chaos von schwimmenden Eisblöcken und riesigen Eisbergen heil herauszulavieren.
Er fährt wieder nach Westen zurück und muss sich wohl oder übel die weitere Untersuchung des Eiswalles für nächsten Sommer aufsparen. Den Plan, an der Küste zu überwintern und dann frühzeitig eine Zufahrtsstrasse zum magnetischen Südpol zu suchen, hält er immer noch fest. Am Mittag des 16. Februar segeln die Schiffe wieder an den beiden Vulkanen vorüber, der Erebus dampft stossweise wie eine Lokomotive, Flammen und Rauch steigen hoch empor, der Anblick ist noch weit grossartiger als das vorige Mal; Lavamassen am Kraterrand sind aber heute nicht zu sehen. Ross untersucht nun eine Bucht, die sich links hinter dem Fuss des Erebus öffnet; er gibt ihr, nach dem ältesten Leutnant des „Terror“, den Namen McMurdo-Sund. Eine niedrige Landspitze mit kleiner Insel davor an der Westküste scheint sich zum Winterhafen zu eignen; er benennt sie Gauss-Kap, „nach dem grossen deutschen Mathematiker“, der, wie er hervorhebt, „mehr als jeder andere Physiker für die Förderung der Wissenschaft des Erdmagnetismus getan hat“. Aber an die Küste heranzukommen erweist sich auch hier als unmöglich; ein Eiswall von 20 Kilometer Breite liegt davor, und es ist zu spät im Jahr, um noch an ein Aufgehen dieses Landeises glauben zu können. „Nur wenige werden“, gesteht der stolze Engländer, der sonst selten aus sich herausgeht, „den tiefen Schmerz begreifen, mit dem ich mich zuletzt gezwungen sah, die vielleicht zu ehrgeizige und lange gehegte Hoffnung aufzugeben, die Flagge meines Vaterlandes über beiden magnetischen Polen unserer Erde aufzupflanzen.“ Aber er tröstet sich mit dem Bewusstsein, dem Pol um ein halbes Tausend Kilometer näher gekommen zu sein als seine Vorgänger und durch seine vielen sorgfältigen Beobachtungen seine Lage „fast so genau bestimmt zu haben, als ob ich selbst an Ort und Stelle gewesen wäre“.
Noch auf der Rückfahrt macht er einen letzten Versuch, an der Nordküste des Victoria-Landes, die er bis zum Nordkap erforscht, einen Winterhafen zu finden; aber sie ist noch viel unzugänglicher als die Westküste, und festes Eis macht jedes Weiterfahren nach Westen unmöglich. Er wendet sich also geradeaus nach Norden, erreicht die von seinem Landsmann Balleny entdeckten Inseln, von denen er drei erkennt und genau bestimmt, und hat schliesslich noch den Triumph, nordwestlich davon über den Mittelpunkt des Landes hinwegzusegeln, das ein Schiff der amerikanischen Expedition, der „Porpoise“, von Luftspiegelungen, Wolken oder Eisbergen irregeführt, schon auf 64° 51′ s. Br. und 164° 45′ ö. L. gesehen und als einen Teil des antarktischen Kontinents zwei Jahre vorher entdeckt haben will. Der Triumph wird allerdings mit unerhörten Anstrengungen erkauft, mehrere Male sieht selbst Ross den sicheren Untergang der Expedition vor Augen, aber immer wieder gelingt es der Geschicklichkeit der Kapitäne und dem heldenhaften Opfermut der Mannschaft, die übel mitgenommenen, völlig vereisten Schiffe vor dem Verderben zu retten. Und immer noch ist die Aufgabe der Expedition in diesen Breiten nicht beendet. In stetem Kampf mit dem Packeis und unausgesetzten Schneestürmen, von Eisbergen bis über den 60. Breitengrad hinaus verfolgt, macht Ross noch einen gewaltigen Bogen nach Westen, wichtiger magnetischer Beobachtungen wegen, die ihm seine Instruktion vorschreibt. Am 28. März endlich ist die Arbeit getan, und er gibt den Befehl zur Rückkehr nach Tasmania. Am 7. April fahren die Schiffe wieder in den Hafen von Hobart ein, um dort für den zweiten Vorstoss nach Süden gründlich ausgebessert zu werden. Die Mannschaft braucht Ruhe. Ross selbst gönnt sich keine Erholung. Tagaus, tagein ist er im Observatorium beschäftigt, selbst zu Spaziergängen oder kleinen Ausflügen über Land lässt er sich nur bewegen, wenn er magnetische Beobachtungen damit verbinden kann. Am 7. Juli ist er bereits wieder auf Fahrt. Zunächst nach Sydney, von da am 5. August nach der Inselbucht an der Ostküste Neuseelands, wo er ein Observatorium aufstellen lässt und drei Monate lang unermüdlich arbeitet. Am 23. November lichten die beiden Schiffe, wiederum auf drei Jahre verproviantiert und ausgerüstet, die Anker zur zweiten Polarreise.