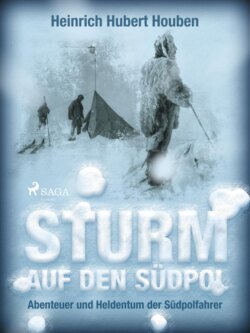Читать книгу Sturm auf den Südpol. Abenteuer und Heldentum der Südpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wo ist der magnetische Südpol?
ОглавлениеIm alten Berlin der dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts ist Alexander von Humboldts „Kupferhäuschen“ stadtbekannt. Es steht im grossen Mendelssohnschen Garten an der Leipziger Strasse, da wo heute noch das „Herrenhaus“ an die sozialen Missverständnisse der wilhelminischen Zeiten erinnert. Der berühmte Gelehrte und Weltreisende hat es sich 1827 bauen lassen, um darin erdmagnetische Beobachtungen zu machen, die zeitlebens zu seinen Lieblingsstudien gehören. Aus reinem rotem Kupfer musste das Häuschen sein, weil jeder Eisennagel den mitten im Raum an einem ungedrehten Faden hängenden Magneten abgelenkt hätte. Alle bedeutenden Physiker und Mathematiker der preussischen Hauptstadt, Encke, der Direktor der Sternwarte, Dove, Dirichlet und andere, beteiligen sich an diesen Untersuchungen. In einem Bergwerksschacht zu Freiberg in Sachsen, 70 Meter unter der Erde, macht Professor Reich, Lehrer an der dortigen berühmten Bergakademie, an der auch Humboldt studiert hat, zu genau verabredeten Zeiten ganz die gleichen Versuche wie die Berliner, und an einer dritten Stelle, in Columbien, nahe dem Äquator, nimmt der französische Chemiker Boussignault, der sich damals in Südamerika aufhält, auf Humboldts Bitte dieselben Beobachtungen vor. Denn ein vereinzeltes Experiment dieser Art bedeutet wenig für die Erkenntnis der rätselhaften Launen der Magnetnadel, die seit Erfindung des Kompasses im 11. Jahrhundert die Seefahrer ebenso wie die Gelehrten beunruhigt und beschäftigt haben. Der grosse Magnet Erde hat sein eigenes kosmisches System, seinen eigenen Äquator und seine eigenen Pole, die sich mit den gleichnamigen astronomischen und geographischen Begriffen keineswegs decken. Die Verteilung der erdmagnetischen Kraft, ihre verschiedenartige Stärke, die Gesetze ihrer Wirkung und die durch sie verursachten Erscheinungen, die Abweichung der Magnetnadel vom geographischen Meridian, Erdströme und magnetische Störungen, Nord- und Südlichter, ihr Zusammenhang mit der Sonne usw., sind noch heute ungelöste Probleme. Ihre Erforschung setzt ein über das ganze Erdenrund gespanntes Netz von Beobachtungsstellen voraus, die möglichst mit denselben überaus komplizierten und empfindlichen Apparaten und unter gleichen örtlichen Einflüssen nach einem einheitlichen Programm Jahrzehnte hindurch arbeiten müssen, also eine vielleicht übermenschliche, entsagungsvolle Tätigkeit und eine kostbare wissenschaftliche Organisation, die auch im 20. Jahrhundert noch immer fern von ihrer Vollendung ist. Alexander von Humboldt war es, der zu ihrem Aufbau die beispiellose Macht seines wissenschaftlichen Ansehens erfolgreich eingesetzt hat.
Auf der Rückreise von seiner Forschungsexpedition durch das asiatische Russland (1827—1829) gelingt es ihm, durch einen mitten im Trubel geräuschvoller Festlichkeiten improvisierten Vortrag in der Petersburger Akademie der Wissenschaften die russische Regierung zu bestimmen, durch das ganze Zarenreich von Nikolajew bis Peking eine grosse Reihe magnetischer Stationen einzurichten. Zwei wichtige Ereignisse kommen diesem Unternehmen zu Hilfe. Der berühmte englische Polarfahrer John Ross entdeckt die Nordspitze Amerikas, und dort, auf dem äussersten Zipfel, auf Boothia-Felix-Land, dringt sein ihn begleitender Neffe James Ross Anfang Juni 1831 bis zu dem Punkte vor, der — wenigstens damals, denn dieser Punkt ist nicht beständig — als das nördliche Zentrum der erdmagnetischen Kraft zu gelten hat. Der magnetische Nordpol — richtiger Südpol, denn gleiche Pole stossen sich bekanntlich ab — liegt zu jener Zeit auf 70° 5′ 17″ nördlicher Breite und 96° 46′ 45″ westlicher Länge, also fast zwanzig Breitengrade vom geographischen Nordpol entfernt. In der ganzen wissenschaftlichen Welt erhebt sich damit die Frage: „Wo ist der magnetische Südpol?“ — Gleichzeitig beginnt der Göttinger Mathematiker Karl Friedrich Gauss seine grundlegenden erdmagnetischen Arbeiten, die in seiner epochemachenden „Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus“ gipfeln, und erfindet in seinem Manometer (1833) ein Instrument, das an Sicherheit und Genauigkeit der Messungen das bisherige Handwerkszeug der Physiker weit überholt und alsbald überall eingeführt wird. Die Berliner Sternwarte erhält ein magnetisches Observatorium nach Gaussschem System; Humboldts Kupferhäuschen ist damit veraltet. 1836 bildet sich in Göttingen ein „Magnetischer Verein“, der die Errichtung solcher Observatorien in zahlreichen Städten Deutschlands durchsetzt; die schon bestehenden russischen Stationen schliessen sich an, ebenso die in Italien, Dänemark, Schweden, Polen und England.
Aber alle diese Anstalten erstrecken sich nur über einen kleinen Teil der bewohnten Erde, und die erdmagnetischen Erscheinungen, die sie ergründen helfen wollen, treten am stärksten und klarsten gerade in den unzugänglichsten Gegenden unseres Globus auf, in den beiden Polarzonen. Die nördliche Halbkugel ist mit Observatorien ziemlich reich versehen, und die überaus rege Nordpolforschung hat auch im äussersten Norden wertvolle Aufklärungsarbeit verrichtet. Auf der südlichen Halbkugel aber ist überhaupt noch nichts geschehen und das Zentrum der dortigen erdmagnetischen Kräfte, das gesamte Gebiet der Antarktis, noch so gut wie unbekannt. Hier kann nur Grossbritannien mit seinen die Welt umspannenden Kolonien helfen. Da ist es wiederum Humboldt, der im April 1836 durch einen glänzenden diplomatischen Brief an den Herzog von Sussex, den Präsidenten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu London, den Ehrgeiz auch Englands zu wecken versteht, das, wie Humboldt schreibt, „im Besitze des grössten Welthandels und der ausgedehntesten Schiffahrt, bisher keinen Teil an jener grossen wissenschaftlichen Bewegung seit 1828 genommen“ habe. Der Erfolg seines Briefes überrascht selbst ihn: schon im Juli erhält er die Nachricht, dass sich die Königliche Gesellschaft für Errichtung magnetischer Observatorien in Kanada, Ceylon, St. Helena, Tasmania, Mauritius oder auf dem Kap der Guten Hoffnung und sogar für die Entsendung einer Expedition zur Erforschung der magnetischen Phänomene in den hohen südlichen Breiten zwischen den Meridianen von Australien und Kap Hoorn (Südamerika) einsetzen werde.
Damit ist ein Stichwort gefallen, das plötzlich drei Nationen wetteifernd in Bewegung setzt: Entdeckungsfahrt in hohe südliche Breiten, Erforschung des Südpolgebietes innerhalb des südlichen Polarkreises, den bisher nur Cook, Bellingshausen, Weddell und zuletzt Biscoe überschritten haben. Was verbirgt sich dahinter? Von drei Seiten zugleich soll jetzt versucht werden, diese Frage zu beantworten.