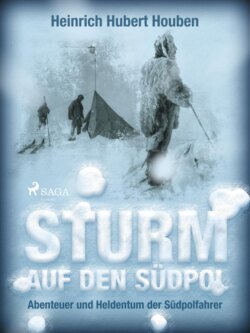Читать книгу Sturm auf den Südpol. Abenteuer und Heldentum der Südpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das südlichste Land der Welt
ОглавлениеVon Hobart segelt Ross am 12. November 1840 nach den Auckland-Inseln südlich von Neuseeland. In einem Hafen der Enderby-Insel gehen die Schiffe am 17. vor Anker. Die Errichtung eines Observatoriums und die dadurch ermöglichten magnetischen Beobachtungen halten die Expedition bis zum 12. Dezember hier fest. Noch ein kurzer Aufenthalt bei den Campbell-Inseln — und dann beginnt am 17. die eigentliche Südpolarfahrt. Kapitän Crozier erfährt erst am Abend vorher, wohin die Reise geht, und freut sich des unverhofften Abenteuers, die Offiziere sind begeistert, und auf die Mannschaft kann sich der Kommandant verlassen, das haben die fünfzehn Monate, die man jetzt beisammen ist, längst gezeigt. Die Lebensmittel reichen für drei Jahre, die Schiffe können einen Stoss vertragen, am 21. Dezember beginnt der antarktische Sommer — also auf nach Süden, und nur dahin, wo die Welt bisher noch völlig unbekannt ist!
Vom Sommer merkt man hier zwar wenig, das Quecksilber des Thermometers steigt nur selten mehr über den Gefrierpunkt; Stürme und Windstillen wechseln miteinander ab; auch bei Schnee und Regen legen die Schiffe bei, damit sie nicht bei unsichtigem Wetter auf Eis stossen oder an unbekannten Küsten, ohne sie zu sehen, vorüberfahren. Am Abend des 27. Dezember treibt ein erster Eisberg heran; eine halbe Stunde später zählt man ihrer schon fünfzehn. Mit ihren oft phantastisch geformten Brüdern in der Arktis haben die hier unten wenig Ähnlichkeit, sie sind bedeutend grösser und wie von einem Stück geschnitten, Tafeleisberge von 40 bis 60 Meter Höhe über Wasser, also mindestens 200 bis 300 Meter Tiefgang, und es ist ratsam, ihnen aus dem Wege zu gehen, denn von ihren fast senkrecht abstürzenden Seiten lösen sich beständig gewaltige Stücke ab, zwischen denen sich eine Unzahl Walfische tummeln, die so wenig scheu sind, dass sie die Schiffe dicht an sich herankommen lassen. Und zwischen den Eisbergen geht die See sehr hoch; das tosende Branden der Wellen gegen ihre steilen Ufer ist in den Nachtstunden, die jetzt glücklicherweise immer kürzer werden, ein zuverlässiges Warnungssignal. Am Mittag des 31. ist das Wetter prächtig klar, und am südlichen Himmel zeigt sich ein heller Schein: der Eisblink, der Reflex der Sonnenstrahlen von grossen Eisfeldern. Schon am Abend wird der Saum des Packeises gesichtet, und als die Schiffe am 1. Januar 1841, 10 Uhr vormittags, den Polarkreis überschreiten, schiebt sich ihnen bereits das Packeis drohend in den Weg. So früh, auf 66½° südlicher Breite, hat Ross dieses Hindernis nicht erwartet. Ist es wirklich so fürchterlich, wie alle Seefahrer in diesen Breiten, noch jüngst die französische und die amerikanische Expedition in ihren Vorberichten, es schildern? Der vordere Saum zwar gleicht einer undurchdringlichen Festungsmauer aus schwersten, dicht zusammengedrängten Eisstücken. Dahinter aber, so weit das Auge reicht, zeigen sich auch grosse Wasserlöcher und Kanäle, durch die sich ein starkes Schiff bei ruhiger See wohl hindurchzwängen würde. Einstweilen allerdings machen Nebel, Sinken des Barometers, schwere See und Windstille einen Durchbruchsversuch unmöglich. Am 2. Januar liegen die Schiffe in der Nähe eines Eisberges, der wie eine schwimmende Insel aussieht: er ist ganz mit Schlamm und Steinen bedeckt und von einem gewaltigen Felsblock gekrönt, den er irgendwo von einem festen Lande entführt haben muss. Mr. Smith, der Geologe der Expedition, wagt sich in einem Boot hinüber; die Gesteinproben, die er mitbringt, zeigen, dass der Fels vulkanischen Ursprungs ist. Von welcher unbekannten Küste mag dieser Bote der Antarktis kommen? Ein Willkommgruss oder eine Warnung?
Am Abend des 4. Januar gibt Ross das Signal zum Sturm auf das Packeis. Das Barometer steht hoch, und ein scharfer Nordwest füllt die Segel — bei diesem Wind gibt es kein Zurück mehr, nur ein Vorwärts. Der „Erebus“ fährt voran, der „Terror“ folgt in seiner Spur. Eine brüchige Stelle im Eissaum ist bald gefunden, das Flaggschiff hält dicht vor dem Winde darauf zu. Der erste Anprall ist heftig: die Eisblöcke poltern gegen den Bug, bäumen sich knirschend und krachend empor, aber sie sind keine festgefügte Mauer, sie taumeln auf dem Wasser und geben dem Druck nach. Die Schiffe gewinnen Raum, und nach einer Stunde aufregenden Handgemenges zwischen Schiffsbug und Eisschollen schwimmen sie in einer offenen Lache, auf die Ross zielbewusst zugehalten hat — dem unablässig anstürmenden Heer der Eismassen gelingt es nicht einmal, den Vorstoss der Angreifer aus seiner gewollten Richtung zu bringen! Von da führen Kanäle zu weitern offenen Stellen, und wo das Packeis den Weg dahin verlegt, wird es von diesen beiden kleinen Holztanks, denen der Nordwind die Wucht eines Eisbrechers der Zukunft verleiht, rücksichtslos überrannt. Strahlende Sonne beleuchtet ihren Siegesweg, und auf Deck herrscht ausgelassene Begeisterung. Welch ein Triumph vor der Welt, mit diesen beiden Nussschalen, an denen nur der Name furchterregend ist, hier spazierenzufahren! Dabei diese märchenhaft neue Umgebung: das sprühende Farbenspiel der Sonne über den Eisbrüchen, der pfeilschnelle Flug der weissen Sturmvögel, das Tummeln der Robben zwischen den Schollen und die drollige Aufregung der Pinguinherden, die auf den Ruf der Matrosen antworten, den Schiffen über das Eis hastig nachklettern, wie kleine Kinder quäken, wenn sie nicht mitkommen, aber sobald sie ein Stück offenen Wassers finden, wie auf Kommando untertauchen und in einer Minute dicht neben Bug oder Steuer wieder hervorkrabbeln. Hier und da stösst ein Walfisch seine hohe Fontäne in die Luft; wie ein schwarzer länglicher Basaltfelsen wälzt sich sein Rücken zwischen den Schollen empor. Und ist das dort im Süden nicht schon festes Land? Spitze, ganz mit Schnee bedeckte Berge stehen am südlichen Horizont, unbeweglich, stundenlang! Die Neulinge in der Arktis — ihrer sind auf Deck die grosse Mehrzahl — wollen nicht glauben, dass es eine Luftspiegelung ist, bis sie über die Stelle hinwegsegeln, wo ihre Nebelberge dem Meere entsteigen sollen. „Hätten wir unsern Weg nicht fortsetzen können“, sagt Ross mit ironischer Anspielung auf die vielen in der Antarktis schon entdeckten Küstenstriche, die sich später in Luft und Wasser auflösten, „sie hätten bei unserer Rückkehr nach England zweifellos behauptet, hier Land gesehen zu haben.“
Am Morgen des 6. Januar aber ist es mit der Spazierfahrt plötzlich vorbei — der offenen Stellen werden immer weniger, und im Lauf des Tages ballt sich das Eis so dicht und fest zusammen, dass jeder Ausweg nach Süden abgeschnitten ist. Ross lässt die Segel einziehen; abends kommt Kapitän Crozier an Deck des Flaggschiffs. Die Stimmung der Mannschaft ist nach wie vor glänzend; kein Mann steht auf der Krankenliste, einer ist über Bord gefallen und, obgleich er gar nicht schwimmen konnte, so lange über Wasser geblieben, bis ein Boot ihn erreichte und rettete. Der Himmel im Südosten ist dunkel, ein sogenannter Wasserhimmel, dort muss offenes Meer sein. Am Mittag des 7. Januar liegen die Schiffe auf 68° 17′ südlicher Breite und 175° 21′ östlicher Länge; eine Strömung hat sie in den letzten zwei Tagen 40 Kilometer nach Südosten getrieben, ein neuer Beweis, dass dort offenes Meer sein muss. Abends löst sich das Eis ein wenig, und man kommt ein Stück weiter; dann fällt Nebel ein. Am Morgen des 8. wieder ein paar Kilometer vorwärts, dann völlige Windstille. Ross benutzt die Pausen, um auf dem Eis magnetische Beobachtungen zu machen; die Leute gehen auf Robbenjagd und fangen Pinguine von einer ganz neuen, grösseren Art, wie sie auf Kerguelenland oder den Auckland-Inseln nicht vorkommen.
Die Windstille ist ein Glück, das Eis lockert sich von selbst. Nebel und Schnee hindern zwar die Sicht, aber sobald wieder eine nördliche Brise einsetzt, stossen die Schiffe mit vollen Segeln gegen Südosten vor, auf den Wasserhimmel zu; die Schollen poltern und prasseln gegen den Bug, können ihm aber nichts anhaben; der immer stärker werdende Nordwind treibt die Segel unaufhaltsam vor sich her, und früh am Morgen des 9. Januar ist das Packeis durchbrochen, treiben „Erebus“ und „Terror“ im offenen Meer! Aus dem Wind ist ein Sturm geworden, dessen Ende sie mit dichtgerefftem Marssegel abwarten müssen. Schneetreiben und dicker Nebel hüllt sie völlig ein. Als sich andern Morgens der Sturm legt und der Nebel sich verzieht, herrscht auf Deck lauter Jubel: ringsum bis an den Horizont ist kein Stück Eis mehr zu sehen! Der 70. Breitengrad ist schon erreicht — noch nie ist auf dem Meridian von Neuseeland ein Schiff so weit nach Süden vorgedrungen.
Ross steuert nun genau auf den magnetischen Südpol zu; er selbst ist aufs höchste gespannt, ob er dieses eigentliche Ziel seiner Fahrt erreichen, die ihm von der englischen Admiralität gestellte Aufgabe lösen wird. Aber diese Hoffnung erfüllt sich nicht — dafür wartet seiner eine gewiss nicht geringwertigere Überraschung. Ein starker „Landschimmer“ zeigt sich über dem Horizont, und gegen 2 Uhr nachts meldet der wachhabende Offizier, Leutnant Wood: „Land in deutlicher Sicht!“ In Südwest steht eine Kette gewaltiger Berggipfel, ganz von ewigem Schnee bedeckt; ihrer höchsten Spitze gibt Ross sogleich den Namen seines Jugendfreundes Oberstleutnant Sabine, des grossen englischen Mathematikers und Physikers, der sich um das Studium des Erdmagnetismus, um das Zustandekommen der Rossschen Expedition und die Einrichtung der von Humboldt angeregten magnetischen Observatorien in den englischen Kolonien entscheidende Verdienste erworben hat.
Immer breiter dehnt sich das Bergland nach allen Seiten aus, und der Mount Sabine, der anfangs so nah erschien, blickt unerreichbar fern über eisgepanzerten Vorbergen hernieder, von deren Gipfel ungeheure Gletscher, die Täler fast bis zum Rande füllend, herabkommen, kilometerlange Gletscherzungen ins Meer vorstossen oder in hohen, senkrechten Eisklippen über die Küste abstürzen. Der Landkern, der diese Rieseneisberge trägt, reckt nur an ganz wenigen Stellen einen Felszacken über die weisse Decke empor; das nördlichste Kap allein ist ganz schneefrei, und seine schwarze Silhouette ist eine höchst charakteristische Landmarke; es erhält den Namen Kap Adare. Grundproben, die das Tieflot vom Meeresboden heraufbringt, lassen vermuten, dass dieses Kap und vielleicht das ganze neuentdeckte Land vulkanischen Ursprungs ist. Von den Bergketten, die sich beim Näherkommen durch das Fernglas unterscheiden lassen, nennt Ross die nach Nordwest sich erstreckende das Admiralitätsgebirge und ihre einzelnen Spitzen nach den Mitgliedern dieses Kollegiums, das ihn auf die Entdeckungsreise ausgesandt hat.
Über diese vergletscherte Bergwelt hinweg den magnetischen Südpol erreichen zu wollen ist ein unmögliches Beginnen; er liegt, wie Ross berechnet, etwa 800—900 Kilometer südwestlich, auf 76° südlicher Breite und 145° 20′ östlicher Länge. Die Schiffe könnten versuchen, um Kap Adare herum der Küste zu folgen und weiter westlich einen andern Seeweg nach Süden zu finden; aber dieses gewaltige Bergland erstreckt sich gewiss noch viele Meilen nach Westen, und dann gerät die englische Expedition in das Arbeitsgebiet ihrer französischen und amerikanischen Nebenbuhler, die England den Ruhm bestreiten wollen, das südlichste Land der Erde entdeckt zu haben. Diesen Ruhm wird Ross jetzt seinem Vaterland aufs neue sichern, denn das von ihm befahrene offene Meer, das den Namen seines Entdeckers erhält, reicht bedeutend weiter nach Süden, als d’Urville und Wilkes auf ihrem Wege haben kommen können. Und wenn auch vom Rossmeer aus diese Gebirgszüge eine unübersteigbare Schranke bilden — warum soll sich nicht weiter im Süden eine Meerenge oder tiefeinschneidende Bucht finden, die leichter an den magnetischen Südpol heranführt?
Die Küste des neuentdeckten Festlandes auch nur zu betreten, erweist sich aber als unmöglich; so ungeheuer ist die Brandung um ihren völlig strandlosen Eisfuss. Das Boot, in dem sich die beiden Kapitäne mit einigen Offizieren in ihre Nähe wagen, wird von einer unwiderstehlichen Strömung nach Süden fortgerissen, und es gelingt mit knapper Not, auf einer der Steilküste vorgelagerten Insel zu landen, die mit Pinguinherden derart besetzt ist, dass man sich kaum durchdrängen kann, denn die Tiere gehen unter lautem Geschrei mit ihren scharfen Schnäbeln den Besuchern zu Leibe. Auf diesem mit einer hohen Schicht unerträglich stinkenden Guanos bedeckten Gestade wird nun in aller Eile die Zeremonie der Besitzergreifung vorgenommen, daher die Insel Possessionsinsel benannt, dem neuentdeckten Festland aber der Name der jungen Königin Victoria gegeben. Dann springen die Eroberer sofort wieder ins Boot, denn der „Erebus“ hat die Rückkehrflagge gehisst, der Himmel sich düster bewölkt. Die Matrosen rudern, was die Arme hergeben, gegen den Wind und legen fast in dem Augenblick glücklich bei den Schiffen an, als mit dem zunehmenden Nordsturm ein dichter Nebel niederfällt, der wenige Minuten früher Ross und seine Gefährten gezwungen hätte, nach der Insel zurückzukehren, unter Pinguinen auf Guanohaufen ihr Lager aufzuschlagen und in ziemlich verzweifelter Lage auf Rettung zu warten, denn der Sturm, vor dem jetzt beide Schiffe auf die hohe See flüchten, macht ihnen noch über eine Woche lang zu schaffen.