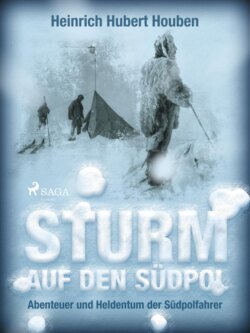Читать книгу Sturm auf den Südpol. Abenteuer und Heldentum der Südpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Skorbut an Bord!
ОглавлениеNoch ist die Aufgabe der französischen Expedition nicht erfüllt; der vierte Weg weiter im Osten, auf dem Weddell bis zum 74. Grad hinuntergefahren ist, bleibt noch zu untersuchen. Die tollkühne Begeisterung der Mannschaft ist sehr abgeflaut. Die „Zelée“ hat einen Kranken, der „Astrolabe“ aber zehn, darunter die drei Ärzte! Die Leute stecken die Köpfe zusammen; die Ärzte hüllen sich in Schweigen. In respektvoller Entfernung von der Eismauer, die kein Ende zu nehmen scheint, segeln die Schiffe weiter gen Osten. Ungeheure Schneemassen rieseln nieder, alle Stunden müssen sie ins Meer geschaufelt werden, und die Leute frieren entsetzlich. Ein Glück noch, dass diese barbarische Kälte nicht zwei Tage früher ausbrach, dann hätte es kein Entkommen aus dem Eis gegeben! Am 14. Februar endlich ist der 33. Längengrad erreicht. Auch hier ist weder nach Süden noch nach Osten durchzukommen, denn die Eismauer bildet abermals eine gewaltige Bucht und läuft dann nach Norden, so weit das Auge reicht. Und hier will Weddell offenes Meer gefunden haben? Unmöglich! So viel steht jedenfalls fest, dass im Polarsommer 1837/38 dieser Meeresteil nach Süden hin durch unermessliche Eismassen völlig gesperrt ist. Das war zu beweisen, und mehr ist nicht zu tun.
Kapitän Jacquinot kommt an Bord des „Astrolabe“. Er ist ganz der Meinung des Führers: jeder weitere Versuch ist Unsinn, und von der Besatzung ist keiner lüstern auf einen neuen Kampf mit dem Packeis. Aus den versprochenen Belohnungen wird nun zwar nichts werden, die Leute witzeln schon darüber. Die meisten von ihnen, selbst einige Offiziere, sind merkwürdig matt; der Kranke auf der „Zelée“ wird wohl sterben. Salz- und Büchsenfleisch widert sie alle längst an, schon seines abscheulichen Geruchs wegen. Robben fanden sich bisher nur in den gefährlichsten Tagen mitten im Eis; den Wert ihres Fleisches für die Gesundheit der Mannschaft scheinen weder die Ärzte noch der Führer zu kennen.
Zurück also nach Nordwesten! Auch diese Fahrt wird ein schwerer Kampf mit Gegenwind, Schneestürmen, Hagel und Nebel. Nicht einmal im Süden der Orkney-Inseln ist durchzukommen, so vereist ist das Meer. D’Urville fährt zum zweitenmal an ihrer Nordküste entlang und widmet ihrer Untersuchung zwei Tage. Dann steuert er südwestlich zu den Süd-Shetland-Inseln hinüber, um von da seinem Auftrag gemäss noch einmal nach Süden vorzustossen und durch die Bransfieldstrasse, wenn möglich, Biscoes Grahamland zu erreichen. Am 27. Februar sieht er auf 62° 57′ s. Br. im Süden links und rechts grosse Landmassen, die der Nebel noch verschleiert, und je weiter er kommt, um so deutlicher tritt zur Linken eine zusammenhängende, einförmige, niedrige, mit Schnee bedeckte Küste hervor, der zahlreiche kleine Inseln mit schwarzen Felsmassen vorgelagert sind; unter der gemeinsamen Eiskruste sind die Grenzen nicht genau zu unterscheiden. Weiter südlich steigen drei hohe Berge auf; der erste dürfte der Gipfel sein, den Bransfield 1820 schon gesehen hat, d’Urville legt ihm daher den Namen dieses englischen Seemanns bei; die beiden andern nennt er Jacquinot- und D’Urville-Berg. Zwischen den Gipfeln kommen ungeheure Gletscher herunter, und noch weiter im Südosten steigt über dem Horizont ein hohes Bergland empor. Auf älteren Karten sind hier schon Küsten angedeutet; ausser Bransfield scheinen etliche Wal- und Robbenfänger sie gesichtet zu haben, aber ihre erste genaue Untersuchung und Bestimmung durch die französische Expedition ist ein Verdienst, das einer Entdeckung gleichkommt. Messungen ergeben, dass der erste Eindruck täuschte und keiner der drei Gipfel höher als 900 Meter ist. Der bergigen Küste gibt d’Urville den Namen Louis-Philippe-Land, die flache nennt er Joinsville-Land zu Ehren des dritten Sohnes König Ludwig Philipps, des Prinzen von Joinville, der seit 1834 in der französischen Marine dient. Die beiden Länder sind durch eine völlig vereiste Meeresstrasse voneinander getrennt.
Zugänglich ist die Küste nirgends, auch früher hat sie noch niemand betreten. Die Gletscher fallen nach dem Meere zu in senkrechten Eiswänden ab, nur von wenigen steilen, schwarzen und schneefreien Vorgebirgen unterbrochen; der Sommer geht zu Ende, erst jetzt setzt hier das Tauwetter mit Macht ein; überall fliessen Wasserbäche hernieder, und der Eisfuss der Küste kalbt; das Knallen der abbrechenden Eisberge und das dumpfe Getöse der Eislawinen klingt ununterbrochen wie der Donner eines Artilleriefeuers herüber. Sich dieser Gefahrzone zu nähern wäre unverantwortlicher Leichtsinn.
Das Land zur Rechten ist hoch und schneebedeckt; es ist das zuerst von Palmer, dann von Bransfield gesichtete Trinity-Land, aber d’Urville stellt fest, dass es eine Insel ist, die ein Kanal vom Festland links trennt; er tauft diese Meerenge Orléans-Kanal; leider ist sie noch so mit Eis verstopft, dass sich nicht untersuchen lässt, ob sie, wie d’Urville richtig vermutet, in die Hughes-Bai einmündet.
Damit beschliesst d’Urville die ihm aufgetragene Polarreise. Er hat mit der Untersuchung des Weddellmeeres so viel Zeit verloren, dass er es nicht mehr wagen darf, tiefer im Süden die Fortsetzung von Louis-Philippe-Land, Biscoes Grahamland, aufzusuchen. Er ist zwar nirgends über den 64. Breitengrad hinausgekommen, hat also keinerlei Rekordzahl erreicht, darf aber doch mit dem Ergebnis dieser letzten Tage zufrieden sein. Seinem Ehrgeiz zwar genügen diese geographischen Feststellungen nicht, und er ist fest entschlossen, später noch einen zweiten Abstecher in die Antarktis zu machen, obgleich er dazu keinen Auftrag hat; den magnetischen Südpol will er aufzufinden suchen, der im australischen Viertel der Südpolaris liegen muss, und auch dort die Grenze des Eisfeldes bestimmen. Aber einstweilen darf niemand etwas von diesen Plänen wissen, sonst ist zu befürchten, dass im nächsten Hafen Südamerikas ein Teil der Matrosen desertiert und die ganze Weltreise unmöglich wird. Der Zustand der Leute macht ihm schwere Sorgen; keiner nennt den Namen der Krankheit, die umgeht, aber es ist kein Zweifel mehr: der Skorbut ist an Bord, die furchtbare Seuche, die schon so manches Schiff entvölkert hat und bisher aller ärztlichen Kunst spottet. Es gibt also jetzt nur die eine Losung: so schnell wie irgend möglich zurück nach Norden, damit die Kranken im chilenischen Hafen Talcahuano bei La Conceptiόn in tropischem Klima wieder gesunden.
Am 16. März erst, als die Expedition sich schon Kap Hoorn nähert, immerfort gegen hartnäckige Westwinde ankämpfend, macht der Arzt dem Kommandanten die erste amtliche Mitteilung: drei Fälle Skorbut, Diagnose leider unzweifelhaft! D’Urville befiehlt ihm, den Namen der Krankheit unter keinen Umständen zu nennen, und zur Stärkung für Kranke und Gesunde wird der Mannschaft täglich eine Extraration Punsch verordnet. Um der „Zelée“, die seit einigen Tagen auffallend weit zurückbleibt, diesen Befehl zu übermitteln, lässt d’Urville den Seetelegraphen auf der Kommandobrücke aufstellen. Die „Zelée“ antwortet alsbald, dass sie verstanden habe, spricht aber weiter und meldet: „29 Kranke an Bord, 14 davon bettlägerig!“ — Böses ahnend, fragt der Kommandant weiter: „Welche Krankheit?“ — „Skorbut!“ lautet die Antwort.
Die Nachricht schmettert d’Urville völlig nieder. Er sieht das Ende der ganzen Expedition vor sich; ehe die Schiffe den Hafen erreichen, kann die Krankheit so um sich gegriffen haben, dass nichts übrigbleibt, als mindestens das Begleitschiff nach Frankreich zurückzuschicken. Und wieviel Mann auf dem „Astrolabe“ werden dann noch gesund sein? Was sich in den südamerikanischen Häfen als Ersatzmatrose anbietet, ist meist der Auswurf der Menschheit: Verbrecher und Deserteure — damit kann er keine Fahrt in die Südsee unternehmen. Könnte er nur mit vollen Segeln vorausfahren, um wenigstens seine Mannschaft schneller in Sicherheit zu bringen! Einstweilen geht auf dem „Astrolabe“ der Dienst noch seinen regelrechten Gang; aber Jacquinot hat offenbar nicht mehr Leute genug, die Segel zu bedienen; ihn sich selbst zu überlassen, ist unmöglich und nicht zu verantworten; er braucht vielleicht Hilfe. Die Fahrt dauert also für beide Schiffe um so länger; sie ist für die Kranken an sich schon eine Qual, Regen und Sturm werden die Zahl der Patienten erhöhen, die stete Feuchtigkeit auf Deck und im Schiff ist kaum noch erträglich. Wenn bei der ganzen Expedition nichts weiter herauskommt als die unselige und missglückte Polarfahrt, so wird er daheim wenig Ehre damit einlegen, noch weniger vor der Welt, die sich nicht an Instruktionen kehrt, sondern nur wissen will, was denn Grosses bei dem ganzen Unternehmen geleistet wurde. Die Engländer gar werden hämisch lächeln und ihm und der französischen Marine den Rat geben, hübsch daheim zu bleiben und die Finger von Dingen zu lassen, denen sie nicht gewachsen seien. Er wird sich in einem internationalen Hafen kaum mehr sehen lassen können!
Am 20. März telegraphiert er wieder an die „Zelée“: „Wieviel Kranke?“ — „31!“ meldet Jacquinot. Auf dem „Astrolabe“ beträgt die Zahl der Patienten erst 7, am 24. März aber sind es schon 11, sechs Tage später 20, zwei davon bettlägerig; mehrere Offiziere sind bereits skorbutverdächtig, und d’Urville beobachtet an sich selbst die Vorzeichen der Krankheit. Er wagt schon nicht mehr zu fragen, wie es auf dem Begleitschiff steht, er kann ja doch nicht helfen. Dabei haben sich Regen und Wind geradezu verschworen, die Fahrt in den rettenden Hafen zu verzögern.
Als die Schiffe endlich am Abend des 6. April 1838 in Talcahuano landen, werden von der „Zelée“ 40 Kranke in ein sofort errichtetes Hospital geschafft; einer ist gestorben, sechs andere hätten eine längere Dauer der Reise nicht überlebt. Die Mannschaft des „Astrolabe“ ist weniger mitgenommen.
Das erste Schiff, das sich um die Ankunft der Franzosen bekümmert, ist eine englische Fregatte. D’Urville kann sich dem Verkehr mit den englischen Kollegen nicht entziehen; sie überlassen ihm sogar mit grösster Hilfsbereitschaft 150 Kupferplatten, die er zur Instandsetzung seiner Schiffe braucht und sich nirgends anders beschaffen kann, und nehmen nach Valparaiso seine Post mit, seine ersten Berichte über die bisherigen Ergebnisse der Reise. Denn es dauert vier Wochen, bis seine Mannschaft sich wieder erholt hat und er ebenfalls dahin aufbrechen kann.
Die Nachricht von seiner Ankunft ist ihm vorausgeeilt und hat auf dort weilenden französischen Schiffen grosse Bestürzung verursacht. Die Offiziere empfinden das Unternehmen schon als eine Blamage Frankreichs, und ihr hitziger Patriotismus macht sie ungerecht gegen den eigenen Landsmann; einer von ihnen schreibt einem Freunde auf dem „Astrolabe“, dem Kommandanten der verunglückten Expedition bleibe nichts übrig, als sich eine Kugel vor den Kopf zu schiessen! Als d’Urville schliesslich selbst mit seiner wieder seetüchtigen Mannschaft und tadellosen Schiffen in Valparaiso erscheint, ist es seine peinlichste Aufgabe, die übertriebenen und erlogenen Gerüchte über den kläglichen Zusammenbruch der ganzen Expedition zu widerlegen und besonders die misstrauischen Landsleute eines Bessern zu belehren. — Sehr erpicht ist er darauf, zu erfahren, was unterdes aus der amerikanischen Expedition geworden ist; aber davon hat niemand etwas gehört; anscheinend ist sie noch gar nicht abgereist.