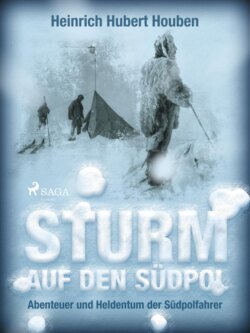Читать книгу Sturm auf den Südpol. Abenteuer und Heldentum der Südpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cooks Weltreise um die Antarktis
ОглавлениеWas wird Cook im Süden finden? Bewohnbare, vielleicht gar bewohnte Länder mit freundlichem Klima, meinen immer noch etliche Schreibtischgeographen; seit ungefähr einem Jahrhundert aber wissen manche Seefahrer besser, was dort unten zu erwarten ist, obgleich noch kein Schiff über 62¾ Grad hinauskam: Eis und Schnee und Sturm, schlimmer als im Norden, Treibeis, Packeis und Eisberge, an deren fabelhafte Grösse und Höhe zunächst niemand glauben will; die Abenteurer, die dorthin verschlagen werden, meist Freibeuter und Gentleman-Seeräuber, wie die allgemeine Jagd auf Kolonialbesitz sie ausbildet, diese Schwadroneure und Landsknechtnaturen lügen meist wie gedruckt. Kapitän Lozier Bouvet aber, der am 1. Januar 1739 auf 54° s. B. (südlicher Breite) und 4° 20′ ö. L. (östlicher Länge von Greenwich aus) das hohe Kap findet, das Cooks erstes Ziel sein soll, ist ein durchaus ernst zu nehmender Seemann; er begegnet schon auf dem 49. Breitengrad Eisbergen von 11 bis 17 Kilometer Umfang und 300 Meter Höhe, eine zweifellos fehlerhafte Schätzung aus optisch täuschender Entfernung, denn noch geht man diesen Gesellen weitmöglichst aus dem Wege; das von ihm entdeckte angebliche Vorgebirge des Südlandes ist ebenfalls von Eis so verbarrikadiert, dass alle Landungsversuche, zwölf Tage lang fortgesetzt, scheitern. Derselbe Bouvet segelt auf dem 57. Breitengrad 2400 Kilometer nach Osten, und wie er versichert: immer von Eismassen umgeben — der erste Versuch einer Eisfahrt in südlichen Breiten, noch dazu in einem offenbar ungewöhnlich schweren Eisjahr.
Der Winter 1772/73 (Sommerszeit in der Antarktis!) ist der Schiffahrt ebenso ungünstig. Drei Jahre vorher hat Cook unterhalb Kap Hoorn bis zum 60. Grad Prachtwetter getroffen, jetzt überraschen ihn südlich vom Kap der Guten Hoffnung schon auf dem 42. Grad Stürme, die seine „Resolution“ am 29. November in grösste Gefahr bringen. Ein Unteroffizier erwacht mitten in der Nacht von einem plätschernden Geräusch, springt auf und steht bis über die Waden im Wasser. Er schlägt sofort Lärm, in wenig Minuten ist die ganze Besatzung auf den Beinen, alles stürzt an die Pumpen und arbeitet verzweifelt; aber das Wasser steigt immerfort, Rettung unmöglich —die Boote werden schon klar gemacht. Da ergibt sich, dass in einer Vorratskammer eine Luke nicht fest geschlossen war, die Wellen haben sie aufgeschlagen und dringen hier so gewaltig ein, dass das Schiff unfehlbar in kurzem gesunken wäre. Nun ist dem Unglück schnell vorgebeugt, aber Kleider, Betten und Gepäck der Mannschaft wie der Offiziere sind vom Seewasser völlig durchnässt, die Schiffsräume noch lange ein sehr übler und ungesunder Aufenthalt, zumal da der Sturm, von Schneefällen und Regen begleitet, gar kein Ende nehmen will. Am 8. Dezember zeigen sich als Vorboten des Treibeises die ersten Pinguine, diese der Antarktis eigenen amphibienartigen Vögel, die ihre verstümmelten Flügel, zum Fliegen untauglich, als Ruder verwenden und durch ihre Schwimm- und Tauchkunst höchstes Erstaunen erwecken; von ihrem starken, schwarzweissen, fettigglatten Federkleid prallen Schrotkörner wirkungslos ab; die Naturforscher müssen schon eine Kugel daranwendm, wenn sie dieser Beute habhaft werden wollen. Am 10. Dezember kommt auf 50° 4′ s. B. schon der erste Eisberg angeschwommen, etwa 650 Meter lang und 70 Meter hoch, nur ein schmales Modell der tafelförmigen Riesen, die jeden Sommer von den Inlandgletschern der Antarktis in ungeheurer Zahl abbrechen und, Tiefseeströmungen folgend, nach Norden ziehen; ihre Entstehung ist den ersten Südpolforschern noch unerklärlich; wohl aber weiss man, dass solch ein schwimmender Berg einen sechs- bis siebenmal grösseren Tiefgang unter Wasser hat, jedes Schiff also ihm gegenüber eine lächerliche Nussschale ist. Von Tag zu Tag werden nun diese unheimlichen Eisberge zahlreicher und zudringlicher; an ihren hellblau und grün schimmernden Steilhängen tobt die Brandung so heftig, dass der Wellenschaum bis zu ihren Gipfeln emporspritzt, Wolken von weissen, blauen und grauen Sturmvögeln, Raubmöwen, Seeschwalben und Albatrossen, deren Eiement der Sturm ist, umschwärmen sie, und ihre Annäherung drückt auch bei Sonnenschein die Quecksilbersäule des Thermometers gleich um 2 Grad Celsius herab, eine zuverlässige Wamung besonders bei unsichtigem Wetter. Nebel ist im Eismeer überall des Seemanns schlimmster Feind, er ist unberechenbar und stürzt unversehens wie eine Lawine hernieder. Die Gelehrten der „Resolution“ wissen davon zu erzählen. Eine Windstille am 14. Dezember wird von ihnen schnell zu Messungen der Meeresströmungen und -temperaturen benutzt, der Naturforscher Forster und Astronom Wales sind in einem kleinen Boot nahe dem Schiff eifrig damit beschäftigt, als sie plötzlich in einer weissen Wolke stehen, dicker Nebel hat in wenig Augenblicken beide Schiffe wie verschluckt. Sie rufen — keine Antwort kommt; sie rudern unruhig hin und her, schreien, so laut sie können — alles bleibt totenstill. Was sollen sie tun? Sie haben weder Mast noch Segel noch die geringsten Lebensmittel, nur ihre zwei Ruder. Das beste wird sein, da zu bleiben, wo sie sind; so lange die Windstille anhält, werden die Schiffe hoffentlich nicht abtreiben. Die zwei Männer horchen gespannt auf jeden Laut. Nach endlos langer Zeit läutet wie aus grosser Entfernung eine Schiffsglocke; sie rudern in Schallrichtung, rufen immer wieder, erhalten endlich Antwort und sehen den schwarzen Bug eines Schiffes — es ist die „Adventure“, deren Befehlshaber Kapitän Tobias Fourneaux auch nicht ahnt, wo das Flaggschiff steckt. Ein Kanonenschuss fragt in die Weite — die Antwort kommt aus solcher Nähe, dass man sich von Bord zu Bord mündlich verständigen kann. Darauf kehren die Gelehrten zur „Resolution“ zurück; nach den verlebten Schreckensstunden kommen ihnen ihre höhlenartigen Kabinen und feuchten Betten als Gipfel der Behaglichkeit vor.
Cook steuert auf dem 22. bis 23. Längengrad südwärts. Nach Osten wird eifrig Ausschau gehalten, dort müsste irgendwo Kap Bouvet aufragen. Offiziere und Mannschaft wollen alle Augenblicke mit Bestimmtheit Land sehen; beim Näherkommen sind es Wolken, Nebelbänke, höckerige Eisinseln und hohe Eisberge, an deren Fuss Pinguine spielen und zahlreiche Walfische ihre Fontänen in die Luft blasen. Wenn Kap Bouvet Vorgebirge ist, müsste hier herum die Küste seines Hinterlandes sich nach Südwesten hinziehen; statt dessen legt sich am 14. Dezember auf 54° 55′ s. Br. undurchdringliches Packeis in den Weg. Cook segelt an dessen Rand vorsichtig nach Osten, wagt es hin und wieder, schmale Ausläufer des Packeises zu durchschneiden und bohrt sich, wo immer eine Lücke klafft, nach Süden und Südosten durch, meist im Nebel sich vortastend, von Schneefällen, Regen und Hagelschauern begleitet. Bei der Mannschaft zeigen sich, trotz des täglich verabreichten Sauerkrauts, Anzeichen von Skorbut, aber reichlicher Genuss von Bierwürze erweist sich als sicheres Heilmittel. Die erste Reise in die Antarktis muss in jeder Hinsicht eine Studienfahrt sein; man lernt den „Eisblink“, den Widerschein grosser Eisfelder am Horizont, von dem dunklern Wasserhimmel unterscheiden und aus Meereis Trinkwasser gewinnen, denn gefrierendes Seewasser scheidet seinen Salzgehalt aus; aber blosses Eiswasser lässt die Halsdrüsen anschwellen, daher der häufige Kropf der Gebirgsbewohner; immerhin beseitigt es die schwerste Gefahr damaliger Seereisen, Mangel an Trinkwasser, und die Schildwache neben der Wassertonne auf Deck braucht es nicht gar so streng mehr zu nehmen. Zum Waschen aber benutzen Kapitän und Mannschaft ausnahmslos Seewasser.
Auf dem 33. Längengrad treibt heftiger Oststurm die Schiffe bis 9° 45′ nach Westen zurück, aber da das Packeis nach Norden abschwimmt, gewinnt Cook Raum nach Süden. Hier wenigstens, fast südlich von Kap Bouvet, müsste doch nun endlich die Küste seines Hinterlandes erscheinen, aber nichts zeigt sich. Sobald der Wind sich dreht, geht die Fahrt nach Osten und Südosten weiter, und der 17. Januar 1773 wird der erste denkwürdige Tag in der Geschichte der Südpolforschung: Cook überschreitet den südlichen Polarkreis (66½°), bricht sich an dreissig grossen Eisfeldern entlang Bahn durch das Packeis bis 67° 17′. Hier aber, auf 39° 35′ ö. L., kündigt der Eisblink ein unabsehbares, festes und ebenes Eisfeld an; sein Nordrand ist eine 5 bis 6 Meter hohe Eismauer, an deren Fuss sich ein dicker, kaum von der Dünung bewegter Brei von löcherigem, zermürbtem, auffallend schmutzigem Brucheis entlangzieht. Cook steht hier zum erstenmal vor der Kante eines jener unermesslichen Eisgletscher, die sich vom antarktischen Inland langsam nach Norden vorschieben und Eisberge „kalben“, auf dem Wasser schwimmen, aber irgendwo auf festem Land aufliegen. Er weiss sich diese befremdende Erscheinung noch nicht zu deuten, und da er hier weder im Süden noch im Osten durchkommt (hinter den Eismassen im Osten verbirgt sich das 58 Jahre später entdeckte Enderby-Land), begibt er sich nordostwärts auf die Suche nach Kerguelen-Land, der neuesten Entdeckung der Franzosen, von der er in Kapstadt gerade noch vor seiner Abfahrt gehört hat. Da Näheres über seine Lage usw. nicht bekanntgemacht wurde, findet er die Küste nicht, wo er sie sucht, aber er kreuzt hin und her und fährt schliesslich südlich der vom Entdecker angegebenen Breite nach Südosten durch, also kann es sich auch da nur um eine Inselgruppe handeln, die keinerlei Verbindung mit einem südlichen Kontinent hat.
Am 8. Februar kommt bei dickem Nebel die „Adventure“ ausser Sicht und bleibt, trotz zweitägigen Suchens und Signalisierens mit Leuchtfeuern und Kanonenschüssen verschollen. Cook lässt sich dadurch nicht abschrecken, obgleich die Matrosen verdriessliche und angstvolle Gesichter ziehen, und steuert mit der „Resolution“ weiter nach Südosten. In drei aufeinanderfolgenden Nächten sehen menschliche Augen zum erstenmal das Südlicht, den würdigen Bruder des Nordlichts; am östlichen Himmel schiesst es in breiten, diesmal nur weissen Bändern empor und überzieht mit seiner Pracht den ganzen Südhimmel, den Glanz der Sterne verlöschend. Cook kommt aber jetzt nur bis zum 62. Grad, wo auf dem Meridian des spätern Gaussberges (95° ö. L.) festes Eis ihm den Weg verlegt. Er zieht sich in die Nähe des 60. Breitengrades zurück und segelt auf diesem Strich weiter bis zum 148. Längengrad, ohne irgendwo Land zu sehen. Dann nimmt er Richtung nach Nordosten, auf Neuseeland zu, wo er am 25. März eintrifft und auch das Begleitschiff wiederfindet, das schon am 1. März dort anlangte. Die Segel sind zerrissen, das Tauwerk in Stücken, das Schiff bedarf einer gründlichen Erneuerung, vor allem die Besatzung einer ausgiebigen Erholung, die sie auf Tahiti und andern Inselparadiesen der Südsee vollauf findet.
In 117 Tagen hat er ein Drittel des vorgeschriebenen Kreises umfahren; am 22. November 1773 nimmt er das zweite Drittel in Angriff. Da er Neuseeland selbst schon früher umsegelt hat, sucht er in dessen Süden nicht mehr nach dem antarktischen Kontinent; dadurch verfehlt er das Haupttor in die Festung des Südpols auf dem 180. Grad und überlässt, ohne es ahnen zu können, den Ruhm der Entdeckung des Rossmeeres einem spätern Nachfolger. Er segelt vielmehr — und zwar mit der „Resolution“ allein, denn die „Adventure“ ist im Oktober abermals verlorengegangen und taucht erst am Ende der Reise wieder auf — nach Südosten, trifft hier erst auf 62° Eisberge an, überschreitet am 20. Dezember 1773 den Polarkreis zum zweitenmal, kommt aber nur bis 67° 31′ (auf 142° 54′ w. L.). Da die halbe Mannschaft an Rheumatismus, Vorbote des Skorbuts, erkrankt — Forster ist vier Wochen bettlägerig —, macht er eine Erholungsreise nach Norden, die, wie überhaupt jede eingeschlagene Richtung und jeder Abstecher, bestimmten Erkundungen von Meeresstellen oder Landküsten dient, dann aber, zum höchsten Verdruss der Mannschaft, noch einmal einen Vorstoss nach Süden und dringt, den Polarkreis zum drittenmal schneidend, am 30. Januar 1774 auf 106° 54′ w. L. bis 71° 10′ vor, seine höchste Breite, die fast ein halbes Jahrhundert lang nirgends überholt wird und an dieser Stelle bis heute noch von keinem andern Südpolfahrer erreicht ist. Cook hat wohl selbst die Überzeugung, dass ihm kein zweites Mal ein so tiefes Eindringen in das Geheimnis der Antarktis beschieden sein wird, und schildert die auch ihn überraschende Eislandschaft, die an jenem 30. Januar vor ihm liegt, mit folgenden Worten:
„An diesem Tage bemerkten wir um vier Uhr morgens, dass die über dem südlichen Himmel stehenden Wolken schneeweiss waren und förmlich glänzten. Wir wussten, dass dies das Anzeichen eines Eisfeldes sei, sahen dasselbe auch bald von der Höhe der Masten und waren um acht Uhr an seinem Saum. Es erstreckte sich von Osten nach Westen, so weit unsere Blicke reichten, und die Hälfte des Horizonts war von den Strahlen beleuchtet, die es bis auf eine beträchtliche Höhe ausgehen liess. Ich zählte innerhalb dieser Eisfläche, ausser den Eisbergen an ihrem Rande, noch 97 Eishügel; sie waren zum Teil sehr breit und glichen einer Bergkette, deren Gipfel sich übereinander erheben, bis sie sich in den Wolken verlieren. Der äussere nördliche Rand dieser ungeheuren Fläche bestand aus schwimmenden Eisbruchstücken, die sich so in- und übereinandergeschoben hatten, dass niemand hier hätte eindringen können. Dieser Rand war etwa eine halbe Meile breit, dahinter bildete das feste Eis nur eine einzige zusammenhängende Masse. Die Eishügel ausgenommen, war es niedrig und flach, schien aber nach Süden hin anzusteigen; das Ende war nicht zu erkennen. Noch nie, glaube ich, hat man Berge dieser Art in den Meeren Grönlands gesehen, wenigstens sind sie weder mir noch einem andern, soviel mir bekannt ist, je vorgekommen; man kann also gar keinen Vergleich zwischen den Eisfeldern des Nordens und denen dieser Gegenden ziehen, und diese erstaunlichen Berge geben den sie einschliessenden Eisfeldern ein so bedenkliches Aussehen, dass es eine ganz andere Sache ist, dieses Eismeer zu befahren, als das grönländische. Ich will damit nicht sagen, dass es allenthalben unmöglich sei, weiter vorzudringen; doch würde wohl kein Seemann in meiner Lage diesen gefährlichen Versuch gemacht haben. Ich bin überzeugt, und dieser Meinung pflichtete die Mehrzahl der Offiziere und der Mannschaft bei, dass dieses Eisfeld sich bis zum Südpol erstreckt oder vielleicht bis zu einer Landküste reicht, an der es seit den frühesten Zeiten festsitzt, und dass sich südlich des von mir erreichten Breitengrades das sämtliche Eis bildet, das wir hier und da weiter nördlich fanden; Windstösse oder andere Kräfte reissen es los, und nördliche Strömungen, wie sie überall in diesen Breiten vorherrschen, führen sie milderen Gegenden zu.“
Cook ist von einer wissenschaftlich strengen Vorsicht: was er nicht mit Händen greifen kann, wagt er nicht zu bestimmen; die sonderbaren Berge in der Ferne sehen richtigen Gebirgszügen merkwürdig ähnlich, aber da er auf Landungen an einer Eisküste nicht eingerichtet ist, wird er sich davon mit Sicherheit nie überzeugen können; er begnügt sich also mit dem Vergleich, zum grossen Unterschied von spätern Forschern, die jede grössere Eisbank sofort als eine ncuentdeckte Küste ausposaunen und mit pomphaften Namen plakatieren. Was er sieht, sind höchstwahrscheinlich Ausläufer des Gebirgszugs, der das Rückgrat von Graham-Land bildet, und wäre er etwa 40 Grad östlicher vorgestossen, so hätten seinem Entdeckerblick die Gipfel des noch unbekannten Grahamlandes schon auf 65° s. Br. kaum entgehen können. Aber so nahe bei Kap Hoorn hat er das Meer schon auf seiner ersten Reise bis zum 60. Grad erforscht, und obendrein zwingt ihn Mangel an Lebensmitteln, schleunigst nach Norden zu flüchten. Er selbst erliegt fast den Strapazen, schwebt infolge eines Gallenleidens acht Tage in Lebensgefahr und wird nur dadurch gerettet, dass Forster ihm seinen Hund opfert; das Fleisch des Tieres bringt ihn wieder zu Kräften. Am 10. November bricht er, abermals von Neuseeland aus, nach Kap Hoorn auf, hält sich aber diesseits des 60. Breitengrades und findet auch hier nichts von einem antarktischen Kontinent. Weihnachten ist er an der Küste Feuerlands, und am 6. Januar 1775 verlässt er den Neujahrshafen der Staaten-Insel, um den Kreis um die Antarktis zu vollenden.
Auf den neuesten Karten, die er mit sich führt, steht immer noch südöstlich von Feuerland der Golf von San Sebastians; natürlich findet sich dieses Phantasieprodukt Mercators nicht, aber die Insel San Pedro, die 1675 entdeckt, erst 1756 wieder gesehen und seitdem vergeblich gesucht wurde; von ihrer Nordküste macht er eine genaue Aufnahme und gibt der Insel auf den Rat Försters zu Ehren des regierenden Königs von England den Namen Südgeorgien. Dann steuert er nochmals nach Südosten, um nun auch diesen Teil des Atlantischen Ozeans nach Küsten abzusuchen, und hier gelingt ihm unverhofft die Entdeckung eines neuen Landes, die einzige innerhalb dieser Breiten. Am 31. Januar wird es gesichtet, und das Schiff nähert sich ihm bis auf einen Kilometer. „Der Anblick dieser neuen Küste“, erzählt Cook selbst, „war schauerlich. Die sehr hohen, senkrechten Klippen starrten von schwarzen Höhlen. An ihrem Fuss brandeten tobende Wellen, ihr Haupt verhüllte sich in Wolken, über die ein einziger weisser Gipfel hervorragte. Das südlichste Ende dieses Landes liegt unter 59° 30′ s. B. und 27° 30′ w. L. So weit wir es mit seinen vorliegenden kleineren Inseln kennenlernten, sah es überall gleich öde und furchtbar aus. Ohne die vielen schwarzen Stellen und Höhlen wäre unklar geblieben, ob wir Land oder Eis vor uns hatten. Seeraben, die in den Höhlen nisteten, waren die einzigen Bewohner, selbst die unförmigen Amphibien, die See-Elefanten von Südgeorgien, fehlten.“ Cook nennt seinen Fund Sandwichland nach dem damaligen Chef der englischen Admiralität, den gebirgigen südlichen Teil Süd-Thule und die Nordspitze Frieslandshaupt, weil ein deutscher Matrose an Bord der „Resolution“ namens Friesleben diesen Felsen zuerst gesichtet hatte.
Auf eine nähere Untersuchung dieser Küste verzichtet er, denn die Tage werden kürzer, die Lebensmittel sind schon bedrohlich gering, die Sauerkrautfässer leer, von Würmern zerfressener Zwieback und halbverwestes Pökelfleisch die einzige Nahrung. Er hält Sandwichland für einen Inselarchipel, womit er Recht hat, aber selbst, wenn es der einzige, den 60. Breitengrad überschreitende Ausläufer eines polaren Festlandes wäre, sähe er sich nicht weiter danach um. Er ist ausgezogen, um festzustellen, ob in den ungeheuren Meeren der südlichen Halbkugel ein grosses, bewohn- und kolonisierbares Festland verborgen ruht, und es für England in Besitz zu nehmen. Eis- und Schneegebirge, schauderhafte Klippenküsten wie dieses Sandwichland, an dem man Fels, Erde und Eis kaum voneinander unterscheiden kann, lohnen keine weitere Mühe. Er ist durchaus überzeugt, dass der Südpol einen Landkern hat, von dem sich die Eismassen ablösen, die den Ozean im Süden überall unsicher machen, und aus der Erfahrung, dass sie sich im Atlantischen und Indischen Ozean viel weiter nördlich herumtreiben als anderswo, zieht er den zutreffenden Schluss, dass sich nach diesen beiden Seiten hin beträchtliche Stücke des Polarlandes entsprechend weiter nach Norden vorschieben, Sandwichland also wohl ein Ausläufer davon sein könnte. „Aber“, so erklärt er, „es wäre verrückt gewesen, alles, was wir auf der Reise erzielt hatten, aufs Spiel zu setzen, nur um eine Küste zu entdecken und zu erforschen, die, einmal entdeckt und erforscht, zu nichts dient und deren Kenntnis weder der Schiffahrt noch der Geographie noch sonst einer Wissenschaft förderlich sein kann.“
Um aber den vorgeschriebenen Kreis gewissenhaft zu schliessen, fährt er von Sandwichland ostwärts bis zu dem Punkt, wo er, zu Beginn der Reise von Norden kommend, nach Osten abwich, er segelt dabei über die Stelle hinweg, wo Kap Bouvet liegen soll, und ankert am 22. März 1775 wieder in der Tafelbucht bei Kapstadt, von wo er ausgegangen. Trotz der übermenschlichen Strapazen und Entbehrungen während der fast dreijährigen Reise hat er nur einen Matrosen durch Krankheit verloren, ein Erfolg des Sauerkrauts und der Bierwürze, der den Seefahrern jener Zeit als das grösste aller Wunder erscheint.
Cooks Weltreise um die Antarktis ist mit der Tat des Kolumbus verglichen worden und steht ihr an Kühnheit und Verdienst wenig nach, obgleich sie, in ihrem antarktischen Teil, keine neue Welt hervorzaubert, sondern im Sinne jenes Zeitalters der „Aufklärung“ die Phantasie entthront und die nüchterne Wirklichkeit an ihre Stelle setzt. Die Lieblingsvorstellung der alten Kosmographen, das märchenhafte Südland, hat jetzt abgewirtschaftet, der angebliche Riesenkontinent, der im Stillen Ozean fast den Äquator berühren sollte, schrumpft zu einem gottverlassenen Eisland zusammen, das durch den 60. Breitengrad begrenzt ist, sich aber an mehreren Punkten bis hinter den Polarkreis zurückzieht. Das Bild der südlichen Halbkugel der Erde ist damit in der Tat aufgeklärt, es zeigt unvergleichlich mehr Wasser als Land, und die mathematischen Mümmelgreise müssen nun sehen, wie sie das notwendige Gleichgewicht des Erdballs wieder in Ordnung rechnen.