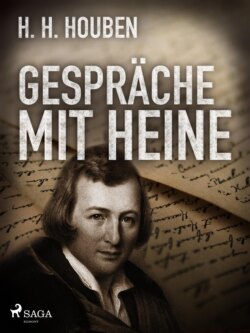Читать книгу Gespräche mit Heine - Heinrich Hubert Houben - Страница 90
На сайте Литреса книга снята с продажи.
86. Eduard Wedekind149
Оглавление16. Juni 1824
[Strodtmanns Bericht nach Wedekinds Tagebuch:] Ein Lieblingsthema, auf das er bei jeder Gelegenheit zurückkam, war die Metrik und die Theorie der Dichtkunst, mit welcher er sich schon in Bonn unter Schlegels Anleitung auf das ernsthafteste beschäftigt hatte. „Sonst“, sagte er einmal, „war es mein stehender Witz, wenn jemand etwas Gutes oder Schlechtes geschrieben hatte: Der hat die Metrik los oder nicht los. Fürwahr, die Metrik ist rasend schwer; es gibt vielleicht sechs oder sieben Männer in Deutschland, die ihr Wesen verstehen. Schlegel hat mich hineingeführt – der ist ein Koloß. Er ist durchaus nicht poetisch, aber durch seine Metrik hat er zuweilen etwas hervorgebracht, was an das Poetische reicht. Auch Voß ist sehr gut.“
„Sie scheinen mir da“, bemerkte Wedekind, „einen weiteren Begriff mit der Metrik zu verbinden, als man gewöhnlich tut. Denn wenn man auch natürlich das Abzählen der Füße und Silben für bloße Nebensache oder für die ersten Elemente hält, so läßt sich doch selbst im übrigen, meiner Meinung nach, der Charakter der meisten poetischen Formen leicht ergründen. Man kann ihn zwar nicht immer in klaren Worten ausdrücken, aber das Gefühl, wenn es einigermaßen gebildet ist, wird einen bald richtig führen. Ich bin überhaupt der Ansicht, daß der Dichter nie die Form suchen muß; er darf sie nicht von dem Kern und Inhalt trennen, sondern ich glaube vielmehr, daß mit dem Gedanken eines Gedichts auch die ihm ganz eigentümliche Form, als eins mit ihm, zugleich entsteht.“
„In der Regel“, sagte Heine, „ist das wohl so, aber nicht immer; manchmal kann man recht gut vorher über die Form nachdenken, weil sie kein bloßes Vehikel, sondern ihrerseits auch produktiv sein soll. Worin bei den Alten der eigentliche metrische Witz liegt, das habe ich bis jetzt nicht herausbringen können. Die antiken Versmaße sagen mir für die deutsche Sprache gar nicht zu, zum Beispiel die Hexameter. Selbst wenn sie ganz richtig und vortrefflich gebaut sind, so daß nichts daran auszusetzen ist, gefallen sie mir doch nicht; nur einige Ausnahmen gibt es, und das sind gerade nicht die besten, zum Beispiel Goethes römische Elegien. Schlegel sagte mir, Goethe habe ihm seine Manuskripte vorgelesen, und er (Schlegel) habe ihn auf manchen Verstoß in der Versifikation aufmerksam gemacht; aber Goethe habe dann in der Regel gesagt, er sehe wohl, daß das nicht ganz richtig sei, aber er möge es doch nicht ändern, weil es ihm so besser gefalle als das Richtigere. Worin liegt das nun?“
„Im Geiste der deutschen Sprache“, meinte Wedekind. „Das ist freilich sehr allgemein gesagt, aber bis jetzt kann ich es nicht näher entwickeln.“
„Auch“, fuhr Heine fort, „sind unter den Ausnahmen – ich meine solche Gedichte, bei denen die antike Form mir zusagt – einige Oden von Klopstok, der Zürchersee zum Beispiel, und die Oden an Ebert und Gieseke. Die Oden gefallen mir überhaupt am besten von Klopstocks Schriften. Den Messias könnte ich nicht lesen; der kommt mir vor wie eine poetische Predigt.“
Die entschiedenste Abneigung hatte Heine gegen alle Reflexionen in Gedichten. „Die sind mir ganz unausstehlich,“ sagte er eines Tages, „besonders solche sentimentale Schneiderreflexionen. Ich habe noch heute (das Gespräch fand am 16. Juni statt) einen kleinen Witz gemacht, worin ich sie parodiere.“ Wedekind bat ihn, das Gedicht vorzutragen, wenn er es auswendig könne. „Ich habe es bei mir“, sagte Heine, griff in die Seitentasche seines Rockes und langte einen sauber zusammengefalteten halben Bogen Postpapier heraus. Das Gedicht, in welchem viel gestrichen und geändert war, lautete nach Wedekinds Aufzeichnung ungefähr so:
Wohl dem, dem noch die Unschuld lacht,
Weh’ dem, der sie verlieret!
Es haben mich armen Jüngling
Die bösen Gesellen verführet.
Sie haben mich um mein Geld gebracht
Mit Kniffen und mit Listen;
Es trösteten die Mädchen mich
Mit ihren weißen Brüsten.
Drauf haben sie mich besoffen gemacht,
Da hab’ ich gekratzt und gebissen,
Sie haben mich armen Jüngling
Zur Tür hinausgeschmissen.
Und als sie mich an die Luft gebracht,
Bedenke ich recht die Sache,
Da saß ich armer Jüngling
Zu Kassel auf der Wache.
Er las das Gedicht sehr lebhaft, und den affektierten, süßlichen Ton parodierend, vor, Wedekind sprach sein Gefallen daran aus. „Es ist für solche Gedichte“, sagte er, „ein guter Probierstein, wenn man sich gleich eine konkrete Person lebhaft dabei vorstellen kann, und hier denke ich mir sofort einen süßlichen Zieraffen, der seine schrecklichen Fata mit aller ihm nur möglichen Weinerlichkeit erzählt. Übrigens möchte ich, daß Sie im letzten Verse die Reime ‚Sache‘ und ‚Wache‘ änderten und auch hier den I- und Ü-Laut setzen, der in den übrigen Versen steht und ganz vortrefflich zu dem Charakter der geschilderten Person paßt.“
„Ich weiß wohl,“ entgegnete Heine, „die letzten Reime taugen nicht: ‚gebracht‘ und ‚Sache‘, zwei A-Laute hintereinander, das ist nicht gut; aber ich kann’s nicht ändern, denn ich muß die Wache am Ende haben. Sehen Sie, das ist nun so ein metrischer Witz: ‚Zu Kassel auf der Wache‘ ist ganz etwas anderes als ‚Auf der Wache zu Kassel‘ und ‚Es haben mich die bösen Gesellen verführt‘ auch etwas anderes als ‚Die bösen Gesellen haben mich verführt‘. Die Hauptpointe macht der ‚Jüngling‘; da fehlt immer ein Fuß, es wird so gezogen.“
„Übrigens“, meinte Wedekind, „würde nicht jeder das Gedicht verstehen, dem Sie es nicht vorläsen.“
„Gott bewahre!“ sagte Heine, „das versteht kein Mensch.“ Und auf die neckende Bemerkung des Freundes, daß er ja erst gestern die Absicht ausgesprochen habe, keine kleinen Gedichte mehr zu machen, erwiderte er: „Ach, das ist kein Gedicht.“ – Lange war er im Zweifel, welche Überschrift er demselben geben solle. Endlich rief er, strahlend vor Freude: „Ich hab’s! Elegie!“
In der Tat veröffentlichte er das Gedicht bald darauf unter diesem Titel... in der von seinem Freunde J. B. Rousseau zu Köln herausgegebenen Zeitschrift „Agrippina“ (Nr. 93 vom 1. August 1824)...
In Anknüpfung an das obige Gespräch fragte Wedekind den Dichter, ob er niemals die eigentliche Satire behandelt habe. „Das ist ein gefährliches Handwerk“, meinte Heine. – „Warum? Sie muß nur nicht persönlich sein.“ – „Pah! alle Satire ist persönlich.“ – Wedekind verwies ihn auf die Satiren des Horaz, in welchen die persönlichen Anzüglichkeiten doch stark verhüllt und gemildert seien. – „Das ist mehr guter Humor“, war Heines Antwort. „Aristophanes ist der größte Satiriker, und ich möchte wünschen, daß die persönliche Satire bei uns wieder in Schwung käme.“ – „Das würde nicht gut sein; es würde zu viele und zu bittere Federkriege absetzen.“ – „Was schadet’s? Das Volk soll auch nicht versauern.“ – „Dann mag es zum Schwerte greifen, und nicht zur Feder.“ – „Haben doch Erasmus und Luther auch mit der Feder gekämpft!“ – „Das war etwas anderes; es war ein hoher und wichtiger Zweck, bei dem das Wohl von Nationen auf dem Spiele stand. Luther mußte natürlich jene höchsten Prinzipien und das, was er als Wahrheit ausstreute, auf alle mögliche Weise verfechten, damit es nicht wieder unterginge. Behandeln Sie indessen die persönliche Satire für sich – es ist eine gute Übung und kann Ihre Freunde ergötzen, wenn Sie auch nicht alles gleich drucken lassen.“ – „Ich habe schon einen Anfang dazu gemacht,“ sagte Heine, „indem ich Memoiren schreibe, die schon ziemlich stark angewachsen sind. Jetzt bleiben sie indes liegen, weil ich anderes zu tun habe; ich werde sie aber fortsetzen, und sie sollen entweder nach meinem Tode erscheinen oder noch bei meinem Leben, wenn ich so alt werde wie der alte Herr [Goethe].“ – „Dem wollte ich wünschen, daß er früher gestorben wäre“, versetzte Wedekind, „die Welt hätte viel verloren, sein Ruhm hätte aber gewonnen.“ Das bestritt Heine durchaus. Er liebte, nach seinem Ausdrucke, freilich Schiller mehr, aber Goethe gefiel ihm besser. „Goethe“, sagte er, „ist der Stolz der deutschen Literatur, Schiller der Stolz des deutschen Volkes.“ Auch stellte er, im Gegensatze zu seinem Freunde Wedekind, Goethe als Dramatiker über Schiller; den „Egmont“, meinte er, habe letzterer nie erreicht. „Werthers Leiden“ hatte Heine noch nicht gelesen; er wollte eines Tages das Buch mit nach Hause nehmen, legte es aber wieder hin, weil er fürchtete, es werde ihn in seiner damaligen Stimmung zu sehr aufregen. Mit großer Verehrung sprach er von Bürger, dessen volkstümliche Art ihm ungemein zusagte.