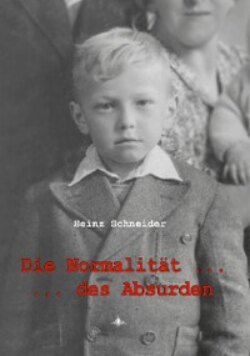Читать книгу Die Normalität des Absurden - Heinz Schneider - Страница 13
ОглавлениеBeginn des Zweiten Weltkrieges
Im Sommer 1939 zog unsere Familie von Neudau in das nahe gelegene Rodisfort, einem Kirchdorf an der Eger. Hier besaßen die Eltern meines Vaters eine große Bauernwirtschaft, die aber in der zweiten Hälfte der 30er Jahre aufgegeben werden musste, denn die Großeltern waren aufgrund ihres hohen Lebensalters nicht mehr in der Lage gewesen, die große Fläche zu bewirtschaften. Von den fünfzehn noch lebenden Kindern wollte niemand Landwirt werden oder einen Bauern heiraten, der die Wirtschaft hätte fortführen können.
Wir bezogen im ersten Stock des sehr schönen Wertz-Hauses (örtlicher Hausname) eine geräumige Zweiraumwohnung – Wohnküche und Schlafzimmer – und fühlten uns inmitten der Wertz-Verwandtschaft (Großeltern väterlicherseits und ihre Nachkommen) sehr wohl. Die Miete war mit zwölf Reichsmark sehr preiswert und erschwinglich.
Die Eltern hatten eine Arbeit in der Lessauer Porzellanfabrik „Concordia“. Rudi, mein sechs Jahre älterer Bruder, besuchte weiterhin die Bürgerschule in Schlackenwerth. Als typischer Draufgänger fand er schnell Kontakt zu den Rodisforter Gleichaltrigen. Mir fiel das mit meinem eher zurückhaltenden Charakter etwas schwerer. Wir spielten oft auf dem hinter dem Haus gelegenen Stengelberg oder auch in der mit einem Holzdach gedeckten Rodisforter Egerbrücke, die schon in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, in der Regierungszeit Kaiser Karl IV., 1364, sieben Jahre nach der Grundsteinlegung für die Karlsbrücke in Prag, errichtet worden war und als architektonische Besonderheit galt. Vater hatte als Kommunist einen sehr guten Kontakt zur Belegschaft seines Betriebes entwickelt. Dennoch wurde ihm in seiner Fabrik von leitenden Mitarbeitern nahegelegt, in die NSDAP einzutreten. Doch dazu konnte er sich nicht entschließen. Noch immer glaubte er, dass Hitler Krieg bedeute, und er behielt seine Meinung nicht für sich.
Nur wenige Wochen später, am 1. September 1939, begann der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. Kurz darauf erklärten Frankreich und England aufgrund ihrer Bündnisverpflichtungen dem Deutschen Reich den Krieg. Im Radio lösten sich zahlreiche Sondermeldungen ab, die nur von den Siegen der deutschen Wehrmacht berichteten. Kurz vor dem Ende des Polenfeldzugs fiel die Rote Armee vom Osten her in das geschwächte Polen ein und besetzte große Teile des Landes. Auch dabei handelte es sich um einen reinen Aggressionskrieg, wobei der größte Teil der gefangenen polnischen Offiziere von den Sowjets bei Katyn getötet wurde. Somit bedeutete letztlich auch Stalin keinesfalls Frieden. Der Mord an den polnischen Offizieren war ein Kriegsverbrechen, das niemand je ahndete.
Zum eisigen Entsetzen meines Vaters verbündete sich die flächenmäßig riesige Sowjetunion, die er bis dahin als das „Vaterland aller Werktätigen“ betrachtet hatte, mit „unserem“ Führer Adolf Hitler und schloss sogar einen Nichtangriffspakt mit ihm. Für meine Eltern, die von den fürchterlichen Verbrechen Stalins an der sowjetischen Bevölkerung nichts wussten, war das ein unglaublicher Verrat des Anführers aller Kommunisten an der deutschen und internationalen Arbeiterklasse. Später glaubte Vater jedoch der offiziellen Version der Kommunistischen Internationale, dass der Sowjetführer durch dieses Zweckbündnis den Krieg für einige Zeit von den alten Westgrenzen der Sowjetunion fernhalten konnte.
Als Sechsjähriger bekam ich von all diesen Problemen nichts mit. Es gab Lebensmittelkarten und ein paar französische Kriegsgefangene, die bei Rodisforter Bauern beschäftigt waren. Wir kannten als Kinder ihre Vornamen und fanden sie im Allgemeinen alle recht nett. Sie unterhielten sich mit uns und machten auf uns keinen bedrückten Eindruck, sondern schienen lustig zu sein und waren auch gut ernährt.
Am 20. Mai 1940 wurde unser Vater zum Militär einberufen und kam zunächst nach Deggendorf in Niederbayern. Mit meiner Einschulung am 1. September 1940 in Rodisfort begann ein neuer Lebensabschnitt. Drei Wochen nach dem Schulbeginn kam meine Schwester Gerti zur Welt. Die Mutter war jetzt Hausfrau und erhielt vom Staat 101 Reichsmark im Monat als Unterstützung.
Bald hatte Vater seinen ersten Urlaub und wir waren froh, ihn wiederzusehen. Wir besaßen ein großes, leistungsstarkes Radio vom Typ Lumophon, welches wir in Schlackenwerth für 238 Reichsmark gekauft hatten. Vater besorgte sich in seinem ersten Urlaub eine sehr lange, gut sichtbare Kupferlitze als Antenne, die in der Sonne golden glänzte und sich ca. achtzig Meter in Richtung des steil aufsteigenden Stengelbergs ausdehnte. Damit hatten wir einen sehr guten Empfang und Vater hörte die verbotenen Sender Radio Moskau, Radio London und Radio Beromünster, womit er umfassend über das Kriegsgeschehen informiert war. Das Abhören von „Feindsendern“ war damals streng verboten und konnte mit dem Tode bestraft werden. Ich musste im Hof aufpassen, ob die Briefträgerin oder sonst jemand kam. Bevor Fremde unsere Wohnung betraten, hatten wir das Radio auf einen genehmigten Reichssender umgestellt.
Schwester Gerti, Mutter Anna, Heinz und Bruder Rudi (von rechts), Frühjahr 1941
Ich besaß vier Bücher, die mir von Verwandten geschenkt worden waren: „Mein Weg nach Scapa Flow“, ein blaues Buch im Lexikonformat über Kapitänleutnant Günther Prien, dem Kommandanten des legendären U-Bootes U 47, das am 8. Oktober 1939 seinen Heimathafen Kiel verließ und am 12. Oktober das Ziel, den britischen Marinestützpunkt Scapa Flow auf den Orkneys, erreichte. Dort versenkte er das berühmte Kriegsschiff „Royal Oak“, das mit 833 Personen unterging. Ein weiteres wurde stark beschädigt. Nach der Rückkehr am 17. Oktober 1939 wurde er von der deutschen Bevölkerung als ein Kriegsheld begeistert empfangen. Auch ich war stolz auf seinen Husarenstreich gewesen wie überhaupt auf alle Siege der Wehrmacht auf dem Land, in der Luft und auf der See. Ferner besaß ich „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ von Mark Twain, außerdem „Die Sklavenkarawane“ von Karl May, ferner „Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe. Meine Eltern verfügten lediglich über ein „Doktorbuch“, welches zwei Abbildungen des menschlichen Körpers beinhaltete. Man konnte dort, aufklappbar, die inneren Organe eines Mannes und einer Frau sehen. Besonders beeindruckte mich die Beilage der Frau mit einem ungeborenen Kind in ihrer Gebärmutter. Bereits damals interessierte mich das Kapitel über die Zuckerkrankheit. Während in der Kriegszeit die meisten gleichaltrigen Jungen Panzerkommandant oder Flugzeugführer werden wollten, kam für mich bereits in meiner Schulzeit der Beruf des Arztes in Betracht.
Gern hätte ich – wie die meisten anderen Jungen – auch Kriegsspielzeug besessen. Meine Eltern erlaubten es mir aber nicht. So besaß ich anstelle eines Papp-Stahlhelms und eines entsprechenden Koppels lediglich einen Metallbaukasten, den mir die Betriebsleitung der in „Melitta“ umbenannten Porzellanfabrik in Lessau auf einer Weihnachtsfeier geschenkt hatte. Die Eltern kauften mir für 150 Reichsmark eine Geige und finanzierten auch den erforderlichen Musikunterricht bei einem bekannten Musikprofessor in Karlsbad. Leider war ich völlig unbegabt und konnte nach einem Jahr gerade einmal „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ spielen, und auch das nur mit zahlreichen Fehlern.
Inzwischen besitzt die Enkeltochter meiner Schwester Gerti die Geige. Sie verfügt über ein großes musikalisches Talent, zaubert hervorragende Melodien aus dem Instrument hervor und freut sich sehr über dieses. Ich indessen bin froh, dass die Großnichte Wiebke an der Geige ihre Freude findet und die damalige Anschaffung meiner Eltern vor ca. sieben Jahrzehnten noch heute auf wunderschöne Weise wirkt.