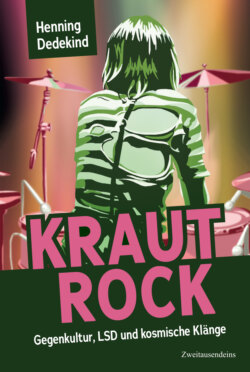Читать книгу Krautrock - Henning Dedekind - Страница 7
Оглавление2. Vorbilder und erste Gehversuche
»Es gab in Deutschland verschiedene Musikkulturen, bedingt durch die verschiedenen Besatzungszonen. Im Norden waren die Engländer, im Süden die amerikanische Zone. Die ganzen deutschen Beat-Bands kamen daher aus Hamburg und nicht unbedingt aus Bayern.«
– Roman Bunka –
Beat-Bands in Deutschland
Bald beginnen auch deutsche Musikgruppen, die Briten zu kopieren. Bands wie The Lords und The Rattles eifern in Musik, Text und Kleidungsstil (oft erfolgreich) ihren Vorbildern nach. In Schulaulen und Kneipensälen entwickelt sich zaghaft eine deutsche Beatszene: »Während der Beat-Zeit habe ich in Kassel gewohnt«, erzählt Roman Bunka. »Meine erste Beat-Band habe ich mit dreizehn, vierzehn auf dem Weg zur Schule gesehen – da wurde ein Eiscafé eröffnet. Man trat auch viel in Sportclubs, bei Schulfesten und Uni-Feten auf. In Kleinstädten wie Rothenfels am Main fanden Beat-Wettbewerbe mit Gruppen aus der Gegend statt.«
Besonders im Norden der Bundesrepublik entsteht, unter dem Einfluss der von den Beatles geprägten Hamburger Clubszene, eine ambitionierte Liga von Imitatoren. Anschauungsmaterial gibt es reichlich: Viele, auch weniger bekannte britische Bands spielen regelmäßig auf dem »Kontinent«, Hamburg wird zum deutschen Mekka des Beat. In der Gruppe The Cavern Beat spielt und singt der junge Frank Bornemann: »Wir haben viel von den Beatles nachgespielt – ich musste immer die McCartney-Stimmen singen.« Von einer lokalen Musikerszene im heutigen Sinne ist man freilich auch im Norden noch Jahrzehnte entfernt. »Vor allem die Schlagzeuger waren damals zum Teil furchtbar schlecht«, sagt Bornemann. »Die Bassisten waren auch nicht gerade zum Angeben. Wir mussten ja alle erstmal lernen – Musik war noch kein Breitensport wie heute.«
Die Nähe zum Beat-Mutterland England erweist sich jedoch als künstlerische Offenbarung. Bornemann ist heute noch begeistert: »Man hatte sehr engen Kontakt zur englischen Szene. Das waren ja vorwiegend Bands aus England, die dort spielten, und als deutsche Band rutschte man so mit rein. Für uns war das ideal: Wir haben ihnen die Riffs und die Gitarrentechniken abgeguckt. Was ich genial fand, war das Gitarrenspiel dieser Londoner Bands. Manchmal hat man sich auch hinter der Bühne unterhalten und gefragt, ›Wie machst du denn das, kannst du mir das mal zeigen?‹ Wir haben Hits nachgespielt und richtig duftes Geld damit verdient.«
Eine gute Amateurcombo kann damals immerhin Gagen zwischen 300 und 600 Mark erzielen. Zudem bieten manche Clubs auch lukrative Wochen- oder Monatsengagements. Die Bedingungen für die Musiker sind allerdings knochenhart. »Im Star Club spielten wir mit fünf, sechs Bands, die sich gegenseitig abgewechselt haben«, erzählt Frank Bornemann. »Das ging bis nachts.« Andere Clubs wie der Top Ten Club in Hamburg und Hannover verlangen fünf Sets von jeweils einer Dreiviertelstunde. Der Rest des Musikeralltags besteht aus Fahrten im klapprigen Bandbus, schnellem Essen an der Imbissbude und dem Schleppen von Instrumenten und Verstärkern.
Im Süden Deutschlands gedeiht derweil eine andere Szene. Nur selten finden britische Gruppen den Weg bis nach München oder Stuttgart. Die Musik, die in den amerikanischen GI-Clubs gespielt wird, ist daher weniger am Beat orientiert. Mitte der Sechziger schwappt dort die Soul-Welle nach Deutschland.
Der musikalische Transfer erfolgt oft über persönliche Kontakte, die sich nicht im Teilen derselben Bühne erschöpfen: Viele zum US-Militärdienst eingezogene Musiker finden in den aufgeschlossenen Deutschen neue Partner. Christian Burchard, Multiinstrumentalist und Gründer der Münchener Embryo, erzählt: »Ich komme aus Hof. Da hatten wir einen Bassisten, Richie, der vorher mit Little Richard gespielt hatte. Wir haben viel mit den GIs gespielt. Hauptsächlich mit den Schwarzen, weil die eine Musik gemacht haben, die uns interessiert hat. Das war so eine Mischung aus Rhythm’n’Blues und Jazz. Chris Karrer (Amon Düül, Anm. d. Red.) hat Banjo in einer Band gespielt, die in amerikanischen Clubs aufgetreten ist.« Das Spielen in den »Amiclubs« bringt für die meist behütet aufgewachsenen Jungmusiker noch einen Kulturschock der besonderen Art mit sich. Roman Bunka:
»Später bin ich nach Würzburg gezogen und habe mit sechzehn in den amerikanischen Clubs gespielt. Das war das erste Mal, dass ich Ratten und Prostituierte gesehen habe. Richtige, lebendige Ratten. Es war unglaublich dreckig, und nachts hingen dort zwielichtige Mädels herum, die ich, aus gutbürgerlichem Milieu stammend, in einer Kleinstadt wie Würzburg vorher nicht zu Gesicht bekommen hatte. Ich wurde dort auch zum ersten Mal mit faulen Eiern beworfen, weil wir zu »schwarze« Musik machten. Die weißen GIs wollten Johnny Cash hören, wir hingegen spielten damals schon mehr R&B-Musik und Underground – Otis Redding und so weiter.«
Vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen begreifen junge Musiker, welche Bedeutung Musik für die eigene kulturelle Identität hat – und beginnen im nächsten Schritt daran zu zweifeln, ob sich auf dem adaptierten Fundament aus Soul oder Beat eine künstlerische Entwicklung gründen lässt. Die Logik erscheint zwingend: Die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation in Deutschland unterscheidet sich so grundlegend von der in England und den USA, dass angelsächsische Muster kaum dauerhaft für die deutsche Jugendkultur übernommen werden können.
Offene Musikform:
Der deutsche Jazz
Der Jazzszene sind derlei Probleme Mitte der Sechziger (noch) fremd. Im Vergleich zu anderen Musikstilen hat der Jazz in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sehr früh ein internationales, europäisches Selbstverständnis entwickelt. Bandleader wie der Saxofonist Helmut Brandt leisten bereits in den Fünfzigerjahren Pionierarbeit, Tourneen und Festivals mit internationalen Größen machen die Musik in ganz Europa für das Publikum greifbar. Eine Gruppe Gleichgesinnter beginnt, sich über ihre Vorlieben zu definieren: Man ist interessiert, raucht Pfeife, tauscht Platten, fachsimpelt, lernt sich kennen. »Vieles entstand aus der frühen Jazz-Bewegung in Deutschland«, erinnert sich Peter Leopold. »Es gab eine Menge Querverbindungen: Christian Burchard von Embryo zum Beispiel habe ich in einem Nürnberger Jazzkeller kennengelernt.« Burchard kann dies bestätigen: »Es war eine Clique, die sich mit Jazz beschäftigt hat, der in der sogenannten Boheme-Szene sehr verbreitet war. In München gab es damals viel mehr Jazz-Clubs als jetzt.«
Anders als Beat und Rock’n’Roll ist der Jazz nicht Sprachrohr einer spezifischen (amerikanischen) Jugendkultur, sondern vielmehr die Musik einer intellektuellen Elite, der nach den Erfahrungen des Dritten Reiches jede Massenbewegung zutiefst suspekt ist. Jazz ist neu, lebensbejahend und gilt als internationale, offene Musikform. Die erblühende junge Jazzszene leidet deshalb auch nicht unter einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber den angelsächsischen Kollegen: »Wir haben viel experimentiert und alle möglichen Sachen ausprobiert«, sagt Hellmut Hattler, der seine Karriere als Bassist in einer Ulmer Jazzband beginnt. »Es war ein guter Testlauf.«
Musik für Minderheiten:
Blues
Eine andere Nische, die sich vielen deutschen Nachwuchsmusikern eröffnet, ist der Blues: Im Rahmen des musikalischen Wanderzirkus American Folk Blues Festival zeigt sich dieser erstmals in einer modernen Vielfalt, die ihre kulturellen Eigenheiten bejaht. Die von Horst Lippmann und Fritz Rau präsentierte Tournee gastiert von 1962 an regelmäßig auf großen europäischen Bühnen wie dem Pariser Olympia oder dem Berliner Titania-Palast und löst eine wahre Blues-Begeisterung aus. Bejubelte Auftritte US-amerikanischer Legenden hieven den in seiner Heimat vergleichsweise wenig geschätzten Stil plötzlich ins internationale Rampenlicht. »Viele amerikanische Musiker haben in Europa den Respekt bekommen, der ihnen zu Hause verwehrt blieb«, sagt Roman Bunka. Vor allem Textinhalte und Gesang bieten ein willkommenes Ventil für eine lang angestaute Emotionalität. Dieses neu geweckte Interesse verstärkt sich ab Mitte der Sechziger durch den Boom des britischen Rhythm and Blues. John Mayall, Alexis Corner, Savoy Brown oder Ten Years After spielen eine leicht unterkühlte Variante des US-amerikanischen Stils und setzen damit einen »erwachsenen« Gegenpol zur grassierenden Beat-Hysterie.
Wenngleich man die britischen Bands als europäische Pioniere bewundert, fühlt man sich doch auch in Deutschland nicht weniger berechtigt, die Musik der ehemaligen afrikanischen Sklaven zu kopieren. Bunka: »Wir haben gesagt, ›aha, die klauen ja auch bloß bei den schwarzen Musikern‹. Das war schön zu sehen. Man hat mehr Selbstbewusstsein bekommen, weil man gemerkt hat, dass die Engländer genauso Weißbrötchen aßen wie wir.« Ein Teil der Nachkriegsgeneration im besiegten Deutschland identifiziert sich mit der unterdrückten Minderheit Amerikas. So kommt es zu vielen Bandgründungen, die den Grundstein für eine bis heute sehr vitale deutsche Bluesszene legen. Roman Bunka verdient sich Mitte der Sechziger zusammen mit Klaus »Funky« Götzner, dem späteren Schlagzeuger von Ton Steine Scherben, in der Gruppe The Blues Campaign seine ersten musikalischen Sporen.