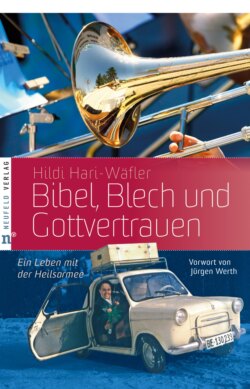Читать книгу Bibel, Blech und Gottvertrauen - Hildi Hari-Wäfler - Страница 10
Schulbetrieb
ОглавлениеUnser Ausbildungsjahrgang trug den Sessionsnamen „Soldaten Jesu Christi“. Wir waren eine bunt zusammengewürfelte fröhliche Schar von 28 jungen Leuten aus der ganzen Schweiz. Fast alle Berufsgattungen waren vertreten. Das erlaubte den Männern, im Laufe der Zeit im Garten eine Baracke zu erstellen und darin zu wohnen. So erhielten wir etwas mehr Platz im Haus. Was uns alle miteinander verband, war der tiefe Wunsch, aus Liebe zu Gott und den Menschen das eigene Leben einzusetzen, ohne groß über die Vor- und Nachteile nachzudenken, die für uns daraus entstehen könnten. Alle hatten wir das gleiche Ziel: Gott und den Menschen zu dienen. Wir waren ja freiwillig gekommen und nicht einem Aufgebot/ Einberufungsbefehl der Schweizer Armee zur Rekrutenschule gefolgt. Gerade hier in der Schule konnten wir bestens unter Beweis stellen, wie ernst es uns damit war. So gehörte etwa zu unserem Kurs ein Teilnehmer mit Frau und Kind. Er hatte sein Theologiestudium an der Universität abgeschlossen und fügte sich nun mit seiner Familie willig in den ganzen Ausbildungsbetrieb ein. Außerdem unterrichtete er uns im Fach „Kirchen- und Heilsarmeegeschichte“. So lernten wir viel über die Ursprünge dieser Bewegung, die sich selbst als „Armee“ bezeichnete.
Es begann im Jahr 1865 in England mit dem Gründer William Booth und seiner Frau Catherine als „Christliche Mission Ost-London“, und wurde seit 1878 unter dem Namen „Heilsarmee“ weitergeführt. Die Anfangszeit war in England und auch später in der Schweiz von Verachtung und Verfolgung geprägt. Da konnte es schon mal faule Tomaten, Eier oder sogar Steine auf diese fürs Straßenbild ungewöhnlichen, uniformierten Gestalten regnen. In krassen Fällen landeten einzelne Anhänger dieser Armee sogar im Gefängnis. So unter anderem Catherine, die Tochter des Heilsarmeegründers. Sie hatte 1881 mit zwei jungen Kolleginnen in Paris „das Feuer“, die Arbeit in Frankreich, eröffnet und kam 1883 nach Genf. Nach heftigen Protesten und Anfangskämpfen wurde sie aus Genf verwiesen. So kam sie nach Neuenburg (Neuchâtel) und landete mit einem ihrer Mitarbeiter für zwölf Tage im Gefängnis. Nach einer Gerichtsverhandlung, in der sie sich selbst verteidigt hatte, wurde sie freigesprochen. Im Schloss Chillon am Genfersee wurde eine 21-jährige Schottin 100 Tage eingesperrt, weil sie auf öffentlichen Straßen Kinderstunden abgehalten hatte. Fast überall in der Schweiz kam es zu Verletzungen und Sachbeschädigungen.
Nach altem Muster verbrachten wir unsere Zeit in Bern in einem streng geführten Internatsbetrieb. Jeder Morgen begann in der Frühe mit einem Appell, und Frauen und Männer wohnten getrennt. Oft mussten wir in Windeseile die langen Haare aufstecken, noch in letzter Minute einen Knopf schließen und einen Kragen zurechtrücken. Für einige von uns war es stets ein Kampf mit der Zeit. Wir atmeten jedes Mal erleichtert auf, wenn alle es geschafft hatten, sich ordentlich angezogen und gekämmt in die Reihe einzuordnen. Um zehn Uhr abends mussten die Lichter gelöscht werden und man durfte nicht mehr miteinander sprechen. Manchmal half eine Taschenlampe über brenzlige Situationen hinweg – dann etwa, wenn wegen Stau im Waschraum die Abendtoilette noch nicht ganz erledigt war und der Weg ins Zimmer und ins Bett gefunden werden musste. Wenn wir allerdings spät von einem Einsatz nach Hause kamen, was ab und zu geschah, galt eine andere Regelung. Glücklich, wer sich schon in frühen Jahren an eine gewisse Disziplin im Leben gewöhnt hatte und sie sich nicht erst jetzt aneignen musste. Frühaufsteher waren eindeutig im Vorteil. Schmerzlich war, dass schon nach relativ kurzer Zeit drei sehr junge Mitschüler „unsere Familie“ verließen: ein Ehepaar, das noch nicht lange verheiratet war, und eine Frau.