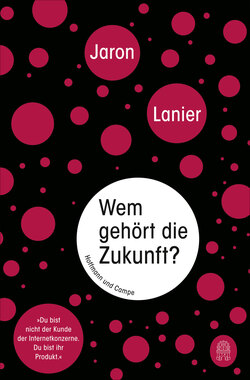Читать книгу Wem gehört die Zukunft? - Jaron Lanier - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеErstes Zwischenspiel: Antike Vorhersagen der technologischen Singularität
Aristoteles ist beunruhigt
Aristoteles äußerte sich ganz konkret über die Rolle des Menschen in einer hypothetisch hochtechnisierten Welt:
Wenn jedes Werkzeug auf Befehl oder diesem zuvorkommend seine Leistung vollzöge, wie von den Bildsäulen des Dädalus die Sage geht oder von den Dreifüßen des Hephästos, die nach des Dichters Wort »aus eigenem Trieb sich in die Götterversammlung begeben«, wenn so die Webschiffe von selbst webten und die Zitherschlägel spielten, ohne dass eine Hand sie führt, dann hätten weder der Meister ein Bedürfnis nach Gesellen noch die Herren nach Sklaven.[1]
Bereits in der Antike machte sich Aristoteles Gedanken über eine zukünftige Welt. Er ging davon aus, dass das Menschsein unter anderem auch darin besteht, das tun zu müssen, was Maschinen nicht leisten können. Gleichzeitig überlegte er, zumindest ansatzweise, dass Maschinen noch mehr leisten könnten als bisher. Aus diesen beiden Überlegungen schloss er: Bessere Maschinen könnten irgendwann die Menschen befreien und auf eine neue Entwicklungsstufe heben – sogar die Sklaven.
Wenn wir Aristoteles unsere heutige Technologie zeigen könnten, was würde er wohl zum Problem der Arbeitslosigkeit sagen? Würde er die Position von Marx übernehmen, dass bessere Maschinen den Staat dazu verpflichten, sich um die Menschen zu kümmern, die nicht mehr arbeiten müssen, und ihnen ein würdevolles Dasein zu ermöglichen? Oder würde er sagen: »Werft die, die nicht benötigt werden, aus der Stadt. Der Staat, die Polis, ist nur für diejenigen, denen die Maschinen gehören oder die das tun, was die Maschinen noch nicht leisten können.«
Würde er tatenlos zusehen, wenn Athen entvölkert werden würde?
Ich möchte Aristoteles nur Gutes unterstellen und nehme daher an, er würde erkennen, dass beide Vorstellungen Humbug sind. Die angebliche Autonomie der Maschinen ist bloßes Gerede. Man darf sich Informationen nicht als eigenständige Sache vorstellen, sondern muss sie als menschliches Produkt begreifen. Ich halte es für sehr gerechtfertigt, zu betonen, dass die Menschen immer noch gebraucht werden und wertvoll sind, selbst wenn der Webstuhl ohne menschliche Muskelkraft betrieben wird. Der Webstuhl läuft immer noch nach den Vorgaben des Menschen, aufgrund seiner gedanklicher Leistung.
Aristoteles spielt in der zitierten Stelle an Homers Schilderung der Schmiedegesellen des griechischen Gottes Hephästos an. Es geht um roboterartige Diener – den Traum eines jeden Nerds: goldglänzend, weiblich und willig. Falls Aristoteles den Gedanken hatte, dass die Menschheit eines Tages wirklich Roboter erfinden würde, die Webstühle betreiben und Musik machen, so hat er das jedenfalls nicht explizit gesagt. Für mich liest sich das eher so: Die Menschen warten darauf, dass die Götter ihnen ein paar raffinierte Automaten zu Verfügung stellen, damit die Automatenbesitzer fortan nicht mehr andere für die Arbeit bezahlen müssen.
Genau das ist unsere Situation im frühen 21. Jahrhundert. Die künstliche Intelligenz in den Servern schenkt uns eine Automatisierung, sodass wir uns nicht mehr gegenseitig für unsere Arbeit bezahlen müssen.
Sollen Menschen bezahlt werden, auch wenn sie etwas gerne machen?
Aristoteles sagt gewissermaßen: Zugegeben, es ist eine Schande, dass wir Menschen versklaven, aber wir müssen das tun, denn irgendjemand muss ja die Zither spielen, denn wir brauchen Musik. Ich meine, jemand muss leiden, damit es Musik gibt. Wenn wir ohne Musik leben könnten, dann könnten wir vielleicht ein paar dieser armen Sklaven befreien, und die Sache wäre erledigt.6
Zu meinen Hobbys gehört unter anderem das Spielen heute weitgehend unbekannter archaischer Musikinstrumente, daher weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das Spielen der Instrumente, die den alten Griechen zur Verfügung standen, sehr mühsam ist.7 Auch wenn man sich das heute nur schwer vorstellen kann, für die alten Griechen war das Musizieren auf ihren Instrumenten eine Qual, die man lieber bezahlten Dienern oder Sklaven überließ.
Musik ist heute mehr als nur ein Freizeitbedürfnis. Musiker, die von ihrer Musik leben wollen, werden von einem unerbittlichen Markt dazu gedrängt, zu Symbolen einer Kultur zu werden. Wer sich dem verweigert, wird zwangsläufig zum Symbol einer Gegenkultur (und damit unschädlich gemacht). Die Musiker der Gegenkultur wirken zumeist ein bisschen angeschlagen, verletzt, wild, gefährlich oder verstörend. Musik ist heute nicht mehr ein Unterhaltungsangebot unter anderen, sondern hat etwas Mystisches, in ihr verschmelzen Sinn und Identität. In Musik verwirklicht sich der Fluss des Lebens.
Unzählige Musiker wünschen sich nichts so sehr, als von ihrer Musik leben zu können. Das wissen wir, weil wir ihre Bemühungen in dieser Richtung online verfolgen können. Unablässig wird die Lüge herumposaunt, dass eine neue Klasse von Musikern entstanden sei, die sich dank der Publicity im Internet finanziell über Wasser halten könne. Es gibt diese Leute, aber es sind nur sehr wenige.
Allerdings macht eine beträchtliche Anzahl über das Internet auf sich aufmerksam und kann sich eine Fangemeinde aufbauen. Ich stelle mir vor, dass solche Leute eines Tages von dem, was sie machen, leben können. Wenn man das Design der Informationsnetzwerke verbessert, könnte sich mit der zunehmenden Verbesserung der Maschinen das Leben aller verbessern.
Der Plan
Aristoteles scheut offenbar davor zurück, Angestellte beschäftigen und angemessen entlohnen zu müssen. Seine Äußerung über automatische Webstühle und selbstmusizierende Saiteninstrumente kann als der Wunsch interpretiert werden, dass uns eine bessere Technologie davon befreien möge, auf unsere Mitmenschen angewiesen zu sein.
Es war ja auch nicht so, dass bei der Entstehung der ersten Städte alle von dem Wunsch beseelt waren, einander näher zu sein. Athen war in erster Linie eine Notwendigkeit und erst in zweiter Linie ein Luxus. Jeder mag Freunde, in einer großen Stadt hat man es aber zwangsläufig vor allem mit Fremden zu tun. Wir leben in einer Gemeinschaft, weil das überzeugende materielle Vorteile hat. Eine Gruppe bietet Sicherheit und Bequemlichkeit. Landwirtschaft und Militär funktionierten damals dank der wachsenden Größe der Gemeinschaften besser, und die Städte wurden mit einer Stadtmauer geschützt.
Doch Aristoteles’ Worte bieten auch einen Vorgeschmack darauf, wie belastend das Zusammenleben sein kann. Mit dem Entstehen der Polis ging etwas verloren, und wir träumen immer noch davon, es wiederzufinden.
Ein römischer General erhielt zur Belohnung, wenn er sich nach jahrelangem Militärdienst zur Ruhe setzte, ein Stück Land, das er selbst bewirtschaften konnte. Auf sich gestellt zu sein, die Möglichkeit zu haben, von seinem eigenen Land zu leben, ohne eine Polis, die einen störte, das war damals der Traum. Der amerikanische Westen bot diesen Traum erneut, dort bereut man es immer noch, dass man ihn aufgegeben hat. Der amerikanische Richter Louis Brandeis definierte den Begriff »Privatsphäre« mit den berühmten Worten als »das Recht, in Ruhe gelassen zu werden«.
Doch der Wunsch nach Fülle, nach Sicherheit und Bequemlichkeit, ohne Politik war eine Illusion, die nur in begrenzten Zeiträumen mit militärischer Unterstützung gewahrt werden konnte. Diejenigen, die am meisten von der Zivilisation profitieren, nutzen ihre Macht, um eine temporäre Illusion der Freiheit von Politik zu schaffen. Die Reichen leben hinter Zäunen und Mauern, nicht nur um sich zu schützen, sondern auch um so zu tun, als ob sie die anderen nicht bräuchten. Im Zitat von Aristoteles scheint bereits die Hoffnung auf, dass der technische Fortschritt ebenfalls eine schützende, isolierende Hülle um Personen schaffen und so die territorialen Eroberungen ersetzen könnte.
Der Menschen strebt von Natur aus nach den Vorteilen der Gemeinschaft, die eben auch den Umgang mit Fremden umfasst. Der Fremde muss nicht mein Freund sein. Er will nur das gleiche Recht auf Schutz und Sicherheit in Anspruch nehmen wie ich.
Das ist die etwas klischeehafte Kritik an der derzeitigen Online-Kultur. Man hat Tausende »Freunde« und starrt doch, wenn man mit anderen zusammen ist, lieber auf einen kleinen Bildschirm. Wie damals in Athen, so heute im Internet.