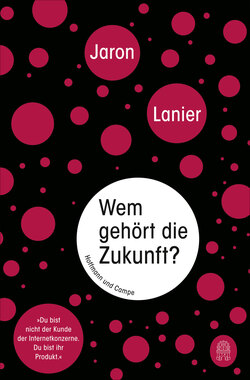Читать книгу Wem gehört die Zukunft? - Jaron Lanier - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеBereits als Teenager in den siebziger Jahren wurde ich zum digitalen Idealisten. Schuld daran ist eine Anekdote aus der Musikgeschichte: Afroamerikanischen Sklaven war es lange Zeit verboten, Trommeln zu spielen, weil Trommeln als Kommunikationsmittel genutzt wurden. Die Sklavenbesitzer fürchteten, dass die Trommeln dazu verwendet werden könnten, Revolten zu organisieren.
In der Menschheitsgeschichte war der Mensch schon immer sich selbst der ärgste Feind, und wann immer jemand andere unterdrückt, versucht er auch, die Kontrolle über die Kommunikationsmittel zu erlangen. Digitale Netzwerke erschienen mir und meinen Mitstreitern damals, als sie aufkamen, als neue Wendung in einem alten Spiel. Ein digitales Netzwerk passt sich Fehlern und Schwachstellen ständig an, indem es sie einfach umgeht. Das entspricht seiner »Natur«. Daher wäre es schwierig, so unsere damalige Meinung, ein digitales Netzwerk zu dominieren. Die digitalen Netzwerke könnten als Trommeln fungieren, die nie zum Schweigen gebracht werden!
Das war die Idee, die ganz am Anfang stand, vor langer Zeit, als das Internet noch gar nicht existierte. Für mich klingt sie immer noch richtig, und irgendeine Version dieser richtigen Idee muss auch machbar sein, doch das spezielle, seltsame Netzwerkdesign, das wir bislang aufgebaut haben, hat sich als Bumerang erwiesen.
Derzeit lernen wir, mit den Netzwerken zu leben, die wir bislang geschaffen haben. Wenn man das verstanden hat, ergeben aktuelle Ereignisse, die scheinbar gar nichts miteinander zu tun haben (und womöglich sogar sinnlos erscheinen), plötzlich einen Sinn. So schienen zwei gigantische Fehlfunktionen, die zwischen dem Erscheinen meines Buches in den USA und der deutschen Ausgabe auftraten, auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun zu haben. Aber wenn man ein bisschen genauer hinsieht, begreift man sie als Spiegelbilder.
Die erste Fehlfunktion war der heftige Streit um »Obamacare« – die von Präsident Barack Obama eingeführte allgemeine Krankenversicherung, die die amerikanische Bevölkerung tief spaltet. Beim Streit zwischen Regierung und Kongress wurden staatliche Einrichtungen geschlossen, und das Land stand kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Es gibt sicher zahlreiche interessante Interpretationen des Konflikts um »Obamacare« (eine Fortsetzung des Bürgerkriegs?), man sollte jedoch nicht vergessen, worum es eigentlich geht.
Im Grunde stritten wir uns darüber, wie die Gesellschaft »Big Data« integriert.1 Wie ich in diesem Buch erkläre, änderte sich mit dem Aufkommen der Big Data die Motivation der Versicherungsunternehmen. Bevor Rechnerleistung unglaublich günstig wurde und alle Rechner miteinander vernetzt waren, konnte ein Versicherer seine Gewinne in erster Linie dadurch erhöhen, dass er immer mehr Kunden versicherte. Nach dem Aufkommen der Big Data kehrte sich diese Motivation ins Gegenteil: Jetzt machte ein Unternehmen vor allem dann Gewinn, wenn es nur diejenigen versicherte, die laut Algorithmenberechnungen die Versicherung am wenigsten in Anspruch nehmen würden.
Diese strategische Kehrtwende sorgte dafür, dass viele Amerikaner nicht versichert waren. Da die Amerikaner ein mitfühlendes Volk sind, starben die Menschen deshalb nicht gleich massenweise draußen auf der Straße, weil ihnen die Aufnahme im Krankenhaus verweigert wurde. Stattdessen bezahlten die Bürger für sie auf die teuerste Weise: Die Kranken wurden nur im Notfall behandelt. Das wiederum belastete die Wirtschaft, führte zu einer Einschränkung der persönlichen Freiheit (weil man, um seine Krankenversicherung zu behalten, auch einen ungeliebten Job behielt) und hemmte das Wirtschaftswachstum und die Innovationsfähigkeit. Außerdem verschlechterte sich der allgemeine Gesundheitszustand der Bevölkerung.2
Mit »Obamacare« soll die Kehrtwende rückgängig gemacht werden, was bedeutet, dass sich viel mehr Amerikaner versichern müssen und die Versicherer ähnlich wie früher, vor dem Zeitalter der Big Data, um Kunden konkurrieren sollen.
Niemand bestreitet, dass Big Data in der Medizin und im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielen. Informationen sind per Definition das Rohmaterial für Feedback und damit für Innovationen. Doch für die Integration der Big Data in die Gesellschaft gibt es nicht nur diesen einen Entwurf. Da die digitale Technologie immer noch relativ neu ist, kann man leicht der Illusion verfallen, es gäbe nur ein mögliches Design. Aber wäre es nicht auch vorstellbar, dass man Big Data zum Vorteil der Wirtschaft und der Menschen nutzt? Mit dieser Frage beschäftige ich mich in meinem Buch.
Die zweite Fehlfunktion platzte wie eine Bombe und betrifft die Enthüllungen von Edward Snowden. Er machte publik, dass die National Security Administration (NSA) ihre Befugnisse weit überschritten hat und jeden ausspioniert, ob Freund oder Feind, dass sie Verschlüsselungen knackt, die unsere Transaktionen schützen, und die Welt der »kostenlosen« Internetdienste in ein Orwell’sches Monster verwandelt.
Die NSA sah sich genötigt, zu belegen, dass das allgemeine Ausspionieren mit Hilfe von Algorithmen spezielle Vorteile hat. Altmodische Geheimdienstarbeit vor Ort erbringt immer wieder handfeste Resultate, etwa das Aufspüren von Osama bin Laden, doch die Hoffnung auf eine automatische Sicherheit durch die auf Big Data angewandten Algorithmen hat sich schlicht und einfach nicht bewahrheitet: Die Bombenanschläge beim Boston-Marathon erfolgten genau in der Woche, als mein Buch in den USA erschien, und konnten weder durch versteckte Serverfarmen verhindert werden, die so groß wie ganze Städte sind, noch durch Metadaten-Analysten oder Überwachungskameras.
Tatsächlich erhöhte die irrsinnige Datensammelwut der NSA ihren Bedarf an Technologiespezialisten dermaßen, dass dadurch die eigene Disziplin geschwächt wurde und das Auftauchen eines Snowden unvermeidlich war. Ganz abgesehen von der Frage, ob man die Strategien der NSA im Zeitalter von Big Data befürwortet oder mit Entsetzen betrachtet, muss man feststellen, dass die NSA dadurch an Kompetenz eingebüßt hat.
Die NSA und die amerikanischen Krankenversicherer erlagen derselben Schwäche, einer Form der institutionellen Abhängigkeit. Sie wurden abhängig von einem, wie ich es nenne, »Sirenenserver«. Hinter einem »Sirenenserver« verbergen sich enorme Rechnerleistungen, die alle anderen Rechner im Netzwerk übertreffen und ihren Eigentümern auf den ersten Blick einen garantierten Weg zu unbegrenztem Erfolg bieten. Doch diese Vorteile sind reine Illusion und führen über kurz oder lang zu einem massiven Scheitern.
Von Edward Snowdens Enthüllungen fühlen sich Menschen auf der ganzen Welt betroffen. Wir wissen nicht, ob jemand unsere privaten E-Mails gelesen hat. Das ist ein unangenehmes Gefühl, und falls wir uns je daran gewöhnen sollten, wäre es noch schlimmer.
Gleichzeitig muss man aber auch fragen, warum jedermann auf der ganzen Welt seine Informationen Rechnern anvertraut, die großen Konzernen gehören. Die NSA hat sich den Zugang zu diesen privaten Rechnern heimlich verschafft, aber warum glaubten alle, dass die fast einhellige Unterstützung einer Überwachungsindustrie durch die Verbraucher folgenlos bleiben würde? Früher oder später muss sie zu einem Überwachungsstaat führen.
Die entscheidende Frage unserer Zeit lautet, ob wir – und damit meine ich uns alle, nicht nur diejenigen, die sich um die »Sirenenserver« kümmern – lernen werden, dem Lockruf der »Sirenenserver« zu widerstehen. Das ist die Klammer, die ansonsten gegensätzliche Entwicklungen zusammenhält. Die eine Entwicklung sieht so aus: Computernetzwerke, so heißt es, könnten eine zentralisierte Macht stürzen und die Macht dem Einzelnen geben. Kunden können Konzerne in die Knie zwingen, indem sie massiv Beschwerden tweeten. Eine kleine Organisation wie WikiLeaks kann große Mächte in Unruhe versetzen und benötigt dazu nur einen Netzzugang und Verschlüsselungstechniken. Junge Ägypter konnten mit ihren Mobiltelefonen und dem Internet fast aus dem Stegreif eine Revolution organisieren.
Es gibt aber auch die gegenläufige Entwicklung: In den reichen Ländern weltweit, nicht nur in den USA, wächst die Ungleichheit bei der Einkommensverteilung. Das Geld der Reichen, die nur das oberste eine Prozent der Bevölkerung ausmachen, überschwemmt unsere Politik. Der Arbeitsmarkt in den USA ist ausgehöhlt. Unbezahlte Praktika sind gang und gäbe, und »Einstiegsgehälter« werden über das ganze Berufsleben hinweg gezahlt, während Spitzenmanager und -technologen Fantasiegehälter beziehen. Der Einzelne scheint angesichts dieser Ausblicke machtlos.
Die Zerrüttung und Dezentralisierung von Macht fällt mit einer intensiven und scheinbar unbegrenzten Konzentration von Macht zusammen. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, erscheint völlig logisch, wenn man erst einmal die Natur moderner Machtkonzentration verstanden hat.
Egal welches neue Machtzentrum Sie genauer unter die Lupe nehmen, Sie werden feststellen, dass ihm immer ein »Sirenenserver« zugrunde liegt. Wir frühen digitalen Idealisten sind an dieser Entwicklung weiß Gott nicht ganz unschuldig, wenn wir auch in bester Absicht gehandelt haben. Wir dachten, wir könnten die Welt verbessern, wenn alle so viele Informationen wie möglich austauschen, befreit von kommerziellen Zwängen. Eigentlich eine völlig vernünftige Idee. Wir haben Trommeln gebaut, die man nicht zum Schweigen bringen konnte. Die Möglichkeit, Öffentlichkeit zu schaffen, damit man nicht mehr die Augen vor Ungerechtigkeit und Gewalt verschließen konnte, würde doch sicher für mehr Gerechtigkeit und Frieden sorgen?
Warum ist die Idee des freien Informationsaustauschs gescheitert? Weil sie die Natur der Informationstechnologie ignorierte. Auch im Zeitalter vor der Computerisierung konnte es Probleme geben, wenn eine Gruppe Menschen alles offen miteinander teilte – wie verschiedene sozialistische Experimente zeigen. Aber andererseits war ihr Scheitern, zumindest unter gewissen Umständen, nicht unbedingt vorprogrammiert.
Wenn dieselben Leute aber über ein Computernetzwerk verfügen, dann steht von vornherein fest, dass derjenige, der den leistungsstärksten Computer hat, auch die Informationshoheit erlangen wird. Alle Menschen sind gleich, Computer aber nicht. Ein Spitzencomputer kann seinem glücklichen Besitzer grenzenlosen Reichtum und Einfluss bringen, für alle anderen jedoch bedeutet das Unsicherheit, Sparpolitik und Arbeitslosigkeit.
Früher erlangte man Macht und Einfluss, indem man die Kontrolle über das erlangte, was die Menschen benötigten, etwa Öl oder Verkehrswege. Heute kann man Macht in Form von Informationshoheit erlangen, die vom effektivsten Rechner in einem Netzwerk geschaffen wird. In den meisten Fällen ist das der größte Rechner mit der besten Vernetzung, allerdings genügt manchmal auch ein kleiner, effektiv genutzter Rechner, wie der Fall WikiLeaks zeigt. Diese Beispiele sind jedoch selten, daher sollten wir nicht der Illusion verfallen, dass Computer, wie einst die Schusswaffen im Wilden Westen, die großen Gleichmacher sind.
Bei dem, was ich »Sirenenserver« nenne, handelt es sich in der Regel um gigantische Rechenzentren an entlegenen Orten mit einer eigenen Energieversorgung und einem speziellen, natürlichen Standortvorteil, etwa einem abgelegenen Fluss, dessen Wasser man zur Kühlung verwenden kann, da riesige Mengen an Abwärme entstehen.
Diese neue Klasse der ultra-einflussreichen Computer tritt in vielen Formen auf. Manche werden im Finanzsektor genutzt, etwa für den Hochfrequenzhandel, andere im Versicherungswesen. Manche berechnen Wahlergebnisse, andere betreiben riesige Online-Stores. Manche betreiben soziale Netzwerke oder Suchmaschinen, wieder andere dienen nationalen Geheimdiensten. Die Unterschiede sind nur minimal.
Die Motivation für den allgegenwärtigen Einsatz der »Sirenenserver« besteht darin, dass man damit marginal effektive Verhaltensmodelle ableiten kann, sowohl für das menschliche Verhalten als auch für Ereignisse, etwa die Entwicklungen auf dem Finanzmarkt. Diese Modelle sind alles andere als perfekt, sondern reichen gerade aus, um das menschliche Verhalten einigermaßen vorherzusagen und uns nach und nach zu manipulieren und unseren Geschmack und unser Konsumverhalten effektiver und hinterhältiger zu beeinflussen, als es der klassischen Werbung und der »Schleichwerbung« möglich ist. Ein leichter Vorteil akkumuliert und verstärkt sich wie ein stetig wachsender Zinseszins.
Die Manipulation kann in Form bezahlter Links bei kostenlosen Online-Diensten auftreten, in Form einer automatisch personalisierten Vorstellung eines Kandidaten bei einer Wahl oder eines perfekt zugeschnittenen Kreditangebots. Die Menschen sind selten gezwungen, den Einfluss der »Sirenenserver« in einem bestimmten Fall zu akzeptieren, doch auf einer breiten statistischen Grundlage ist es einer Bevölkerung schier unmöglich, etwas anderes zu tun, als sich mit der Zeit zu fügen. Deshalb sind Unternehmen wie Google so »werthaltig«. Es gibt bei Google keine bestimmte Anzeige, die garantiert funktioniert, doch das gesamte Reklamekonzept von Google muss aufgrund der Gesetze der Statistik funktionieren. Dank seiner überlegenen Rechnerleistung profitiert ein »Sirenenserver« davon, dass er andere zuverlässig manipulieren kann, ohne jemanden zu zwingen.
Seit Netzwerke und Rechnerleistung so günstig sind, ist der Finanzsektor im Verhältnis zur übrigen Wirtschaft enorm gewachsen, allerdings hat er damit das Risiko für die Gesamtwirtschaft massiv erhöht. Das geschieht ganz automatisch, ohne böse Absicht, wenn man in einem offenen Netzwerk einen effektiveren Rechner besitzt als alle anderen. Die überlegene Rechnerleistung ermöglicht es Ihnen, die risikoärmsten Optionen für sich selbst zu wählen und die riskanteren Varianten den anderen zu überlassen.
Ein »Sirenenserver« gewinnt Einfluss durch Zurückhaltung. Das hat etwas Zen-Mäßiges. Finanzunternehmen sind dann am erfolgreichsten, wenn die Beteiligten keine Ahnung haben, was sie finanzieren. Es geht einfach darum, andere dazu zu bringen, die Risiken zu tragen, und Wissen bedeutet Risiko. Die neue Idee ist also, dass man keine Ahnung hat, ob das geschnürte Wertpapierpaket faul ist oder nicht.
Wenn man dieses Prinzip verstanden hat, bleibt von dem scheinbaren Widerspruch – dass Macht gleichzeitig mehr und weniger konzentriert wird – nichts mehr übrig. Altmodische Machtausübung wie die Zensur sozialer Netzwerke würde die neue Art Macht reduzieren – die darin besteht, dass die Nutzer sozialer Netzwerke durch einen privaten Spionagedienst ausspioniert werden.
Wir müssen lernen, den Gesamtzusammenhang zu betrachten, nicht nur die »Gratis«-Verlockungen vor unseren Augen. Unsere schicken Gadgets, unsere Smartphones und Tablet-Computer, haben uns einen neuen Zugang zur Welt verschafft. Wir kommunizieren regelmäßig mit Menschen, von deren Existenz wir vor dem Netzwerkzeitalter nicht einmal gewusst hätten. Wir können jederzeit Informationen zu fast jedem Thema finden. Aber wir haben auch erfahren, dass unsere Geräte und die aus idealistischen Motiven entstandenen digitalen Netzwerke von ultra-mächtigen, fernen Organisationen genutzt werden, um uns auszuspionieren. Wir werden stärker analysiert, als wir analysieren.
In den Anfangszeiten der privat genutzten Computer wurden wir von dem Ideal geleitet, dass Computer Werkzeuge seien, um die menschliche Intelligenz und seine Produktivität auf ein höheres Niveau zu heben. Ich erinnere mich an frühe Werbebroschüren von Apple, in denen Computer als »Fahrräder des Verstandes« bezeichnet wurden. Solche Ideen beflügelten die frühen Pioniere wie Alan Kay, der vor einem halben Jahrhundert bereits in Zeichnungen veranschaulichte, wie Kinder eines Tages Tablet-Computer nutzen würden.
Doch ein Tablet-Computer ist nicht mehr einfach nur ein Gerät, sondern zwingt uns eine neue Machtstruktur auf. Auf einem »Tablet« laufen im Gegensatz zum »Computer« nur Programme, die von einer einzelnen zentralen kommerziellen Autorität genehmigt wurden. Dass er so leicht ist und einen Touchscreen hat, ist gar nicht so wichtig, viel wichtiger ist die Tatsache, dass der Besitzer weniger Freiheiten hat als die Besitzer früherer Generationen digitaler Geräte.
Ein Tablet bietet uns nicht wirklich die Möglichkeit, unsere Angelegenheiten zu unseren eigenen Bedingungen zu regeln. Ein PC ist darauf ausgerichtet, dass uns unsere eigenen Daten gehören. PCs ermöglichten es Millionen Menschen, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. Der PC stärkte die Mittelschicht. Tablet-Computer sind stattdessen auf Unterhaltung ausgerichtet. Das eigentliche Problem ist aber, dass Sie einen Tablet-Computer nicht nutzen können, ohne die Informationshoheit abzugeben. In den meisten Fällen können Sie einen Tablet-Computer nicht einmal einschalten, ohne persönliche Informationen preiszugeben.
Als sich Tablet-Computer auf dem Markt durchsetzten, verkündete Steve Jobs, dass PCs »Lastwagen« seien. Fortbewegungsmittel, die mit was auch immer beladen waren, für Arbeitertypen in T-Shirts und Schirmmützen. Die meisten Verbraucher würden jedoch gewiss ein Auto bevorzugen. Ein schickes Auto. Diese Formulierung deutet an, dass die wirklich attraktiven Kunden den oberflächlichen Glanz von Status und Entertainment der Möglichkeit, Einfluss zu nehmen oder Selbstbestimmung zu erlangen, offensichtlich vorziehen. Das Problem ist nicht Apple. Das Problem ist typisch für die ganze Branche. Früher einmal betrachtete sich Microsoft als eine Art Werkzeughersteller. Doch das Herz der Verbraucher gewann Microsoft mit der Xbox, die im Grunde nur ein Unterhaltungssystem ist.
Der Sieg der Passivität über die aktive Mitbestimmung ist erschütternd. Anscheinend wollen die Verbraucher derzeit gar nicht so klug sein, wie sie – also wir alle – sein könnten. Aber die Verbraucher geben nicht nur der Oberflächlichkeit und Passivität den Vorzug, sondern sie haben auch stillschweigend eingewilligt, sich rund um die Uhr ausspionieren zu lassen. Tatsächlich sind die beiden Trends im Grunde einer.
Damit der Mensch den Verlust der Freiheit widerspruchslos akzeptiert, muss man diesen Verlust anfangs wie ein Schnäppchen wirken lassen. Den Verbrauchern werden »kostenlose« Dienste angeboten (etwa Suchmaschinen und soziale Netzwerke), wenn sie sich dafür ausspionieren lassen. Die einzige »Macht«, die der Verbraucher hat, besteht darin, nach einem besseren Angebot Ausschau zu halten.
Die einzige Möglichkeit, nein zu dieser Pseudo-Alternative zu sagen, besteht darin, die Rolle des Verbrauchers abzustreifen, über sie hinauszuwachsen.
Frei sein bedeutet, eine Privatsphäre zu haben, in der Sie Ihren eigenen Gedanken nachhängen und Ihre eigenen Erfahrungen machen können, bevor Sie diese der Welt draußen präsentieren. Wenn Sie an Ihrem Körper ständig Sensoren tragen – etwa das GPS und die Kamera an Ihrem Smartphone – und ständig Daten an einen Mega-Computer senden, der einem Konzern gehört, der von »Werbekunden« dafür bezahlt wird, dass er die Ihnen direkt zur Verfügung stehenden Optionen manipuliert, werden Sie mit der Zeit Ihre Freiheit verlieren.
Es ist nicht nur so, dass Sie wildfremde Menschen reich machen, ohne selbst dabei reich zu werden, sondern Sie akzeptieren einen Angriff auf Ihren eigenen freien Willen, Bit für Bit. Damit aus der Technik eine Möglichkeit wird, die uns mehr Selbstbestimmung bietet, müssen wir bereit sein, so zu handeln, als ob wir in der Lage wären, mit Macht umzugehen.
Wenn wir jetzt »kostenlose« Dienstleistungen verlangen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir eines Tages dafür bezahlen werden. Wir müssen eine Informationsökonomie für uns verlangen, in der mit der Flut alle Boote nach oben gehoben werden, weil die Alternative eine grenzenlose Machtkonzentration ist. Eine Überwachungsökonomie ist weder nachhaltig noch demokratisch.
Das Internet wird oft mit dem Wilden Westen verglichen, mit seinen Pionieren und Banditen und dem Versprechen von kostenlosem Land (das in erster Linie natürlich nur über eine monopolisierte Eisenbahngesellschaft erreichbar war). Wir haben uns schon früher von dieser Schnäppchenmentalität gelöst und können das wieder tun.
Angesichts unserer wachsenden technischen Möglichkeiten müssen wir über unsere weitere Entwicklung entscheiden. Wann werden wir stolz genug sein, um es mit unseren eigenen Erfindungen aufzunehmen?