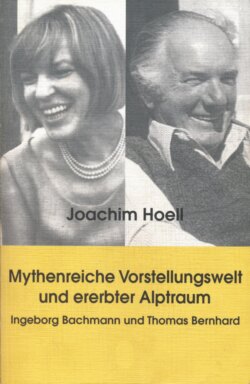Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Deutsches und Österreichisches
ОглавлениеEngländer und Amerikaner sind durch die gleiche Sprache voneinander getrennt.
Oscar Wilde
In den Repliken auf Greiners Text ist Anfang der achtziger Jahre auf die notwendig erscheinende Differenzierung gegenüber der bundesdeutschen Literatur hingewiesen worden. Auf der Frankfurter Buchmesse 1995 ist Österreich Schwerpunktthema, und die Beziehung zu Deutschland wird detailliert untersucht. Durch die deutsche Wiedervereinigung haben sich nicht nur innerdeutsch Verhältnisse und Konstellationen verschoben, sondern auch in bezug auf die anderen deutschsprachigen Literaturen der Schweiz und Österreichs. Der Streit um die österreichische Literatur in der Tradition des habsburgischen Erbes weicht der Debatte um ›Deutsches‹ und ›Österreichisches‹.
Zwischen der DDR und Österreich hatte ein stillschweigender Pakt bestanden, sich gegenüber der großen und mächtigen Bundesrepublik zu behaupten. Der quasikoloniale Status Deutschlands gegenüber Österreich hatte ihr Pendant in dem Verhältnis des ›Klassenfeindes‹ gegenüber der DDR. Dort erscheinen seit den sechziger Jahren viele kritische und ›antifaschistische‹ Werke aus Österreich, da es einen regen Austausch mit der österreichischen KP gab. In einer der vielen Österreich-Anthologien aus der DDR heißt es programmatisch: »Daß jedoch auch wir Bürger der Deutschen Demokratischen Republik unser Selbstverständnis vertiefen, wenn wir Österreicher verstehen lernen, ist die Meinung dieses Buches.«55 Erich Hackl betont seine Probleme mit deutschen und schweizer Verlagslektoren, die Austriazismen im Westduden nachschlagen, wo sie sie nicht finden: »Der VEB-Duden in Leipzig war, logisch, den österreichischen Varianten gegenüber sehr aufgeschlossen.«56 Ein deutscher Rezensent rüge dafür seine penetrant falschen Verbformen.
Diese sprachlichen Unterschiede zwischen deutsch und österreichisch sind das offensichtlichste Beispiel für eine Differenz zwischen den Literaturen, wobei die Austriazismen in Deutschland selten als eigenständige, sprachliche Kulturerscheinung, sondern als Manierismen verstanden werden.57 Bachmann wie Bernhard bilden wiederholt in ihrem Werk sprachliche Besonderheiten aus, die das Österreichische vom Deutschen abgrenzen. In Drei Wege zum See erkennt Jean Améry ein »österreichisches Parlando« (Améry, T 194), welches vor allem durch solche Austriazismen erzeugt werde. Die Musikalität im Werk Thomas Bernhards ist zwar an erster Stelle ein Reflex gegen das Schwerfällige der deutschen Sprache an sich, versucht aber in Tonfall und Melodie, dem einen eigenen österreichischen Sprachgestus entgegenzusetzen: »Man kann sich im Grunde nicht mitteilen. Das ist auch niemandem geglückt. In der deutschen Sprache schon gar nicht, weil die ja hölzern und schwerfällig ist, eigentlich schauerlich. Eine grauenhafte Sprache, die alles tötet, was leicht und wunderbar ist. Man kann sie nur sublimieren in einem Rhythmus, um ihr eine Musikalität zu geben«58. Daß Österreich in Analogie zum anglo-amerikanischen Fall durch die ›gleiche Sprache von Deutschland getrennt‹ ist, ist eine wichtige österreichische Eigenerfahrung. Von Grillparzer und Stifter über Hofmannsthal, Musil, Roth, Broch bis zu Bachmann und Bernhard hat dies die österreichische Literatur beschäftigt und geprägt. Eine Spannung entsteht auch durch die Differenz des Schriftdeutschen gegenüber dem gesprochenen Deutsch in Österreich, das sich in Klang und Vokabular unterscheidet.59
Die Problematisierung von Sprache und ihrer Ausdrucksmöglichkeiten ist ein österreichischer Topos und weist zurück auf Hofmannsthals ›Chandos-Brief‹, Fritz Mauthners Beiträge zu einer Kritik der Sprache, den Tractatus des frühen Wittgenstein wie auf dessen späte Philosophischen Untersuchungen und auf die sprachkritischen Aufsätze von Karl Kraus. Das Möglich- und Notwendigwerden einer neuen Schrift wurde in Österreich früh erahnt, einerseits durch die Vielsprachigkeit im Habsburger Reich, andererseits durch das spannungsgeladene Verhältnis zu Deutschland.
Die Ende der fünfziger Jahre zusammengeschlossene ›Wiener Gruppe‹ mit Friedrich Achleitner, H.C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener schließt an diese sprachkritische Tradition Österreichs an. Diese Avantgarde lernte Thomas Bernhard am Tonhof Gerhard Lampersbergs kennen. Die ›Wiener Gruppe‹ hat einen »neuen Ansatz für eine antimimetische Literatur und eine Dichtung geschaffen, die nicht ausschließlich aus der Sprache und mit der Sprache arbeitet und die sich nicht der Sprache anvertraut, sondern gegen die Sprache arbeitet, sie angreift, demontiert und zerstört oder sie denunziert und als unbrauchbar hinstellt, andererseits aber auf die Sprache als Material angewiesen bleibt und diesen Materialcharakter intensiv betont.«60 Bernhards Libretti und Gedichte zeigen Einflüsse dieser Zeit, aber auch sein dramatisches und erzählerisches Werk ist durch Stilmittel wie Reduktion, Kargheit und eine kritische Haltung gegenüber der Sprache gekennzeichnet. Bachmann hat sich in ihren Auseinandersetzungen mit Wittgenstein und Hofmannsthal auf deren sprachkritische Ansätze bezogen. Die Arbeit gegen die Sprache durchzieht beider Werk und ist eine spezifisch österreichische Problematik.61
Ob sich die Literaturen Deutschlands und Österreichs deswegen grundsätzlich unterscheiden, wird dennoch wiederholt in Frage gestellt. Für Paul Michael Lützeler stehen die Literaturen Österreichs, Ost- und Westdeutschlands und der Schweiz in einem so engen, permanenten und fruchtbaren Interdependenzverhältnis, daß eine Trennung nach Nationen – so psychologisch wichtig sie auch sein mag – etwas Künstliches habe. »Ob sich diese Literatur aber – wie es die Kulturmetaphysiker des Donaulandes wollen – in ihrem ›Wesen‹ von den übrigen deutschsprachigen Literaturen unterscheidet, ist sehr die Frage.«62 Norbert Weber hält jede Österreich-Ideologie für eine Art Dogma, welches »für beliebige Legitimierungsabsichten herangezogen worden ist und mit wechselndem politischen Zusammenhang immer wieder neu den veränderten Gegebenheiten angepaßt wird.«63
Die unterschiedlichen Geschichtsverläufe und kulturellen Prägungen des deutschen Kaiserreiches und des habsburgischen Vielvölkerstaates mit seinen vielen Sprachen deuten auf ein unterschiedlich gewachsenes Bewußtsein hin. Ebenso ist die Nachkriegsgeschichte in beiden Ländern eine völlig andere, denn im Gegensatz zu Deutschland, das geteilt wird, geht Österreich intakt und neutral aus der zweiten Nachkriegszeit hervor. Diese Faktoren zeigen eine sozioökonomische und kulturelle Sonderentwicklung und sind Gründe für die Ausbildung eines distinktiven österreichischen Bewußtseins.64
Die gemeinsame nationalsozialistische Phase Deutschlands und Österreichs zwischen 1938 und 1945 wird in der unmittelbaren Nachkriegszeit unterschiedlich verarbeitet. Deutschland ist in den fünfziger Jahren international stigmatisiert, Österreich gibt sich den Status des Opfers. Gegen die Lüge des Opfermythos wendet sich in den sechziger Jahren eine – vom Ausland neidlos als originär anerkannte – österreichische Literaturgattung: die sogenannte ›Antiheimatliteratur‹.