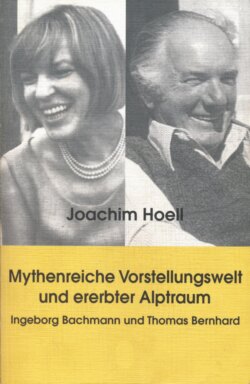Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Antiheimatliteratur
ОглавлениеEhe nicht der Mensch das Gefühl des Weltbürgertums bekommt, […] wird es auf dem apokalyptischen Weg weitergehen.65
Hermann Broch
Die Antiheimatliteratur ist die Negation der Heimatliteratur. Autoren wie Ganghofer, Rosegger, Waggerl verzeichnen mit ihren idealisierten Provinz- und Heimatromanen Millionenauflagen seit den dreißiger Jahren; insbesondere nach 1945 finden diese Autoren eine breite Leserschaft. Gegen diese Scheinidylle der Nachkriegszeit wendet sich der negative Heimatroman.
Das Genre der Heimatliteratur wird durch die Novellen Joseph Schreyvogels zu Anfang des 19. Jahrhunderts eingeleitet. Magris zufolge wird diese Tradition zu einer der exemplarischen Evasionsmöglichkeiten der österreichischen Literatur. Es birgt jene Themen und jene Atmosphäre, welche »die ländliche, provinzielle Dimension des habsburgischen Mythos darstellen.«66 Die idealisierte Welt der Provinz und des Landes werde zum Ausdruck eines Menschenbildes, das auf aktive Teilnahme am Lauf der Geschichte verzichtet und sich in eine idyllische, heitere Gegend flüchtet. Um 1900 ist die ›Heimatkunst‹ die Gegenbewegung zur Großstadtkunst des Naturalismus, um die Literatur wieder auf die ›Urkräfte‹ Volkstum, Stammesart und Landschaft zurückzuführen. Diese fast durchwegs der Trivialliteratur zuzurechnende Literatur geht teilweise im ›Dritten Reich‹ in die sogenannte ›Blut- und Bodendichtung‹ über.67
Heimatliteratur ist ideologisch behaftet, obwohl sie auch ein wertungsfreier Oberbegriff für literarisches Schaffen aus dem Erlebnis der ›Heimat‹, der Landschaft und ihrer Menschen sein kann. Selbst Großstadtliteratur kann Heimatliteratur sein, und sie kann sich zu hoher Kunst erheben, da ›Heimat‹ in der Weltliteratur eine wichtige Rolle spielt: Dublin für James Joyce, Triest für Italo Svevo, Wien für Ingeborg Bachmann, Ländliches wie Galizien für Joseph Roth, die Hügel um Turin für Cesare Pavese, die Karibik Kolumbiens für Gabriel Garciá Marquéz, Sizilien für Tomasi di Lampedusa, Brandenburg für Theodor Fontane oder auch Oberösterreich für Thomas Bernhard. Der Reflexionsgrad als kritischer Filter in bezug auf die jeweilige ›Heimat‹ unterscheidet diese von der traditionellen Heimatliteratur Ganghofers, Roseggers und Waggerls, in welcher Klischees, Vorurteile und Traditionsliebe unreflektiert dargestellt werden.68 Adorno lehnt durch die Erfahrung der Instrumentalisierung dieser Gattung während des Nationalsozialismus die Heimatliteratur als »Brutalität des Rustikalen« strikt ab und fordert die »Emanzipation von der Provinz«.69
Die österreichische Antiheimatliteratur emanzipiert sich von der Provinz, indem sie diese zerstört. Das Genre der Antiheimatliteratur begründet Hans Lebert, indem er Österreich erstmals auf den Begriff bringt – des Dorfes. »Seither tritt uns Österreich in der hausgemachten Literatur der Gattung Anti-Heimatroman im Bilde des bösen Dorfes entgegen.«70 Am Wirtshaustisch des fiktiven Dorfes Schweigen versammeln sich die Landhonoratioren, die in der Parole ›Wir bleiben wir‹ alte Kriegsverbrechen verbergen und gleichzeitig neue Verbrechen begehen. Der Roman markiert die Zäsur der größtenteils restaurativen Literatur der fünfziger Jahre und findet viele Nachahmer, so daß die ›Antiheimatliteratur‹ eine Zeit lang Österreichs neuesten Beitrag zur Weltliteratur darstellt.
Der Begriff der ›Antiheimatliteratur‹ wird für Bernhards literarischen Durchbruch Frost und auf seine in Folge erschienenen Texte verwendet. Bernhard wird damit einer Kategorie zugeordnet, in die er sich selbst nicht eingebunden sah. In einem Interview über zwei der wichtigsten Vertreter der ›Antiheimatliteratur‹, die politisch engagierten Autoren Gernot Wolfgruber und Franz Innerhofer, äußert er sich kritisch: »Die haben es nicht geschafft durchzuhalten. Damit das einen Sinn gehabt hätte, hätten sie mindestens 20 oder 30 Jahre auf ihren Ideen beharren müssen. Doch kaum werden sie beachtet, glauben sie schon Genies zu sein, erscheinen im Fernsehen, und nach kurzer Zeit vergessen sie ihre revolutionären Ideen.«71 Diese Aussage belegt einerseits seine Lektüre der Antiheimatliteraten der späten sechziger und der siebziger Jahre, andererseits distanziert sich Bernhard als außenstehender Kommentator von deren Ideen. Das Bild des negativen und nihilistischen Autors bestimmt noch heute die Rezeption, auch wenn mit dem offensichtlichen Bruch nach Korrektur und vor allem mit der autobiographischen Pentalogie neue Wege und Auswege aus dieser vermeintlichen ›Finsternis‹ aufgezeigt werden. Marcel Reich-Ranicki bezeichnete Bernhard im Jahre 1967, »ob er es will oder nicht, als österreichischen Heimatdichter«, nennt Verstörung einen »Blut-und-Boden-Roman à rebours« und konstatiert: »Aber in der Regel ähneln radikale Anti-Idyllen auf fatale Weise den Idyllen – sofern nämlich, als sie beide von der Wirklichkeit gleich weit entfernt sind.«72 In der Untersuchung zu Bernhards Fortschreibung von Leberts Wolfshaut wird diese Klassifizierung überprüft werden.
Peter Turrini hält die negative Heimatliteratur noch in den achtziger Jahren für die natürliche Reaktion auf die österreichische Nachkriegsgeschichte, denn mehr und mehr Kinder von Bauern, Arbeitern und Kleinbürgern aus der Provinz, verwundet von postfaschistischen Erscheinungen und ständigen Strukturbereinigungen, griffen zur Feder. »Schauen Sie sich doch einmal die Lebensläufe der neueren österreichischen Dichtergeneration an. Mit wenigen Ausnahmen stammten sie vom Lande oder aus Kleinstädten, sind dort verwurzelt und entwurzelt worden, geben Nachrichten aus der Provinz, von der sie, auch wenn sie sich räumlich entfernt haben, ein Leben lang nicht loskommen. Man könnte sie als späte Kinder Peter Roseggers bezeichnen, als verzweifelte und wütend gewordene Heimatdichter.«73
Die Blütezeit der ›Antiheimatliteratur‹ liegt in den sechziger und siebziger Jahren. In den achtziger und neunziger Jahren findet eine differenziertere Auseinandersetzung mit der ›Heimat‹ statt, in der Österreich nicht nur verherrlicht oder geschmäht wird.74 Karl-Markus Gauß hält die Gattung mittlerweile für erstarrt. »Ihr kritischer Impuls ist allerdings mählich erlahmt, und ihr wütender Bezug auf die Sozialstruktur des Landes mutierte zum bloßen Reflex auf literarische Muster, die es einst zu brechen galt – oder die es heute, da die Anti-Heimatliteratur ja längst in ihren eigenen Mustern erstarrt ist, einfach munter weiterzuverwenden gilt […], und darüber ist die Anti-Heimatliteratur vollends zur literarischen Lüge verkommen, ein anspruchslos ins Leere surrender Mechanismus, der heute dem alten Kitsch der Verklärung nur den schwarzen Kitsch der Denunziation entgegenzusetzen weiß; biedermännisch wie jener einst in der Idylle, hat es sich dieser in der literarischen Hölle gemütlich gemacht.«75
Ingeborg Bachmanns Texte sind dem Genre der Antiheimatliteratur fern, wobei in der Erzählung Unter Mördern und Irren der Topos des Stammtisches als Treffpunkt von Kriegsverbrechern aufgegriffen wird. Im Wirtshaus kommen die Ewiggestrigen zusammen, um in Kriegserinnerungen zu schwelgen und ihr erschreckend unreflektiertes Geschichtsbild zu formulieren.76 Der völligen Ablehnung von ›Heimat‹ steht in Bachmanns Werk eine kritisch-distanzierte Hinwendung gegenüber, die über die Vermittlung von Jean Amérys Exilerfahrungen und Heimatverlust in Drei Wege zum See gestaltet wird.
›Heimat‹ ist nicht grundsätzlich gleichzusetzen mit ländlicher Provinz, es kann auch eine Stadt sein oder die Kindheitslandschaft. Eine kritische Heimatliteratur kann die Auseinandersetzung mit der individuellen wie kollektiven Vergangenheit sein. Die Antiheimatliteratur zeigt jedoch keine Wege, sondern zerstört diese.