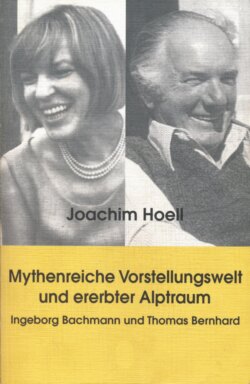Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bachmann, Bernhard und das ›Österreichische‹
ОглавлениеVergessen Sie auch nicht das Gewicht der Geschichte. Die Vergangenheit des Habsburgerreichs prägt uns. Bei mir ist das vielleicht sichtbarer als bei den anderen. Es manifestiert sich in einer Art echter Haßliebe zu Österreich, sie ist letztlich der Schlüssel zu allem, was ich schreibe.106
Thomas Bernhard
Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard gehören zu den bedeutendsten Autoren der Nachkriegszeit in Österreich. In welcher Weise ihr Werk spezifisch ›österreichisch‹ ist, in den ›Habsburgischen Mythos‹ als ›mythenreicher Vorstellungswelt‹ eingebunden ist und sich mit dem Opfermythos als ›ererbtem Alptraum‹ auseinandersetzt, werden die folgenden Einzeluntersuchungen zur Fortschreibung der Werke Joseph Roths, Jean Amérys und Hans Leberts ausführen. Beide Autoren haben sich jedoch wiederholt in ihrem Werk und in Interviews zu Österreich geäußert.
Thomas Bernhards 1966 publizierte Politische Morgenandacht stellt als polemischer Entwurf und Verwurf Österreichs seine dezidierteste Auseinandersetzung mit der habsburgischen Vergangenheit und der österreichischen Gegenwart dar. Kaum einer wisse heute noch von »was für glänzenden, den ganzen Erdball überstrahlenden und erwärmenden Höhen [die österreichische Politik] im Laufe von nur einem einzigen halben Jahrhundert in ihr endgültiges Nichts gestürzt ist. […] Heute, ein halbes Jahrhundert nach der Zertrümmerung des Reiches, ist das Erbe verbraucht, die Erben selbst sind bankrott. […] Ich enthalte mich nicht der Versicherung, daß wir in Österreich von dem ›Begriff Österreich‹ nichts mehr zu hoffen haben. Wir werden aufgehen in einem Europa, das erst in einem anderen Jahrhundert entstehen mag, und wir werden nichts sein. Wir werden nicht über Nacht nichts sein, aber wir werden eines Tages nichts sein. Überhaupt nichts. Und beinahe überhaupt nichts sind wir schon. Ein kartographisches Nichts, ein politisches Nichts. Ein Nichts in Kultur und Kunst.« (PM 11ff.) Diese wohl deutlichste Interpolation von Habsburger Reich und Nachkriegszeit ist Kennzeichen von Bernhards in der altösterreichischen Geschichte angesiedelten Literatur, von dessen Erbe er sich jedoch nicht mehr viel verspricht.107 Die österreichische Geschichte ist scheinbar am Ende und die ruhmvolle Tradition des Landes wirkt übermächtig und blind fort. Diesen Widerspruch verarbeiten Bernhard und Bachmann, wie ihre Reminiszenzen an die österreichische Kulturgeschichte von Haydn, Mozart, Bruckner bis zur Wiener Schule und von Stifter, Hofmannsthal, Rilke, Kafka, Musil bis zu Broch zeigen. Die Polarität von Wirklichkeit und Wirklichkeitsflucht, von Handlung und Handlungsverzicht ist die Spannung, die ihre Figuren gegenüber ihrem Erbe aufreibt.
Daß in Bernhards Werk wiederholt ein Erbe anzutreten ist, das dann verschenkt oder vernichtet wird, und diese Erbschaften Schlösser, Burgen und gewaltige Ländereien umfassen, ist ein Hinweis darauf, wie das habsburgische Erbe auf den Figuren lastet. »Thomas Bernhards Werk ist eine einzige Anstrengung, den Mythos zu liquidieren«108, vermutet Ulrich Greiner. Dieses Erbe ist jedoch infiziert, wie an dem Familienbesitz Wolfsegg in Auslöschung deutlich wird, da es durch die Korrumpierung mit den Nationalsozialisten und durch die dort verübten Verbrechen jäh von der geschichtlichen Tradition Großösterreichs abgetrennt worden ist. Die Gefahr der Nostalgie ergibt sich deswegen kaum, auch wenn die Schönheit österreichischer Landschaft und kultureller Bestände immer wieder betont wird.109 »Österreicher wird man ja nicht in einer Nacht, sondern in einem langen Prozeß, das ist eine Jahrhundertsache und keine von Jahrzehnten. Alles, was wir sind, setzt sich aus den Leuten zusammen, die vor uns waren, in dieser Verschmelzung von Völkern. Österreich war ja immer offen, tatsächlich weltoffen. Und ist es ja heute noch. Der Österreicher sagt zwar, ich bin nur Provinz, aber es ist ja genau das Gegenteil.«110 Dieses weitere deutliche Bekenntnis zur jahrhundertelangen Geschichte Alt-Österreichs demonstriert Bernhards Verwurzeltsein in der Kultur seiner Vorfahren. Eine ›Heimat‹ ergibt sich daraus jedoch nicht mehr, zumindest nicht im Sinne von unbelehrbaren Faustpatrioten. »Folgerichtig intensiviert sich der Zweifel an der Aufmerksamkeit, auch was das geliebte, genauso gehaßte Österreich, das Land meiner Eltern betrifft. Was diesen noch Heimat gewesen war, eine lebenslängliche Glücks- und Schreckensbindung, ist mir ein mehr oder weniger zur Gewohnheit gewordener Geschichtsaufenthalt, geliebte, gehaßte Nähe, von Heimat kann keine Rede sein«111. Bernhard distanziert sich immer wieder von Österreich, das durch seine Geschichte wie auch die Verbindung von Staat und Kirche korrumpiert worden sei.112 Er gibt diesen österreichischen Verhältnissen letzten Endes eine produktive Wendung, da Zorn und Verzweiflung seine einzigen Antriebe zum Schreiben darstellen, und in Österreich habe er den idealen Ort dafür gefunden. »Kennen Sie viele Länder, wo ein Minister sich extra bemüht, um die ›Rückkehr in die Heimat‹ eines SS-Offiziers zu begrüßen, der für den Tod tausender Menschen verantwortlich war?«113 Literarisch zeigt sich diese Hinwendung zu Österreich in den von den Figuren erwähnten kanonisierten Texten. Von herausragender Bedeutung in der Auslöschung sind die österreichischen Dichter der Moderne wie Kafka, Musil und Broch.114
Diese Hinwendung zu Österreich wird von Bachmann ausdrücklicher erklärt. In einem frühen wie in einem späten Interview erläutert sie diese Form von Patriotismus, die sie aus dem gemeinsamen »Sprachklima« (Bachmann, GuI 45) herleitet: »Dichter wie Grillparzer und Hofmannsthal, Rilke und Robert Musil hätten nie Deutsche sein können. Die Österreicher haben an so vielen Kulturen partizipiert und ein anderes Weltgefühl entwickelt als die Deutschen.« (Bachmann, GuI 12) Für Bachmann spielt die durch ihre Herkunft im Dreiländereck Österreich, Slowenien und Italien erfahrene Grenzproblematik, deren Spuren sich durch ihr gesamtes Werk ziehen, eine zentrale Rolle. In Bachmanns Manuskript Biographisches aus dem Jahre 1952, heißt es: »Im Grunde aber beherrscht mich noch immer die mythenreiche Vorstellungswelt meiner Heimat, die ein Stück wenig realisiertes Österreich ist, eine Welt, in der viele Sprachen gesprochen werden und viele Grenzen verlaufen.« (Bachmann 4, 302) Ihre bevorzugten Autoren sind österreichischer Provenienz, die den Konflikt verschiedener Kulturen, Traditionen und Sprachen in sich einschließen. Dies sei auch der wichtige Unterschied zur deutschen Literatur, die homogener als die österreichische ist. Bachmann ist eine Verfechterin des Modells ›Haus Österreich‹, »mit dieser langen und großen Geschichte, mit ihrer Literatur, die für mich immer eine größere Rolle gespielt hat als beispielsweise die deutsche […]. Denn selbst zu deutschen Autoren, vor denen ich Respekt habe, finde ich keine Beziehung. Natürlich aber zu Musil und Kafka, zu Weininger, Freud, Wittgenstein und vielen anderen.« (Bachmann, GuI 79f.)
Bachmann und Bernhard beziehen sich ausdrücklich auf die ruhmvolle Vergangenheit des Habsburger Reiches, in deren Mythos sie sich eingebunden fühlen. Deutsche Autoren haben durch die unterschiedliche Geschichte einen geringeren Einfluß auf beide Autoren. Die Wirklichkeitsflucht wird zugunsten einer konkreten Auseinandersetzung mit den »sozialhistorischen Zusammenhängen« (Bachmann, GuI 133) überwunden, immer mit der Prämisse, daß Dichten nicht außerhalb der geschichtlichen Situation stattfinde (vgl. Bachmann 4, 196). Der Habsburgische Mythos ist beiden Autoren gegenwärtig, die konkrete literarische Auseinandersetzung mit der Geschichte wendet sich jedoch gleichermaßen der Nachkriegsgeschichte und dem Opfermythos zu.
Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard zeigen wesentliche Merkmale des ›Österreichischen‹ in seiner komplexen Heterogenität. Die folgenden Untersuchungen werden diesen Umgang mit ihrer ›Heimat‹ deutlicher hervortreten lassen.