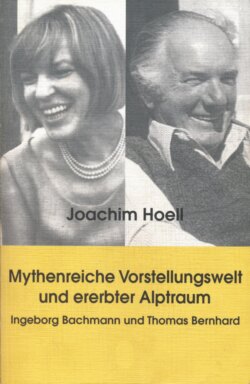Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеGelingen kann dem Dichter, im glücklichsten Fall, zweierlei: zu repräsentieren, seine Zeit zu repräsentieren, und etwas zu präsentieren, für das die Zeit noch nicht gekommen ist. (Bachmann 4, 196)
Der Figur Maria wird in Auslöschung eine Affinität zum Begriff ›Heimat‹ unterstellt. Thomas Bernhard projiziert in seinem großen Österreichroman das ambivalente Verhältnis Muraus zwischen Romliebe und Österreichhaß auf eine zweite Figur, hinter der sich Ingeborg Bachmann verbirgt. Damit wird ein Aspekt in Bachmanns Werk akzentuiert, der zum Zeitpunkt der Niederschrift von Bernhards Roman kaum Beachtung gefunden hatte: das Verhältnis der Autorin Ingeborg Bachmann zu Österreich. Daß Bernhard Murau über Marias Heimatbegriff lachen läßt und das Wort gerade aus ihrem Mund für grotesk hält, deutet die Spannung zwischen den Figuren in diesem Punkt an. Obwohl die Figurenrede zwischen Maria und Murau von dem Verhältnis zwischen Bernhard und Bachmann geschieden werden muß, impliziert diese Passage eine Kritik an Bachmanns Auseinandersetzung mit Österreich und seiner Geschichte. Da in Auslöschung außer dem Hinweis auf Böhmen liegt am Meer kein weiteres Werk Bachmanns explizit genannt wird, bleibt offen, ob sich die Kritik auf die ›geistige Heimat‹ im Gedicht bezieht oder auf andere Texte.
Der Diskurs über Österreich und seine Geschichte zieht sich allerdings durch Bachmanns gesamtes Œuvre, von der frühen Erzählung Das Honditschkreuz, den Gedichten der fünfziger Jahre, dem Erzählband Das dreißigste Jahr bis zu den Todesarten. Eine positive Aneignung der ›Heimat‹ wird ihr in dem letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Text, Drei Wege zum See, unterstellt, in welchem die entschiedenste Auseinandersetzung mit der Habsburger Vergangenheit, dem Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit in Österreich stattfindet. Daß diese Art der Zuwendung an ihre ›Heimat‹ nicht statthaft sei, ist wiederholt vermutet worden; sie verherrliche Österreich und stilisiere es sogar als Opfer Hitlerdeutschlands.
Die angemessene Rezeption des gesamten Simultan-Zyklus ist nicht nur durch Ingeborg Bachmanns vermeintlich diffuses Geschichtsbild erschwert worden, sondern auch durch ästhetische Einwände. Die Kritik ist bei Erscheinen nahezu einmütig von Inhalt und Form des Werkes enttäuscht, da die fünf Erzählungen in ihrem ›Leichtigkeits-Parlando‹ gegenüber dem ein Jahr zuvor veröffentlichen Roman Malina nicht die gehegten Erwartungen an die Autorin erfüllen. Es trifft die Erzählungen wiederholt der Vorwurf der Trivialliteratur, indem die triviale Gedankenwelt der Figuren mit den Intentionen der Autorin gleichgesetzt wird.
Jean Améry hat bereits im Erscheinungsjahr von Simultan gegen die »mit rohem Übelwollen« (Améry, G 201) verfaßten Besprechungen eine prominente Würdigung gesetzt, und zwar in Hinsicht auf die Österreichthematik.