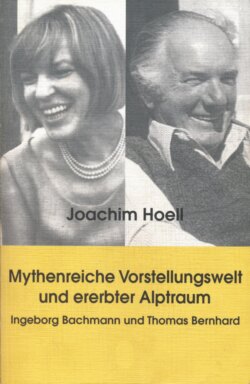Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sozialpartnerschaftliche Ästhetik
ОглавлениеDie Verhältnisse hierzulande sind banausisch, kunstfeindlich und geisttötend.
Karl Kraus
Nach den Erwiderungen auf Greiners und Magris’ Thesen beruhigt sich die Debatte um das ›Österreichische‹. Anfang der neunziger Jahre erscheinen Robert Menasses Essays Die Sozialpartnerschaftliche Ästhetik und Das Land ohne Eigenschaften, in denen der Autor eine Bilanz zu österreichischer Identität und Geist zieht. Die vertretenen Thesen sind nicht grundsätzlich neu, sondern versuchen eine Synthese aus den bislang widerstrebenden Ansätzen zu schaffen. Menasse prägt für diese Vereinigung der Gegensätze den Begriff der ›Sozialpartnerschaftlichen Ästhetik‹.
Die österreichischen ›Sozialpartner‹ sind eine Erfindung der Zweiten Republik und setzen sich paritätisch aus Arbeiter-, Bundeswirtschafts- und Landwirtschaftskammer sowie dem Österreichischen Gewerkschaftsbund zusammen. Als Garant für den sozialen Frieden ist ein Kräftegleichgewicht geschaffen, das immer wieder Kompromisse erzielt. Die Kritik an diesem System besteht gerade in dem ständigen Ausgleich, der nicht progressiv, sondern konservierend auf die Gesellschaft wirke.77
Der Literaturbetrieb sei in die Harmonisierung der Gegensätze ebenso eingebunden, denn »Widersprüche werden gleichsam transzendiert, in der Realität aber nicht angetastet.«78 Daraus sei ein System unbegrenzter Möglichkeiten entstanden, in dem Revolution und Konservatismus nebeneinander stehen, ohne sich gegenseitig zu behelligen. Damit werde das von Magris als ›Habsburgischer Mythos‹ gekennzeichnete Klima der Harmonie, das schon im alten Österreich bestimmend gewesen sei, wieder aufgegriffen. Allerdings werden in der geschaffenen Scheinharmonie die bestehenden Gegensätze nicht aufgehoben: »Die Ambivalenz jenes Endzeitzustandes der Sozialpartnerschaft, dieses bürgerlichen Geschichtszieles, das die totale Harmonie durchsetzt, ohne die Konfliktursachen zu beseitigen«79, sei ein künstliches Paradies »institutionalisierter Konfliktharmonisierung«80. Dies führe zu einem Stillstand der Geschichte, und in den Romanen Handkes und Bernhards erkennt Menasse daher »grundsätzlich keine Konkretisierung des historischen Moments«81, und Gernot Wolfgrubers Figuren scheitern nicht prinzipiell, sondern an »diesen in Österreich so elastisch versteinerten Verhältnissen«82.
In dem zwei Jahre später erschienenen Essay Das Land ohne Eigenschaften führt Menasse diese Thesen fort: »Österreich hat sich von seiner Geschichte abgeschottet und versucht dennoch von seiner Musealität zu leben.«83 Die heutige österreichische Realität zeige eine deutliche Parallele zu dem Österreich, das Musil im Mann ohne Eigenschaften beschrieben hat: »Wieder leben wir in einer Endzeit.«84 Die österreichische Neutralität sei zu einem Mythos geworden, und daher sei es kein Zufall, daß in Österreich mit der sogenannten ›Antiheimatliteratur‹ eine im internationalen Vergleich völlig eigenständige, neue literarische Gattung entstanden ist, denn »Österreich ist die Anti-Heimat par excellence.«85 Die Literatur, die sich mit dem Desaster der Provinz beschäftigt, sei daher das Beste, was die Zweite Republik hervorgebracht habe. Menasse verweist auf die Romane Hans Leberts und Gerhard Fritschs wie auf ihre Nachfolger.86
So wie Magris die Mythologisierer der Zwischenkriegszeit mythologisiert, synthetisiert Menasse die Synthetisierer der Nachkriegszeit. Die bisherigen Versuche zur Bestimmung des ›Österreichischen‹ erhalten jeweils ihre Berechtigung, indem das Gegensätzliche und Unbestimmbare den ›Geist‹ und die ›Identität‹ der österreichischen Gesellschaft und Literatur bedeute. Die Harmonisierung der im ›Habsburgischen Mythos‹ verwurzelten Autoren und der von Greiner unterstellte Eskapismus für die Autoren der siebziger Jahre wird von Menasse nicht widerlegt, sondern erklärt und begründet. Deutlich wird bei diesem erneuten Bestimmungsversuch, daß sich die österreichische Literatur einer klaren Kategorisierung entzieht, beziehungsweise daß sie darin ihr Wesen zu haben scheint. Das ›Österreichische‹ näherte sich auf dieser Weise dem Zeitgeist der Postmoderne an, für den auch die Geschichte nur noch aus Versatzstücken besteht, die beliebig zusammengefügt werden können.