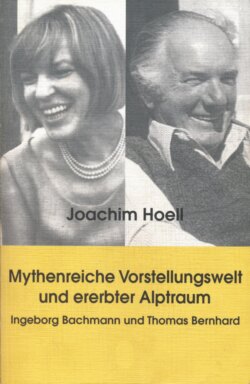Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nationalliteratur in der Postmoderne
ОглавлениеIn der Welt von heute ist das Problem der nationalen Identität besonders akut. […] Wir müssen begreifen, daß die Welt zwar voller Widersprüche steckt, aber dennoch eine einzige Welt ist – und Nationen macht das nervös. Sie fürchten, ihre Kultur zu verlieren, ihre Sprache und ihre Lebensweise. […] Globalisierung darf allerdings keine Dampfwalze sein, die in der ganzen Welt völlige Gleichförmigkeit schafft und die Vielfalt der Kulturen außer acht läßt. Deshalb müssen […] wir einen politischen Mechanismus finden, um diese beiden Tendenzen miteinander zu versöhnen.87
Michail Gorbatschow
Anläßlich der Frankfurter Buchmesse mit ihrem literarischen Schwerpunktland Österreich sind eine Fülle an Meinungen und Positionen seitens österreichischer und deutscher Kritiker zum Wesen des ›Österreichischen‹ publiziert worden. Im Sinne von Magris und Menasse wird das Heterogene zum eigentlichen Bestimmungsfaktor. Eine Bündelung der wiederkehrenden Thesen soll den Ausblick auf das ›Österreichische‹ im Werk Ingeborg Bachmanns und Thomas Bernhards geben.
Das habsburgische Erbe wirkt weiterhin in der österreichischen Literatur fort. Strukturen wie der übermächtige Beamtenapparat, der Ordnungsglaube88, das kuriose Titel- und Formelunwesen, mangelnder Widerspruchsgeist, lächelnde Heuchelei seien allesamt Atavismen des behäbigen Habsburgertums. Der ›Habsburgische Mythos‹ sei »wie eine Art Ödipuskomplex«89. In diesem Kontext spricht Leo Federmair auch von den verbindenden formalen Gesichtspunkten: »Demnach sind ihre Hauptcharakteristika das Barocke, Verspielte, Manieristische, eher Sinnliche als Intellektuelle.«90
Raoul Schrott hält die Österreicher weiterhin für »servil, ein Erbe kaiserlicher und königlicher Monarchien, das zur hohen Kunst des Hofnarrentums« neige, »dessen morbider Charakter sich in den Kaffeehäusern offenbar[e], in der hohen Kunst des Nörgelns«91. Aus Ahnen und Erleben des Zerfalls von einem Großreich, das Österreich einmal als Monarchie der Habsburger jahrhundertelang war, und aus dessen »Zerbröselung aus sich selber, mündend in den Kopfsturz des Selbstmords«92, seien all die Ängste und Schwächen entstanden. Für Günther Nenning ist »die geheimnisvoll fortdauernde altösterreichische Grundlage der österreichischen Literatur […] viel müheloser multikulturell als die deutsche. Insofern (dank des verschollenen Vielvölkergedränges) ist die österreichische Literatur nichtdeutsch. Die deutsche Literatur ist ethnisch reiner – und insofern bornierter, provinzieller als österreichische Literaturprovinz.«93 Darin sieht Barbara Frischmuth gerade die große Chance Österreichs, weil die meisten anderen Nationen einen viel starreren Nationenbegriff haben und es schwerer mit der notwendigen Modernisierung haben.94 Der ›Habsburgische Mythos‹ wird von diesen Autoren – trotz seiner Nachteile95 – als multinationale, multikulturelle und multilinguale Tradition geschätzt, die es in der Moderne zu nutzen gilt. Dieses Erbe muß allerdings sensibel verwaltet werden, damit daraus keine ideologisch gefährliche Nationalliteratur entsteht, die bereits im 19. Jahrhundert und dann im Nationalsozialismus korrumpiert war.96 Auch die österreichische Nachkriegsgeschichte zeige, wie leicht es sich die Mehrheit der Österreicher gemacht habe, sich nur in die Geschichte zurückzuwenden und dabei die drängende Gegenwart zu vermeiden.97
Der zweite Mythos besteht in dem Herunterspielen und Verfälschen der Rolle Österreichs im Nationalsozialismus gegenüber der Weltöffentlichkeit, wobei für eine Vielzahl von Österreichern, für die das Jahr 1945 subjektiv nicht Befreiung, sondern Niederlage bedeutete hatte, Konzession um Konzession gemacht werden mußte.98 Diese Kontinuität gilt es zu bekämpfen, da sich Österreich wieder von rechten Kräften bedroht fühlt: »es ist traurig, dass die ›volksseele‹ der österreicher zum faschismus tendiert.«99
Wendelin Schmidt-Dengler konstatiert weiterhin zwei einander schroff gegenüberstehende Positionen in der österreichischen Nachkriegsliteratur: »eine Position der Ordnung und eine der Anarchie.«100 These steht gegen These: Austriakischer Triumphalismus gegen ständige Selbstzweifel, permanente Unschuldsbeteuerungen gegen ständige Selbstbekenntnisse. Diese Mehrsinnigkeit leite sich schon von Freud und Schönberg als entscheidende Etappen in der Bewußtseinsbildung her, nämlich deren Eintritt in die Selbstreflexion.101
Letztendlich vermögen die das ›Österreichische‹ konstituierenden Merkmale »die großen Probleme und großen Krisen des zeitgenössischen westlichen Bewußtseins mit außergewöhnlicher Luzidität auszudrücken.«102 Ingeborg Bachmann sieht Österreich durch seine Geschichte als Nukleus für weltweite Prozesse: »Man kann von diesem kleinen, verwesten Land aus Phänomene viel genauer sehen, die man in den großen, verblendeten Ländern nicht sieht.« (Bachmann, GuI 80) Damit näherte sich die mikroskopische Untersuchung österreichischer Literatur globaleren Zusammenhängen und Problemen der Moderne wie Fortschritt versus Tradition, politische Gemeinschaft versus kulturelle Verschiedenheit, Geschichtsbewältigung versus Geschichtsklitterung, künstlerische Utopie versus vollständige Resignation.
Anton Pelinka stellt für das Österreichbild die Synthese her, daß jeder seine eigene Wahrheit behalten dürfe. »Österreich ist nicht gleich Österreich, die Wirklichkeit dieses Landes widerspricht seiner Wirklichkeit. […] Aber eben weil Österreich immer wieder neu und im Widerspruch erfunden wird, gibt es keinen Stillstand – Österreich ist nicht zu Ende.«103 Peter Wapnewski verweist auf das gemeinsame Erbe des ›morbus austriacus‹, das die österreichischen Autoren dieses Jahrhunderts miteinander verbinde: »Denn was immer sie trennen mag, was immer sie unterscheiden mag von sozialer und geographischer und religiöser Abstammung her: sie alle tragen als Erbe den morbus austriacus in sich, die Last großer Schwermut und schmerzlicher Trauer, die Unlust, an der Lust des Lebens anders teilzunehmen als in spielerischem Spott, in sanfter Wehmut oder bitterem Hohn«.104
In welcher Weise Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard von diesem ›morbus austriacus‹ befallen sind, den Jean Améry im Werk beider Autoren erkennt105, sollen die folgenden Ausführungen zum Verhältnis Österreichs zeigen.