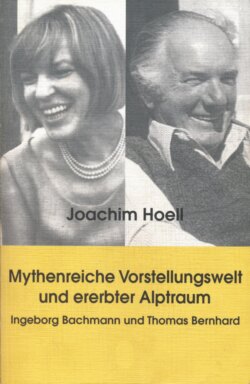Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Habsburgischer Mythos
ОглавлениеGenau genommen regierte Kaiser Franz Joseph bis zum Tode von Johann Strauß.
Österreichisches Sprichwort
Claudio Magris’ Abhandlung über den Habsburgischen Mythos ist das klassische Werk zur österreichischen Literatur. Die von Grillparzer bis Doderer reichende Definition des ›Österreichischen‹ aus der Perspektive der k.u.k.-Geschichte stellt noch heute die umfassendste Abhandlung zu einem Jahrhundert österreichischer Literatur dar. Auch wenn die Studie gerade mit dem Beginn des künstlerischen Schaffens von Bachmann und Bernhard endet, weisen ihre Werke auf die Prägung durch die glanzvolle Vergangenheit des Habsburger Reiches hin.
Die Heraufkunft des ›Habsburgischen Mythos‹ sei eng verbunden mit der Regentschaft Kaiser Franz Josephs, in der sich eine »grandios-statische«19 Atmosphäre ausbildete. Sein Regierungsantritt im Jahre 1848, direkt nach Niederschlagung der Revolution, markiere den Beginn einer restaurativen Ära, die auch den Immobilismus und das Apolitische österreichischer Schriftsteller begünstigt habe: »[…] die regungslose Abwehrstellung gegen jede Bewegung, die wachsame und doch kurzsichtige Beobachtung all dessen, was ringsum brodelte, ein in seiner pedantischen Ohnmacht heroischer Wächterdienst zur Abwehr aller Übel«20. Diese Handlungsunfähigkeit werde im ›Operettenstaat‹ des letzten Habsburgerkaisers allmählich zur »Flucht aus der politischen Wirklichkeit«21 bis hin zur »Auflösung der Wirklichkeit«22.
Der ›Habsburgische Mythos‹, der sich durch ein Jahrhundert österreichische Literatur ziehe, finde seine deutlichste Ausprägung bei Autoren der Zwischenkriegszeit – Zweig, Werfel, Roth, Csokor, Kraus, Musil, Doderer –, die »keine äußerliche thematische Verwandtschaft auf der Grundlage äußerer Kriterien, wie gemeinsamer Motive und Inhalte ihrer Werke«, eint, sondern die sich vielmehr in »einen ganz bestimmten kulturellen Humus«23 überträgt. Diese Gemeinsamkeit liege seit Grillparzer in dem Bemühen, für ein immer problematischer werdendes Staatsgefüge Existenzgründe zu finden und auf solche Weise von der konkreten Wahrnehmung der Wirklichkeit abzulenken. »Auch als boshafte Kritiker bleiben sie Gefangene dieser märchenhaften und schwärmerischen Verwandlung der Welt der Donaumonarchie, dieser suggestiven Verfremdung, die mehr als ein Jahrhundert eines der hervorstechendsten Merkmale […] der österreichischen Humanitas und darüber hinaus ein scharfes Machtinstrument und eine geistige Stütze des Habsburgerreiches war.«24
Mit Zerfall des k.u.k.-Staates bilde sich immer stärker der ›Habsburgische Mythos‹ heraus, der die reale Monarchie ins Utopische überhöhe. »Die Themen und Motive der Erinnerung der Monarchie entstehen also nicht mit den modernen Autoren, sondern knüpfen an eine besondere Tradition an.«25 Der Immobilismus bringe in der achtundsechzig Jahre währenden lähmenden Monarchie drei Grundmotive Habsburgischer Literatur hervor: Übernationalisierung, Bürokratentum und Hedonismus. »Das übernationale Ideal, das noch in der väterlich-strengen Anfangswendung der Proklamationen Franz Josefs ›An meine Völker‹ Ausdruck findet, war das ideologische Fundament der Donaumonarchie, ihre geistige und propagandistische Stütze im Kampfe gegen das moderne Erwachen der nationalen Kräfte, kurz, eine Waffe des habsburgischen Kampfes gegen die Geschichte.«26 Eng verknüpft mit dem bürokratischen Thema sei Franz Joseph, und zwar in der »Verlagerung der bürokratischen Mentalität auf die Gefühls- und Gewohnheitsatmosphäre«27. Joseph Roths Trotta-Figur in Radetzkymarsch sei die Verkörperung dieses Typus: »Der dieser Gestalt zugrunde liegende politische Immobilismus überträgt sich auf menschliche Nuancierungen: das reife Alter – das bevorzugte Lebensalter für die Personen der österreichischen Literatur –, die methodische und skrupellose Pedanterie, die fast religiöse Aufopferung der eigenen Person zugunsten der formalen Ordnung«28. Sprichwörtlich fand das übermächtige Beamtentum des Habsburgerreiches Eingang in den Volksmund, »Zittre, du großes Österreich,/ vor deinen kleinen Beamten!«29 und von Franz Joseph ist der Satz überliefert: »Ich brauche keine Gelehrten, nur gute Beamte.«30 Drittes Grundmotiv sei »der Mythos der Walzers und der Lebensfreude, der überschäumenden Sinnenfreudigkeit und des leichtsinnigen Vergnügens; […] Mythos der schönen blauen Donau und des Wiener Bluts«31.
Die erste große Dichterpersönlichkeit, die eine vollständige und einheitliche Synthese der habsburgischen Welt darstelle, sei Grillparzer, dessen Werk »den habsburgischen Mythos in seiner ganzen Vollendung und Tragik«32 verkörpere. In Adalbert Stifters Romantitel Der Nachsommer scheint bereits die Bezeichnung und das Gefühl des »alternden Menschen und der versinkenden Glut [auf]. ›Dieses herbstliche Lebensgefühl‹ kennzeichne in vielfacher Abwandlung die ganze österreichische Dichtung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts«33. Nestroys Theater sei ein Spiegel der gesamten habsburgischen Gesellschaft, »der Absolutismus tritt als ›Tyrannerl‹ auf, die Erhebung als ›Revolutionerl … und Freiherterl‹«34.
In der sogenannten Dekadenzliteratur der Jahrhundertwende nehme dieses habsburgische Bewußtsein zu, da der Vielvölkerstaat mit seinen diversen Sprachen, dem Verlust eines katholischen Weltbildes und der sich anbahnenden Auflösung einer festen Weltordnung den Verfall der Monarchie antizipiere. Selbst Karl Kraus, der Österreich als ›Versuchsstation für Weltuntergang‹ bezeichnete, sei – ex negativo – eingebunden in diesen Mythos: »Mit Karl Kraus scheint der Mythos der Donaumonarchie völlig zertrümmert zu werden. Freilich handelt es sich um eine radikale Entmythisierung und Überwindung, doch wird sie als Apokalypse und Katastrophe dargestellt. Vielleicht hat die habsburgische Welt in diesem Freund-Feind einen ihrer tragischsten, erhabensten Sprecher gefunden.«35
Die deutschsprachigen Autoren Prags wie Kafka, Rilke und Werfel offenbarten bereits die Krise der habsburgischen Kultur, da sie in diese Auflösungsstrukturen noch intensiver eingebunden seien. Roth und Musil seien die größten Beschwörer des habsburgischen Mythos in ihrem kurz nach dem Untergang der Monarchie entstandenen Werk. Der Mann ohne Eigenschaften zeige zwar die Auflösung der europäischen Ordnung und Kultur, doch besonders deutlich werde in diesem Roman »die Austriazität als geistige Konstante Musilscher Kunst und Persönlichkeit«36, und im Werk Joseph Roths finde »die Nachkriegssaga ihre genaueste und erschütterndste Darstellung«37.
Der ›Habsburgische Mythos‹ überlebe »mit seinem doppeltem, zugleich in erschöpften Erinnerungen verharrenden und stets neuen künstlerischen Möglichkeiten aufgeschlossenen Aspekt, manchmal als drückende Last, dann wieder als fruchtbarer dichterischer Ausgangspunkt.«38 ›Mythenreiche Vorstellungswelt‹ und ›ererbter Alptraum‹ sind auch die zwei Pole der Bachmannschen und Bernhardschen Rezeption der österreichischen Kultur und Literatur: der Doppeladler als Symbol zweier sich widerstrebender und dennoch sich ständig anregender Antinomien.