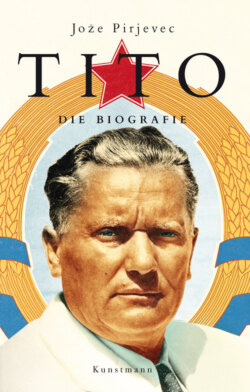Читать книгу Tito - Joze Pirjevec - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ANFÄNGE DER PARTEITÄTIGKEIT
ОглавлениеZuhause erfuhr Josip Broz, dass seine Mutter zwei Jahre zuvor an der Spanischen Grippe gestorben war. Er selbst bezeichnete diesen Tag als den »schmerzlichsten meines Lebens«.34
In der Heimat fand er völlig veränderte politische und soziale Verhältnisse vor – die Habsburger Monarchie gab es nicht mehr, und die Leerstelle, die dieses Jahrhunderte alte Staatsgebilde hinterlassen hatte, wurde von einer seltsamen Chimäre ausgefüllt: dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, in dem sich unter dem Zepter der Karađorđevićs Südslawen aus dem mitteleuropäischen und dem levantinischen Kultur- und Geschichtskreis zusammengeschlossen hatten. Außer den drei ethnischen Hauptgruppen sowie den Mazedoniern, Montenegrinern und muslimischen Bosniern, denen Belgrad nicht den Status selbstständiger Nationen zuerkannte, lebten in diesem Staat noch mindestens siebzehn Minderheiten (Albaner, Ungarn, Deutsche und andere), was ihm den Charakter des vielfältigsten Staates Europas verlieh. Achtzig Prozent der Bevölkerung lebte auf dem Lande, wo sich seit der osmanischen Herrschaft nicht viel verändert hatte – wenn die Verhältnisse aufgrund des entsetzlichen Elends, das der Krieg verursacht hatte, nicht noch schlechter waren.35
Es zeigte sich bald, dass sich über eine so buntgemischte und potenziell zum Umsturz neigende Gesellschaft nur mit harter Hand herrschen ließ. So erließ die Belgrader Regierung schon Ende Dezember 1920 ein Staatsschutzgesetz (die sogenannten Obznana), mit dem die gerade gegründete Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ) verboten und in die Illegalität getrieben wurde. Die Partei, die ihre Wurzeln in den sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien der Vorkriegszeit mit jeweils unterschiedlicher Tradition und Kultur hatte, wurde dadurch natürlich stark geschwächt: Von den 65 000 Mitgliedern, die sie 1920 zählte, schrumpfte sie bis 1924 auf 688 Mitglieder.36 Josip Broz schloss sich der Partei zwar an, trat aber in den wüsten Fraktionskämpfen zwischen den Führern der KPJ, diesen Generälen ohne Armee, politisch nicht hervor.
Er engagierte sich stattdessen in Gewerkschaften, auf die die Kommunisten starken Einfluss hatten. Doch auch diese Aktivitäten sorgten dafür, dass er schikaniert, aus dem Dienst entlassen, ins Gefängnis geworfen und dort misshandelt wurde.37 Wie schon vor dem Krieg hielt er es nie lange an einem Arbeitsplatz aus: Er arbeitete in Zagreb, in Bjelovar, auf einer Werft in Kraljevica, in Veliko Trojstvo und in einer Waggon-Fabrik in Smederevska Palanka. Für kurze Zeit kehrte er auch in seinen ersten Beruf zurück und arbeitete als Kellner, wurde jedoch bald entlassen, weil er unter den Kollegen einen Streik organisiert hatte.38
1926 wollte er sich in Belgrad einer der lokalen Parteizellen anschließen. Aber die rechtsgerichtete Fraktion, die in der Stadt an der Macht war, wollte ihn nicht aufnehmen, weil ihre Führer der Meinung waren, er gehöre weder zu ihnen noch zu den Linken. »Dieser Fraktionismus erreichte ein solches Ausmaß, dass es für anständige Kommunisten unmöglich wurde, den Parteiorganisationen beizutreten. Nur damit die Führer ihre Stellung sichern konnten […], denn sie bekamen Unterstützung von der Komintern. Das heißt, nicht nur Unterstützung, sondern vielmehr ein monatliches Gehalt […], deutlich höher als das hoher Beamter. […] Auch das bewog mich neben anderen Erkenntnissen, den Kampf gegen den Fraktionismus aufzunehmen.«39 Zurück in Zagreb begann Broz 1927 als Sekretär des Bundes der kroatischen Metall- und Lederarbeiter und später als Sekretär des Stadtkomitees der KP mit der Agitationsarbeit, wobei er sich sowohl der linken als auch der rechten Fraktion widersetzte. Erstere betonte das föderalistische, Letztere das zentralistische Konzept der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, worin natürlich auch die unterschiedliche politische Kultur Belgrads und Zagrebs zum Ausdruck kam. Wie Miroslav Krleža später festhielt, »drehte sich die Diskussion in einem Teufelskreis nach dem Motto: ›ohne vollständige Demokratie keine Lösung der nationalen Frage‹ bzw. ›ohne Lösung der nationalen Frage keine vollständige Demokratie‹«.40
Da sie von Mitte der Zwanziger bis Mitte der Dreißiger im Königreich SHS, »diesem künstlichen Versailler Gebilde«, nur ein mögliches Sprungbrett der imperialistischen Mächte zum Angriff auf die Sowjetunion sah, sprach sich das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationalen (EKKI), jene Organisation, die alle kommunistischen Parteien der Welt miteinander verband und sie Moskau unterordnete, für die Zerstückelung des Staatsgebildes und die Gründung einer Föderation sozialistischer Republiken auf dem Balkan aus. In einer im Frühjahr 1925 veröffentlichten Resolution einer Sonderkommission der Komintern heißt es in einer Anweisung an die KPJ: »Die Partei muss mit einem Höchstmaß an Propaganda und Agitation die werktätigen Massen in Jugoslawien davon überzeugen, dass der Zerfall eines solchen Staates der einzige Weg zur Lösung der nationalen Frage ist. […] Solange Jugoslawien nicht untergegangen ist, ist eine ernsthafte kommunistische Aktivität nicht möglich. Wir müssen folglich Jugoslawien mit Unterstützung der separatistischen Bewegungen im Lande zerschlagen.«41 Deshalb griff die Komintern die rechte Fraktion und ihren Führer, den Serben Sima Marković, Sekretär der KPJ, scharf an. Marković lehnte das leninistische Prinzip der Selbstbestimmung der Völker ab, wurde dafür von Stalin höchstpersönlich kritisiert und 1929 aus der Partei ausgeschlossen. Gleichzeitig nahm die Komintern auch gegenüber der von Rajko Ivanović geführten linken Fraktion eine kritische Haltung ein. Die hatte unter anderem behauptet, die Bauern seien ihrer Natur nach unweigerlich Verbündete der Bourgeoisie, nicht aber der Arbeiterklasse. 1928 charakterisierte das Provisorische Exekutivkomitee der Komintern in einem offenen Brief an die Mitglieder der KPJ den Konflikt zwischen beiden Gruppen folgendermaßen: »Die lebenswichtigen Fragen des proletarischen Kampfes wurden an die letzte Stelle gedrängt, während die scholastische Kasuistik, die das fraktionistische Gezänk nur noch schürte, an die erste Stelle gerückt war.«42
Schließlich schien sich die »Zagreber Linie« durchzusetzen. Diese forderte eine Überwindung des Fraktionen-Streits und dass die Intellektuellen an der Parteispitze durch Arbeiter ersetzt werden müssten. »Wir suchten«, erinnerte sich Tito, »einen Ausweg aus der schwierigen Situation, in der sich die kommunistische Bewegung Jugoslawiens befand. Wir kamen zu der Erkenntnis, dass wir als Erstes die Partei gesundmachen und ihre Einheit erkämpfen mussten.« Dieser Kampf war nicht ohne Wagnis, denn die Führung der KPJ war gern bereit, gegen Kritiker schwerste Sanktionen zu verhängen und sie als parteifeindliche Elemente abzustempeln.43
Ohne selbst Position zu beziehen stellte Josip Broz fest, dass der langjährige interne Kampf die Parteiführung gelähmt und jede wirklich revolutionäre Aktion verhindert habe, und mithilfe von Andrija Hebrang gelang es ihm 1928 auf der VIII. Konferenz Ende Februar das Sekretariat des Zagreber Stadtkomitees zu übernehmen, wenngleich manche aufgrund seiner mangelnden Bildung Zweifel an seiner Eignung hatten. Eigentlich war Hebrang für diese Position vorgesehen, dieser hatte aber zugunsten von Broz verzichtet, da er der Meinung war, dass der Sekretär ein Proletarier sein müsse, während er selbst Bankbeamter war. Es handelte sich um die zahlenmäßig stärkste kommunistische Organisation im Königreich Jugoslawien mit ungefähr 180 Mitgliedern, und zwei Monate später wurde sein Standpunkt in einem offenen Brief auch von der Komintern bestätigt: »Die Auftritte in der Organisation der Stadt Zagreb zeigen, dass die KPJ eine gesunde Mitgliederbasis hat, die mit fester Arbeiterhand in der Partei für Ordnung zu sorgen versteht.« Diese »bolschewistische« Ausrichtung, die der Partei eine innere Kohäsion leninistischen Typs geben, sie vom »Alptraum des Fraktionismus« befreien und sich der Arbeit unter den Massen44 widmen wollte, konnte sich in den folgenden Jahren zwar nicht durchsetzen, lenkte jedoch die Aufmerksamkeit auf Broz und Hebrang, allerdings auch die der Polizei.45 »Genosse Georgijević«, wie Broz damals in der Partei hieß, war bereits 1927 wegen revolutionärer Tätigkeit zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt worden, am 1. Mai 1928 wurde er erneut verhaftet wegen der Ausschreitungen, die die Kommunisten im Kino Apollo gegen eine Versammlung der städtischen Sozialistischen Partei organisiert hatten. Unter den Störenfrieden, die während der Festveranstaltung »Nieder mit den Sozialpatrioten! Nieder mit den Dienern der Kapitalisten!« schrien und sich mit den Versammelten prügelten, befand sich auch Broz. Man verhaftete ihn und verurteilte ihn gemeinsam mit den Genossen zu vierzehn Tagen Gefängnis. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Personenbeschreibung angefertigt, in der es heißt, dass er 170 cm groß sei, graue Augen habe, dass ihm Zähne fehlten, dass er aufgrund von Kurzsichtigkeit ständig eine Brille trage und bisher unbescholten sei.46 Offenbar wusste man auf der Polizeiwache nicht, mit wem man es zu tun hatte. Im Juli und August des folgenden Jahres wurde er erneut verhaftet, diesmal unter der Anschuldigung, einen Aufstand organisiert zu haben, der das verhasste Regime der Karađorđevićs stürzen sollte. In Zagreb brachen tatsächlich Streiks, Massendemonstrationen und Unruhen aus, die auch mehrere Todesopfer forderten.47
Der Augenblick für eine Revolution schien äußerst günstig, denn am 20. Juni 1928 war es im Belgrader Parlament zu einem Attentat gekommen, dem mehrere kroatische oppositionelle Abgeordnete zum Opfer gefallen waren. Der Attentäter war Puniša Račić, ein montenegrinisches Mitglied der regierenden Radikalen Partei, das in den Vertretern der Kroatischen Bauernpartei (HSS) Todfeinde eines geeinten und streng zentralisierten Staates sah. Unter seinen Opfern war auch der charismatische Führer der Partei Stjepan Radić, der Ende August nach mehreren qualvollen Wochen seinen Wunden erlag. Diesen Krisenmoment wählte die KPJ gemäß den Anweisungen der Komintern für eine Aktion: Ihre Führer, die keinen Rückhalt in den Massen hatten, unternahmen sie mit dem ganzen Enthusiasmus ihrer Unerfahrenheit.48 Doch infolge eines Verrats aus den eigenen Reihen war die Gendarmerie schneller. Fünf Tage vor Radićs Tod lauerten zwei Gendarme Broz auf und nahmen ihn fest. »Hätte ich nur ein Prozent Möglichkeit gehabt«, erzählte er später einem Freund, »wäre ich geflüchtet und hätte geschossen.« Bei Broz fand man am 4. August 1928 eine geladene Browning, für die er keinen Waffenschein besaß; in seiner konspirativen Wohnung entdeckte man – neben marxistischer Literatur – unter dem Bett auch einen Korb mit Munition und vier deutsche Handgranaten aus dem Ersten Weltkrieg (später behauptete er zu seiner Verteidigung, man habe sie ihm untergeschoben, was aber nicht der Wahrheit entsprach).49 Man sperrte ihn ein, prügelte ihn und verlangte von ihm, dass er gegen seine Genossen aussagte. Dem verweigerte er sich und trat stattdessen wie auch bei seinem letzten Gefängnisbesuch in einen Hungerstreik. Sein Brief aus dem Gefängnis, in dem er seine Haft-»Qualen« übertrieben schilderte, wurde am 24. August 1928 von dem Organ der Komintern Internationale Presse Korrespondenz unter dem Titel Ein Schrei aus der Hölle der jugoslawischen Kerker veröffentlicht.50
Anfang November stand er vor Gericht, das ihn in einem aufsehenerregenden, effekthascherisch als »Bombenleger-Affäre« bezeichneten Prozess am 14. November 1928 auf der Grundlage des Staatsschutzgesetzes, das »jede kommunistische Propaganda« verbot, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilte. Bei der Verhandlung verhielt er sich so, wie es die Komintern den Kommunisten für solche Gelegenheiten vorschrieb: »Habe nur eines vor Augen. Nicht dass deine Strafe möglichst gering ausfällt, sondern dass du mit deinem Verhalten das Ansehen der Partei in den Augen der werktätigen Massen hebst.«51 Gemäß dieser Anweisung erklärte Broz, er fühle sich nicht schuldig und erkenne das »bourgeoise « Gericht, das die reaktionären Kräfte repräsentiere, nicht an. »Es lebe die Kommunistische Partei! Es lebe die Weltrevolution!«52 Und tatsächlich wurde diese Haltung von den Zeitungen vermerkt und auch in Moskau registriert.53 August Cesarec, einer der führenden linken Intellektuellen in Kroatien, schrieb kurz darauf in der illegalen Zeitung Proleter: »Sollte dieser junge und krankhaft ambitiöse Kommunist an die Spitze der KPJ gelangen, wird das eine Tragödie für die Partei.«54
Nach dem Urteil blieb Broz noch einige Tage in den Zagreber Gefängnissen: die Genossen versuchten ihn zu befreien, indem sie mithilfe eines sympathisierenden Wächters eine in einem Brotlaib versteckte Säge in die Zelle schmuggelten. Mit ihr durchsägte Broz fünf der sechs Eisenstangen am Fenster seiner Zelle, ohne dass das jemand bemerkt hätte. Doch bevor er die sechste in Angriff nehmen konnte, wurde er zuerst in eine andere Zelle und kurz darauf nach Lepoglava im kroatischen Zagorje verlegt, wo sich seit 1854 die wichtigste Strafanstalt der Banschaft befand. Der Wächter, der ihm geholfen hatte, geriet bei den Behörden in Verdacht und flüchtete mithilfe der Kommunistischen Partei in die Sowjetunion. Einige Jahre später verdächtigten ihn die Sowjets, ein Agent der jugoslawischen Polizei zu sein und verurteilten ihn zum Tode.55 Unter den Kommunisten, mit denen Broz in Lepoglava und Maribor (Letzteres stand in dem Ruf, »Aleksandars schlimmstes Gefängnis« zu sein) einsaß, erwarb sich Broz rasch Respekt. Vor allem durch sein aufrechtes Verhalten und durch die Disziplin, mit der er sich den Studien des Marxismus-Leninismus widmete. Durch Hungerstreiks hatten die Kommunisten nämlich erstritten, dass sie in Gemeinschaftszellen untergebracht waren, was ihnen die Möglichkeit gab, »den Kerker zur Schule zu machen«. Die benötigte Literatur schmuggelten sie ins Gefängnis. So begann sich in diesem und in anderen Strafanstalten eine neue Generation von politischen Führern herauszubilden – Josip Broz, Moša Pijade, Andrija Hebrang, Aleksandar Ranković, Milovan Đilas –, die sich intensiv marxistisch schulten, sich aber auch mit praktischen Fragen auseinandersetzten, etwa mit Militärtaktik.56 In den Jahren der Gefangenschaft – an die er sich gern mit lockerem Witz erinnerte57 – wurde Broz zum Berufsrevolutionär, wie man im Gefängnis von Maribor richtigerweise bemerkte. Dort schrieb man in seinen Personalbogen unter der Rubrik Fachausbildung (Spezialgebiet): »verbrecherisch: Kommunist«.58
Trotz aller Widrigkeiten hat das Gefängnis Josip Broz wahrscheinlich das Leben gerettet. Nur wenige Wochen nach seiner Verurteilung, am 6. Januar 1929, löste König Aleksandar das Parlament auf, hob die sogenannte Vidovdan-Verfassung aus dem Jahr 1921 auf und führte ein diktatorisches Regime ein, an dessen Spitze er General Petar Živković einsetzte. Der König und sein Premierminister verboten alle Parteien und kündigten einen unerbittlichen Kampf gegen alle oppositionellen Kräfte an: von den Kosovo-Albanern bis zu den mazedonischen Separatisten, von den kroatischen Nationalisten – den gemäßigten wie den radikalen (Ustascha) – bis hin zu den Kommunisten. Zwischen 1929 und 1931 landeten an die zehntausend Linke und andere Angehörige der Opposition in den verschiedenen Polizeigefängnissen. An die hundert KPJ-Mitglieder wurden allein in der Belgrader »Glavnjača« zu Tode gequält.
Nachdem er seine Haftstrafe verbüßt hatte, kehrte der zweiundvierzigjährige Josip Broz im März 1934 ins heimatliche Kumrovec zurück, wie es das Gesetz für ehemalige Häftlinge vorschrieb. Jedoch nahm er sehr bald wieder die illegale politische Arbeit in Zagreb und Bjelovar auf. Bereits im Juli ging er mit dem Auftrag nach Österreich, die gestörten Beziehungen zwischen den Führern der kroatischen Kommunisten und dem Zentralkomitee der KPJ in Ordnung zu bringen, das wegen der polizeilichen Repression unter Aleksandar I. seit 1929 im Wiener Exil arbeitete. Die Grenze überschritt er bei Tržič, als Bergsteiger verkleidet und mit einem Ausweis des Kroatischen Alpenvereins.
Doch in Kärnten geriet er in den Nazi-Putsch gegen die klerikale Regierung von Kanzler Engelbert Dollfuß.59 Als er sich von Klagenfurt endlich mit dem Zug bis Wien durchgeschlagen hatte, »stürzten sich die dortigen Genossen auf mich wie die Bienen auf den Honig«, weil sie wissen wollten, wie die Lage in der Heimat und in den Parteiorganisationen war. Er traf sie in einem Kaffeehaus und bekam es, als er sie vor sich sah – »ein halbes Dutzend hinterhältig blickender Männer« –, fast mit der Angst zu tun. Broz erklärte, dass in Jugoslawien keiner der wahren Kommunisten, die er im Gefängnis oder in Freiheit kennengelernt habe, Vertrauen zum ZK der KPJ habe. »Gorkić – der Generalsekretär der Partei – zwirbelte seinen roten Schnurrbart. Der stand ihm nicht gut; er betonte die Blässe seines Gesichts.« Er fiel Broz ins Wort und überschüttete ihn mit einem Schwall grober Schimpfwörter.60
Trotz dieses unfreundlichen Empfangs kooptierten ihn die Wiener Genossen am 1. August 1934 ins Politbüro, und Ende Dezember wurde er auf der in Ljubljana abgehaltenen IV. Staatskonferenz ins Zentralkomitee gewählt.61 Für dieses Gremium hatte ihn der junge kroatische Kommunist Ivan Krajačić-Stevo vorgeschlagen, Mitglied des Stadtkomitees in Zagreb, mit dem Broz sein ganzes Leben eng verbunden bleiben sollte.62 Wie erwähnt stand zu diesem Zeitpunkt Josip Čižinski, besser bekannt unter dem Pseudonym Milan Gorkić (Sommer) an der Spitze der KPJ; er war tschechisch-polnischer Herkunft, aber in Bosnien geboren. Die jugoslawischen Verhältnisse kannte er nur unzureichend, denn 1922 war er als Neunzehnjähriger nach Moskau gegangen, wo er bis 1932 in verschiedenen Büros der Komintern arbeitete und enge Kontakte zum Innen ministerium (NKWD) unterhielt, die ihm auch Zugang zu den »höheren Kreisen« verschafften. Er hatte sogar eine Frau aus diesem geschlossenen und privilegierten Kreis geheiratet, die Direktorin des berühmten Kulturparks. Unweigerlich wurde Gorkić so zu einem (selbst-) überzeugten Parteibürokraten, der 1932 sozusagen per Investitur zum Sekretär der KPJ ernannt wurde, ohne dass die Mitglieder der Partei mitzureden gehabt hätten. Er sah sich an der Spitze einer Partei, die kaum 3000 Mitglieder zählte, von denen die meisten im Gefängnis saßen oder im Exil lebten und unter denen es nicht an Provokateuren, Verrätern und Polizeispitzeln mangelte. All das machte die Parteiführung zu einem wahren Schlangennest. Jeder verdächtigte jeden und man schwärzte sich gegenseitig bei der Komintern an, wobei alle sehr wohl wussten, dass man in Moskau auf neugierige Ohren stoßen würde. Aufgrund dieser Verhältnisse zirkulierte in der Komintern der Witz, »dass zwei Jugoslawen drei Fraktionen bilden, deren Angehörige sich untereinander so sehr befeinden und bekämpfen, dass sie den Klassenfeind völlig vergessen«.63
Broz war sehr daran gelegen, diese Verhältnisse in der Partei zu beenden und schrieb am 2. August 1934 einen Bericht für das Zentralkomitee, in dem er betonte, dass man das abstrakte Politisieren überwinden, die Kontakte zu den werktätigen Massen stärken und zur Aktion schreiten müsse. Dieses Dokument unterschrieb er erstmals mit dem Pseudonym Tito, einem Namen, der in seiner Heimat Zagorje ziemlich verbreitet ist.64
Broz wollte nach Moskau weiterreisen, um seine Frau (und seinen Sohn) zu sehen, die nach seiner Verurteilung in die Sowjetunion zurückgekehrt war, um sich an der Internationalen Lenin-Schule einzuschreiben, doch Gorkić entschied anders. Er schickte ihn in die Banschaft Drau, wo er gemeinsam mit den slowenischen Genossen die Landes- und die IV. Staatskonferenz organisieren sollte. Erstere fand am 16. und 17. September in der Sommerresidenz des Laibacher Bischofs statt, dessen Halbbruder mit den Kommunisten sympathisierte.65 An der zweiten, die Ende Dezember in der slowenischen Hauptstadt tagte, nahmen elf Delegierte teil. Broz war nicht anwesend, denn es galt die Regel, dass derjenige, der eine Konferenz organisiert, aus Sicherheitsgründen nicht an ihr teilnimmt. So behauptete zumindest der Generalsekretär, während Broz dahinter einen Vorwand argwöhnte, um ihn auszuschalten. Beide Konferenzen waren von den Versuchen gekennzeichnet, das Sektierertum der letzten Jahre zu überwinden und die Partei in ihr reales Umfeld einzubinden. Zu dem Zweck wurde (auf Initiative der Komintern) beschlossen, innerhalb der KPJ in Slowenien und Kroatien autonome Parteien zu gründen.66
Schon im September kehrte er nach Wien zurück, von wo ihn Gorkić bald nach Jugoslawien zurückschickte, diesmal nach Zagreb. Erneut mit dem Auftrag, sich mit den Kroaten über die Parteikonferenz zu beraten. Diese Aufträge belasteten Broz’ Beziehung zu Gorkić, denn er hegte den Verdacht, dass ihn der Generalsekretär so kurz nach seinem Gefängnisaufenthalt absichtlich Gefahren aussetze. Trotz seiner musterhaften Lebensführung erschien ihm Gorkić allzu vertrauensselig gegenüber seinem Umfeld und eigentlich unfähig zu konspirativer Tätigkeit. Zudem behandelte er seiner Meinung nach die Genossen, die sich in Jugoslawien zu formieren suchten, geringschätzig und versuchte sie zu diskreditieren, damit sie keinen Zugang zu den Geldern bekämen, die die Komintern der KPJ überwies.67 »Mich hat das furchtbar angewidert …«68 Trotzdem unterhielt er eine formal korrekte Beziehung zu Gorkić.69 Jahre später erst vertraute er Louis Adamić an, was er wirklich von Gorkić hielt: »Das Einzige, was rot an ihm war, waren seine Haare und sein Bart.«
Ende 1934 schickte er im Namen des Politbüros, das sich damals in Brünn aufhielt, eine Anleitung für den bewaffneten Aufstand an alle Provinzkomitees der KPJ und des Bundes der kommunistischen Jugend Jugoslawiens (SKOJ). Denn der jugoslawische Staat befand sich erneut in einer schweren Krise: Am 9. September war König Aleksandar I. bei einem offiziellen Besuch in Marseille von einem bulgarisch-mazedonischen Attentäter erschossen worden, der mit dem Führer der kroatischen Ustascha, Ante Pavelić, in Verbindung stand. Da das Ende der Karađorđević-Dynastie gekommen schien, schreckte Broz auch nicht vor der Empfehlung zurück, die bewaffneten Gruppen der KPJ mögen sich auch mit den radikal chauvinistischen Organisationen verbünden. Er war überzeugt, das verhasste monarchistische Regime nur auf diese Weise stürzen zu können.70
Doch Prinz Pavle, der nach dem Tod seines Cousins die Regentschaft im Namen des minderjährigen Sohns Peter II. übernahm, gelang es, Herr der Lage zu werden, und es setzte sich die Überzeugung durch, dass den Kommunisten schwere Jahre bevorstehen würden und dass der Terror noch schlimmer werden könnte als in den Jahren 1929–1931. Daher sollten die leitenden Kader, unter ihnen auch Broz, wenn möglich das Land Richtung Sowjetunion verlassen, um sich dort auf kommende Staatskrisen vorzubereiten.71
Vor seiner Abreise wäre Broz fast noch der Wiener Polizei in die Hände gefallen. Denn er wohnte illegal bei einer älteren Jüdin, deren Tochter versuchte, sich mit Gas zu vergiften. Broz rettete sie zwar in letzter Minute, doch die herbei gerufenen Gendarmen verlangten, seinen Ausweis zu sehen. Er entkam ihnen nur um Haaresbreite.72