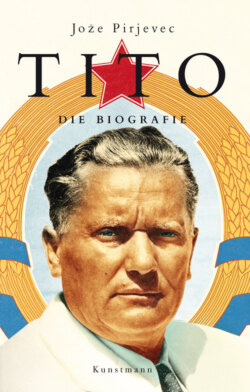Читать книгу Tito - Joze Pirjevec - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IM ERSTEN WELTKRIEG
ОглавлениеAls Ende Juli 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, kam Broz’ Regiment zunächst an die serbische Front an der Drina, wo er von August bis Dezember als Feldwebel des 25. Domobranen-Infanterieregiments diente, und später in die Karpaten an die russische Front. Zuvor hatte man ihn noch in Petrovaradin bei Novi Sad für mehrere Tage ins Gefängnis geworfen. Man beschuldigte ihn, Antikriegshetze zu betreiben. Er selbst bezeichnete das später als Irrtum der Militärbehörden.14
Bei den schweren Kämpfen gegen die Russen in Ostgalizien, wohin er im Februar 1915 versetzt worden war, tat er sich als Kommandant eines Spähtrupps hervor und wurde sogar für eine Auszeichnung vorgeschlagen. »In der Nacht vom 17. auf den 18. März 1915 leitete er als Anführer einer Infanterie-Patrouille (vier Mann) einen Überfall auf eine feindliche Feldwache in Stare Krzywotulije, nahm alle elf Russen gefangen und brachte sie zu seiner Einheit«, heißt es in einem Dokument. »Dieser Unteroffizier meldet sich stets freiwillig zu jedem gefährlichen Einsatz […] und hat in den feindlichen Reihen schon mehrfach für ein Durcheinander gesorgt.«15 Für diesen Erfolg erhielt er eine beträchtliche Geldsumme, denn die Kommandantur bezahlte fünf Kronen für ein erbeutetes Gewehr.16 Doch bevor Broz die »kleine silberne Tapferkeits-Medaille « entgegennehmen konnte, wurde er zu Ostern in der Bukowina bei einem Gefecht mit Tscherkessen, Angehörigen der Wilden Division, die für ihre Grausamkeit bekannt waren, schwer verwundet.17
An jenem schicksalhaften Tag stieß sein Zug zunächst auf Russen, die sie sofort angriffen. Aber Broz hatte seinen Untergebenen befohlen, nicht zu schießen, weil er sich ergeben wollte. Doch nach den Russen stürmten Tscherkessen an und umzingelten seine Einheit. »Wir hatten das Herannahen der Tscherkessen nicht einmal bemerkt, bis sie auftauchten und sich in unsere Schützengräben stürzten.« Obwohl Broz beide Hände hob, wurde er von einem Tscherkessen mit einer zwei Meter langen Lanze angegriffen, während er selbst sich mit dem Bajonett zu verteidigen suchte. Doch dann stieß ihm ein zweiter Soldat eine Lanze mehrere Daumenbreit unters rechte Schulterblatt. »Als ich mich umdrehte, sah ich das entstellte Gesicht eines zweiten Tscherkessen und seine riesigen schwarzen Augen unter den buschigen Brauen.«18 Er stürzte zu Boden. Das Letzte, was er mitbekam, war ein russischer Soldat, der sich auf den Tscherkessen warf, als dieser Broz den Todesstoß versetzen wollte. Er wurde zusammen mit seinem gesamten Bataillon gefangen genommen. Zu Bewusstsein kam er erst wieder im Lazarett.19
Während sein Name auf die Verlustliste gesetzt wurde, begann in seinem Leben ein neues Kapitel.
Er war einer von zwei Millionen österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen, den voennoplennyj, die von den Russen im ganzen riesigen Zarenreich auf Lager verteilt wurden. Zunächst lag er für fast ein Jahr, von Mai 1915 bis März 1916, in einem improvisierten Lazarett des Uspenski-Klosters in dem Ort Svijažsk an der Wolga (Gouvernement Kazan), dann wurde er in ein Lager nahe der Stadt Alatir am Fluss Sura bei den Tschuwaschen verlegt. Dort lernte er die Tochter eines Arztes und ihre Freundin kennen, die die Kriegsgefangenen besuchten und den Kranken kleine Gefälligkeiten erwiesen. Sie liehen ihm Bücher und luden ihn mehrmals zu sich nach Hause ein: »Ständig drängten sie mich, ich solle (Klavier) spielen.« Und so erlernte er es auch.20 Zwar hätte er sich aus der Gefangenschaft retten können, wenn er dem Freiwilligenkorps beigetreten wäre, für das die Serben »Landsleute« aus Österreich-Ungarn für die Front in der Dobrudscha rekrutierten, doch gemeinsam mit siebzig Kameraden lehnte er es ab, in den Kampf zurückzukehren. Da er Unteroffizier war, hätte er gemäß der Genfer Konvention nicht zur Arbeit eingesetzt werden dürfen, er meldete sich indes freiwillig, woraufhin man ihn zu einem Großbauern in das Dorf Kalasejewo nahe der Stadt Ardatow im Gouvernement Simbirsk schickte, wo er Mechanikerarbeiten in einer Dampfmühle verrichtete. Im Herbst 1916 verlegte man ihn gemeinsam mit anderen Kriegsgefangenen an den Ural, in die Stadt Kungur, unweit von Jekaterinburg. Dort arbeitete er an einer Eisenbahnstrecke als Übersetzer und »älterer« Gefangener, d. h. als Aufseher. Im Mai 1917 schickte man ihn weiter zu der kleinen Bahnstation Ergatsch in der Nähe von Perm. Als er dort mit dem Lagerkommandanten aneinander geriet, wurde er zweimal eingesperrt und von drei Kosaken derart brutal verprügelt, dass er diese Schläge niemals vergaß.21
Im Chaos im Gefolge der Februar-Revolution floh er im Sommer 1917 aus dem Lager und schlug sich bis nach Petrograd durch, in der Hoffnung, in der Putilow-Fabrik Arbeit zu finden, wo er für zwei oder drei Tage tatsächlich eingestellt wurde. Er hatte sogar Gelegenheit, Lenin zu hören und den Schriftsteller Maxim Gorki zu sehen. Lenin gegenüber hegte er sein ganzes Leben lang tiefen Respekt, wovon die Tatsache zeugt, dass in all den Jahren, die er an der Macht war, auf seinem Arbeitstisch in Belgrad seine Fotografie und auf dem Schrank eine kleine Lenin-Büste standen.22
Als es am 13. Juli zu Demonstrationen kam, bei denen die Bolschewiki versuchten, die Macht zu übernehmen, schloss er sich diesen an. Doch als die Demonstrationen im Keim erstickt wurden, sah er die Revolution als gescheitert an. Nur dem Zufall war es zu verdanken, dass er nicht vom MG-Feuer der Polizisten niedergemäht wurde. Anfangs versteckte er sich an den Brücken der Newa, dann floh er nach Finnland, damals autonomes Fürstentum innerhalb des Russischen Reichs. In der Nähe der Stadt Oulu wurde er verhaftet, und weil er nicht Finnisch sprach, hielt man ihn für einen »gefährlichen Bolschewiken«. Schließlich konnte er die Polizei davon überzeugen, dass er ein österreichischer Kriegsgefangener war, und wurde freigelassen. Er kehrte nach Petrograd zurück, wo er erneut verhaftet und für drei Wochen in die Peter-und-Paul-Festung eingesperrt wurde.23 Wer diese Gefängnisse kennt, kann nicht daran zweifeln, dass er sich erleichtert fühlte, als man in ihm einen voennoplennyj, einen Kriegsgefangenen, erkannte und ihn wieder in den Ural schickte. Doch noch vor der Ankunft in Kungur gelang es ihm, nach Sibirien zu fliehen. Bei einem Halt sprang er aus dem Eisenbahnzug für Deportierte, und obwohl ihn ein Wärter aus einem seiner früheren Lager erkannte, gelang ihm die Flucht. Er bestieg einen Personenzug, ohne Geld und ohne Fahrkarte, was aber den Schaffner nicht kümmerte, da an diesem Tag Lenin die Macht ergriffen hatte. »Wir fuhren lange. Im Zug kam es zu Prügeleien. Soldaten warfen Offiziere der Weißen aus dem Waggon.«24 Schließlich gelangte Broz nach Omsk, wo er sich der Internationalen Roten Garde anschloss, bei der er von Spätherbst 1917 bis Frühjahr 1918, also während der Zeit des Bürgerkriegs zwischen den Roten und den Weißen, als Wachmann und Mechaniker Dienst tat. In dem Dorf Michailowka nahe Omsk, wo er erneut in einer Dampfmühle arbeitete, lernte er die kaum dreizehn- oder vierzehnjährige Pelagija D. Belousowa kennen, die Polka gerufen wurde, und ging mit ihr die erste seiner insgesamt fünf ernsthaften Verbindungen ein. Von denen keine einzige glücklich endete.25
1918 ersuchte er um die sowjetische Staatsbürgerschaft und um Aufnahme in die Kommunistische Partei, wobei er Erstere nie erhielt und Letztere erst zwei Jahre später, nachdem sich die Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ) gegründet hatte.
Jedenfalls war seine Zeit bei der Internationalen Brigade keine besonders heroische, denn entgegen der späteren offiziellen Geschichtsschreibung war er nie »Soldat der Revolution«. Infolge seiner Kriegsverletzung war er noch zu schwach, um an die Front zu gehen, und spuckte noch immer Blut. Doch das sibirische Omsk, wo seine Einheit stationiert war, wurde bald von der Weißen Garde des Generals Alexander W. Koltschak eingenommen, die eine systematische Jagd auf mögliche Gegner bzw. Deserteure einleitete. Vor den »Weißen« und ihrem Terror, vor allem aber vor der drohenden Zwangsmobilisierung in die tschechoslowakische oder serbische Legion, die sich beide auf die Seite der Konterrevolution geschlagen hatten, versteckte sich Broz in einem kirgisischen »Aul« (Dorf) etwa siebzig Kilometer von Omsk entfernt. Hier arbeitete er erneut als Mechaniker in einer Dampfmühle, die dem reichen Bauern Isaija Džaksenbajev gehörte. Aber die Tschechen besetzten auch dieses abgelegene Gebiet und versuchten, ihn zu verhaften, da sie von seinen Kontakten zu Kommunisten aus Omsk wussten. Es ist nicht klar, ob er von Džaksenbajev versteckt wurde, oder ob örtliche Bauern, unter denen er für die Sowjetmacht agitiert hatte, seine Identität verschleierten und bezeugten, dass er schon seit 1915 bei ihnen lebe und somit kein Deserteur sei – jedenfalls gelang es Broz, einer Gefangennahme zu entgehen.
Bei den Kirgisen hatte er sich beliebt gemacht als ein mutiger, einfallsreicher und entscheidungsfreudiger Mann mit einer ungewöhnlichen Gabe für den Umgang mit Tieren. Das war ein Charakterzug, den er sein Leben lang beibehielt. Davon zeugt auch eine Anekdote, die aus dieser Zeit stammt26: Freunde schenkten ihm einen jungen Falken. Broz zog ihn auf und und beschloss, als er herangewachsen war, ihn freizulassen. Doch zwei Tage später kam der Falke wieder zurück und setzte sich auf seine Schulter. Ruhig wartete er darauf, gefüttert zu werden. Als er satt war, flog er fort, kehrte aber nach zwei Tagen erneut zurück. Erst beim vierten Mal flog er für immer davon. Alle, die diese Geschichte gehört hatten, sagten: »Alles, was lebt, muss einen Menschen wie Broz lieben.«27
Nachdem die Rote Armee Koltschak und seine Truppen Ende 1919 aus Omsk vertrieben hatte und der Eisenbahnverkehr mit Petrograd wieder hergestellt war, entschloss sich Broz, mit seiner Frau die Heimreise anzutreten. In Petrograd, wo er ca. drei Wochen blieb, erfuhr er, dass auf den Trümmern des Habsburger Kaiserreichs das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS) gegründet worden war und in dem neuen Staat die Revolution ausgebrochen sei. (Diese Meldung war allerdings übertrieben.) Die sowjetischen Behörden ernannten ihn zum Kommandanten einer Einheit von Kriegsgefangenen aus den ehemals österreichischen Ländern, die nun Staatsbürger der neuen Monarchie waren.28 Mit dieser kehrte er im September 1920 über das Baltikum in die Heimat zurück, wobei die jugoslawischen Repräsentanten in Wien seinen Grenzübertritt zu verhindern suchten, weil ihn zwei serbische Kameraden beschuldigten, Kommunist zu sein. In Maribor wurde er zusammen mit seiner Frau tatsächlich in Quarantäne gesteckt, doch bereits nach einer Woche erlaubte man ihm, nach fünf Jahren Kriegsgefangenschaft in sein Heimatdorf zurückzukehren.29 Aber Russland und Sibirien mit der Taiga, dem Mondlicht und den Pferden bewahrte er bis an sein Lebensende tief in seinem Herzen. Zum Land der Sowjets bewahrte er bis ins hohe Alter eine tiefe emotionale Beziehung.30 Als 1952, auf dem Höhepunkt des Konflikts mit Stalin, einer seiner Generäle in vulgären Worten auf die Sowjetunion schimpfte, sagte er in höchst erregtem Ton: »Jeder Wolf hat sein Rudel, das er niemals verlässt. So ist es auch mit mir.«31 Trotz aller Enttäuschungen, Zweifel und Konflikte war für Tito klar, »dass der sozialistische Kontinent real existiert, dass er ein Sechstel unseres Planeten ausmacht und dass er den Beginn eines Prozesses bedeutet, der nicht aufzuhalten ist«.32 Wie Veljko Mićunović, einer seiner wichtigsten Diplomaten, bezeugt, hinterlegte er zu Beginn der siebziger Jahre sogar sein Testament in der Sowjetunion, weil »er den Leuten rings um sich nicht traute«.33