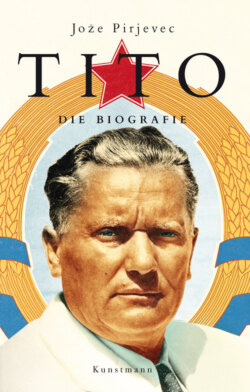Читать книгу Tito - Joze Pirjevec - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der junge Broz – Erster Weltkrieg, Kriegsgefangenschaft und Aufstieg in der Kommunistischen Partei Jugoslawiens (KPJ) LEHR- UND WANDERJAHRE
ОглавлениеJosip Broz, wie Tito mit bürgerlichem Namen hieß, wurde am 7. Mai 1892 (zu seinem Geburtsdatum machte er unterschiedliche Angaben)1 als Untertan von Kaiser Franz Joseph I. im Zagorje im Dorf Kumrovec an der Grenze zwischen dem Königreich Kroatien-Slawonien und dem Herzogtum Steiermark geboren. Zwar waren beide Verwaltungseinheiten Teil der Habsburger Monarchie, doch erstere gehörte zu den Ländern der Stephanskrone, während letztere Erbland der Habsburger Dynastie war. Franz Joseph war in Wien Kaiser, in Budapest aber nur König, was nicht nur von formaler Bedeutung war, vor allem nicht ab 1867, als die innerhalb seines Herrschaftsgebietes entstandenen zwei Staaten außer dem Monarchen selbst nur drei Schlüsselministerien gemeinsam hatten: das Kriegs-, das Finanz- und das Außenministerium. Während sich die österreichische Hälfte langsam aber stetig im Rhythmus der industriellen Revolution modernisierte, verblieb die ungarische Hälfte im Würgegriff der konservativen Feudalklasse, die kein Interesse an nationalen und sozialen Fragen hatte. Wäre Josip Broz nur wenige Kilometer von seinem Dorf entfernt im Bistrica-Tal im Haus seiner Mutter Marija geboren und aufgewachsen, wäre sein Schicksal wahrscheinlich anders verlaufen. Wegen des weit verzweigten Netzes der katholischen Kirche im Bistum Ljubljana hätte der örtliche Pfarrer sicherlich seine Begabung bald bemerkt und ihn aller Wahrscheinlichkeit nach zum Studium an den Bischöflichen Lehranstalten in die Hauptstadt Krains geschickt. Von dort hätte ihm der Weg in ein Priesterseminar und an die theologische Fakultät offengestanden, oder sogar auf die Universität, wenn es ihm gelungen wäre, sich der geistlichen »Berufung« zu entziehen. (Seine gläubige Mutter hoffte, dass er Pfarrer würde.) Da er jedoch im Zagorje geboren wurde und aufwuchs, wo die Kirche nicht so präsent war wie in den slowenischen Landen, kümmerte sich niemand so recht um seine Erziehung. Er absolvierte gerade einmal vier Klassen der Grundschule und einige Jahre der Berufsschule. Außerdem hatte der häufig betrunkene örtliche Pfarrer den zwölfjährigen Ministranten wegen seiner Ungeschicklichkeit beim Ausziehen des Messgewands geschlagen und beschimpft, was ihm der kleine Joža sehr übelnahm: »Ich ging zwar sonntags immer noch zur Messe, weil die Mutter es so wollte, aber ich denke, dass ich von diesem Augenblick an für immer mit der Kirche abgeschlossen hatte.«2 Seine Familie gehörte nicht zu den ärmsten im Dorf, doch da sie mit fünfzehn Kindern »gesegnet« war, von denen acht früh verstarben, und sein Vater Franc, ein Mann von schwachem Charakter, – »schwarz wie der Teufel« – dem Alkohol verfallen und gezwungen war, sein bisschen Land zu verkaufen3, musste er schon an der Schwelle zur Pubertät sein Brot in der Fremde verdienen.4 Von seinem Vater sprach er zeitlebens nicht gern, und auch von den Bauern seiner Heimatregion Zagorje hatte er nicht die beste Meinung. So beschrieb er seine Landsleute Jahre später: »Diejenigen, die mit dir nicht einverstanden sind, stehen abseits, den Hut in die Stirn gedrückt, die Hände in den Taschen. Sie sind sehr passiv und unintelligent.«5 Andererseits wusste er seit seiner Kindheit von den Bauernaufständen, die seine Heimat in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erfasst hatten; und er wusste auch um den tragischen Tod von Matija Gubec und seiner Anhänger nach der Niederlage von 1573. Die siegreichen Feudalen hatten ihn auf dem Zagreber Hauptplatz mit einem weißglühenden Reif gekrönt und anschließend gevierteilt. Daher verwundert es auch nicht, dass in seinem Arbeitszimmer in Belgrad ein großes Bild des Malers Krsta Hegedušić hing, das die aufständischen Bauern in der epischen Schlacht bei Stubica zeigt, in der sie endgültig besiegt wurden.6
Zunächst wollte Broz Schneider werden, weil er schöne Anzüge liebte, doch der Lehrer der örtlichen Schule meinte, als ein unruhiger Bursche sei er für einen sitzenden Beruf nicht geeignet. Stattdessen fing er in einer Gastwirtschaft in Sisak an – diese Arbeit hatte er sich ausgesucht, weil die Kellner in seinen Augen elegant waren –, doch nach kurzer Zeit sattelte er um und begann als Schlosserlehrling. Er war tatsächlich ein unruhiger Geist: Gleich nachdem er 1910 ausgelernt hatte, wechselte er mehrfach den Arbeitsplatz, er arbeitete in Kroatien, in Krain, in Böhmen, in Bayern, im Ruhrgebiet und in der Wiener Neustadt. Er spielte sogar mit dem Gedanken, nach Amerika auszuwandern, kam aber nur bis Triest, wo es ihm schlecht ergangen wäre, wenn die lokalen Sozialdemokraten nicht eine Armenküche unterhalten hätten.7 In Zagreb trat er 1910 dem Verband der Metallarbeiter und im darauffolgenden Jahr dem Bund der Sozialistischen Jugend bei, womit er automatisch auch Mitglied der Sozialdemokratischen Partei wurde.8 »Unsere Jugend«, erinnerte sich sein Zeitgenosse Miroslav Krleža, »spielte sich in jenen hoffnungslos langweiligen und grauen Straßen der Zagreber Unterstadt ab […], wo die Kneipen armselig sind und stinken, wo die Läden nach Mehl und Stockfisch riechen wie in der hintersten Provinz und wo in den öden zweistöckigen Häusern schlecht bezahlte graue Beamte eines grauen und langweiligen Kaiserreichs auf dem Totenbett wohnen.«9
Im Herbst 1913 wurde er zum Militär einberufen, wo er es im Regiment rasch zum Zugführer brachte. Mit einundzwanzig Jahren war er einer der jüngsten Unteroffiziere der k.u.k. Armee.10 Als ehemaliges Mitglied des »slawisch« ausgerichteten Jugend- und Sportverbands Sokol war er ein guter Turner, ein ausgezeichneter Skiläufer und Fechter. Nach eigener Überzeugung erhielt er bei einem in Budapest von der Armee organisierten Fechtturnier lediglich deshalb nur die Silbermedaille, weil er Kroate und weil sein Gegner gräflicher Abstammung war.11
Gegenüber der Habsburger Monarchie hegte er auch in späteren Jahren keine feindseligen Gefühle, denn er sah in ihr einen wohlgeordneten Staat, wenngleich er sich schon zu dieser Zeit für die jugoslawische Idee begeisterte. Als einmal in einem Gespräch die Rede auf König Nikola von Montenegro kam und Milovan Đilas ihn verächtlich eine Operettenfigur nannte, widersprach Tito: »Ach nein. Uns jungen Leuten war er sympathisch – er war mutig, ein Patriot, ein Jugoslawe …«12 Zugleich blieb er seiner Heimat bis an sein Lebensende verbunden. 1971, während eines heftigen Konflikts mit den Zagreber »Liberalisten «, die seiner Meinung nach gegenüber den kroatischen Nationalisten allzu nachgiebig waren, sagte er – schon ein wenig angetrunken – zu Savka Dabčević-Kučar, der Präsidentin des Kroatischen Zentralkomitees: »Ihr glaubt in Wirklichkeit, ich hätte kein Nationalgefühl, dass ich mich überhaupt nicht als Kroate fühlen würde, dass ich als junger Proletarier in die Welt hinausgegangen wäre und mir der proletarische Internationalismus jedes Nationalgefühl ausgetrieben hätte. Ich bin auch Internationalist, weil wir Kommunisten sind, und wir müssen auch alle Internationalisten sein! Aber ich bin auch Kroate!«13