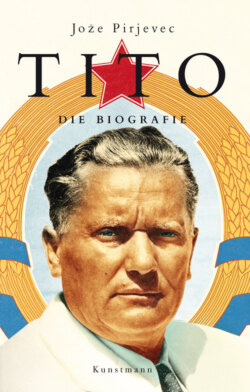Читать книгу Tito - Joze Pirjevec - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweiter Weltkrieg und Partisanenkampf DER HITLER-STALIN-PAKT UND KRIEGSBEGINN
ОглавлениеAls am 1. September 1939 mit Hitlers Überfall auf Polen der Krieg ausbrach und damit für Großbritannien und Frankreich der Bündnisfall eintrat, sahen Broz und seine Mitstreiter den Beweis erbracht, dass es sich um einen Konflikt zwischen zwei gegnerischen imperialistischen Blöcken handelte, und er daher »nicht ein Krieg der Arbeiterklasse sein kann«.1 Als Deutschland und die Sowjetunion am 28. September noch einen Grenz- und Freundschaftsvertrag schlossen, der eine gemeinsame Friedensinitiative vorsah, waren sie geneigt zu glauben, dass die Schuld am Kriegsausbruch mehr bei den westlichen »kolonialistischen « Mächten und der »verbrecherischen Politik der englischen und französischen Kriegshetzer« zu finden war als in der aggressiven territorialen Expansionspolitik Nazideutschlands.2
Zeitgleich mit der Unterzeichnung dieses Zusatzabkommens marschierte die Rote Armee in Polen ein. Aus diesem Anlass berief Manuilski eine Sitzung aller Vertreter der kommunistischen Partei ein, die sich in Moskau befanden. Bei dem Treffen, an dem auch Broz teilnahm, erläuterte er das Abkommen mit den Deutschen und betonte, dass dieses taktische Manöver die übrigen kommunistischen Parteien nicht davon abhalten solle, auch weiterhin den Faschismus zu bekämpfen. Er gab den Anwesenden den Auftrag, dass jeder von ihnen in diesem Sinne einen Aufruf an seine Partei verfassen solle. Doch aus Angst vor Stalin und davor, etwas Falsches zu sagen, kam niemand dieser Aufforderung nach – außer Broz, der an seine Partei schrieb, dass nach wie vor die größte Gefahr für Jugoslawien und den fortschrittlichen Teil der Menschheit vom deutschen und italienischen Faschismus ausgehe. Manuilski begrüßte diesen Aufruf und gestand seinem Verfasser zu, mit eigenem Kopf zu denken.3
Dieses Zugeständnis einer eigenen politischen Linie war jedoch nur von kurzer Dauer. Sehr bald, spätestens mit dem sowjetischen Angriff auf Finnland, wurde die Bewertung der internationalen Lage durch Stalins Standpunkt diktiert: dass nämlich nicht der Kampf gegen den Faschismus höchste Priorität habe. Diese habe vielmehr die sogenannte »Klassenkonfrontation«, also der Kampf von »Klasse gegen Klasse«, von Proletariat gegen Bourgeoisie.
»Unter den Bedingungen, als Hitlers Armeen die Karte Europas verändert hatten, als die Offensive des Faschismus in voller Fahrt war«, erzählte Tito später, »konnte eine solche Politik, die die nationalen Interessen und die Verteidigung der Unabhängigkeit zurückstellte – das spürte ich –, fatale Folgen haben.«4 Für ihn persönlich wäre es aber natürlich noch fataler gewesen, hätte er diesen Gedanken damals laut geäußert, und so schloss er sich nach außen hin der »klugen Stalin’schen Linie des Friedens« an, die Hitler gezwungen habe, »vor der Sowjetunion zu kapitulieren, die sich auf eine unüberwindliche Arbeiterund Bauernarmee und auf die Hilfe von Millionen werktätiger Menschen stützt …«5 Er und seine Genossen begrüßten in den folgenden Monaten die Politik der Sowjetunion, die mit der Roten Armee in verschiedenen Etappen »die Zwanzigmillionenvölker Weißrusslands, der Westukraine, Bessarabiens und der Bukowina, Litauens, Lettlands und Estlands […] von der kapitalistischen Sklaverei befreite«. Im Organ der Komintern Die Welt, die in Stockholm erschien, schrieb Broz, dass die Jugoslawen diese Großtaten begeistert begrüßten.6
Zumindest in Bezug auf die linke studentische Jugend war das durchaus zutreffend. Am 21. Dezember 1939 meldete Hans Helm, der gemäß einem Abkommen beider Regierungen eine deutsche Polizeidelegation in Jugoslawien leitete, aus Belgrad nach Berlin, dass der Hitler-Stalin-Pakt die positive Wirkung habe, dass die kommunistische Propaganda nun zugunsten Deutschlands arbeite und sich ganz auf den Kampf gegen den britischen und französischen Imperialismus richte. Er fügte hinzu: »Vor der Unterzeichnung des deutschrussischen Paktes waren die Kommunisten die größten Nationalisten in Jugoslawien. Die kommunistischen Studenten an der Belgrader Universität stellten Freiwilligenbataillone auf, die von Offizieren ausgebildet wurden. Nach der Unterzeichnung des Paktes waren alle diese Freiwilligen verschwunden. Vor dem 23. August konnten die Kommunisten den Kriegsausbruch kaum erwarten. Heute sind sie extreme Pazifisten …«7 Als die Sowjetunion Finnland im November angriff (weshalb sie am 14. November aus dem Völkerbund ausgeschlossen wurde), kam es in Belgrad zu pro-russischen Kundgebungen, bei denen die Studenten riefen: »Besser auf den Straßen Belgrads [im Kampf gegen die Bourgeoisie] sterben als an der slowenischen Grenze [im Kampf mit den Nazis].« Britische Diplomaten waren damals überzeugt, »dass in diesem Staat hinter der kommunistischen Propaganda größtenteils deutsches Geld und deutsche Agenten stehen«. Zudem erkannten sie, dass es die Kommunisten hervorragend verstanden, auf der sozialen Saite zu spielen und auch panslavische Gefühle anzusprechen, womit sie sehr erfolgreich seien.8
Doch nicht überall schloss sich die Linke vorbehaltlos der sowjetischen Doktrin an. Nicht in Belgrad, nicht in Ljubljana und vor allem nicht in Zagreb, wo sich Broz mit einer kritischen Haltung gegenüber der Sowjetunion konfrontiert sah. Vor allem unter den Intellektuellen sah man dort den sozialistischen Realismus, wie ihn Moskau diktierte, die Einmischung in den Spanischen Bürgerkrieg und allgemein das, was man über die Stalinistische Herrschaft, die Schauprozesse und sibirischen Gulags wusste, kritisch. An die Spitze dieser Gruppierung stellte sich Miroslav Krleža-Fric, damals der bedeutendste Literat Kroatiens. Er hatte von Pavle Bastajić, der selbst ein »Exekutor« gewesen und nun auf der Flucht vor NKDW-Agenten war, aus erster Hand einiges über die stalinistischen Säuberungen erfahren, und später dazu geäußert, dass er noch nie von einer dämonischeren Geschichte gehört habe.9
Broz bemühte sich, den sogenannten »Konflikt mit der literarischen Linken « zu überwinden. Noch vor seiner Abreise nach Moskau im September 1939 traf er sich zu diesem Zweck mit Krleža in einem Gasthaus am Zagreber Stadtrand und erklärte ihm, dass es nicht angehe, die Autorität der Partei auf diese Weise zu untergraben. Dabei beobachteten die Gesprächspartner die Ankunft einer Gruppe verdächtiger Leute. »Hier habe ich Tito zum ersten Mal in Aktion gesehen«, berichtet Krleža später. »Er sitzt ruhig da, sieht zur Eingangstür, wo mehrere kleinere Stufen in den Garten führen. Aus der Tasche nimmt er einen Revolver, lädt ihn, legt ihn neben sich auf die Bank und sagt zu mir: ›Ich werde auf jeden Fall Widerstand leisten. Ich kann nicht anders, aber du sieh zu, dass du hier über den Zaun springst, und flüchte da hinauf.‹ Er gab mir noch Anweisungen, welchen Weg ich gehen solle. Kaltblütig.«10
Doch Miroslav Krleža und die um seine monatlich erscheinende Zeitschrift Pečat gescharten Leute waren schwerer auf eine Linie zu bringen als die Belgrader Studenten. Mit Gleichgesinnten war er überzeugt, dass es nicht sinnvoll sei, sich in der schwierigen internationalen Lage, wie sie durch die aggressive Politik Hitlers entstanden sei, in einen fruchtlosen Radikalismus zu flüchten. »Er glaubte nicht an den Sieg der Revolution«, erinnerte sich Tito später, »weil er das physische und materielle Kräfteverhältnis im Blick hatte. Ich sagte zu ihm: Das sind die genauen Fakten, aber es fehlt ihnen der moralische Faktor. Siegeswille und Siegesbewusstsein.«11
Kurzum, Titos orthodoxe politische Linie bewirkte eine Spaltung, die sich noch vertiefte, als die Nachricht vom Hitler-Stalin-Pakt kam. Auf die Linksorientierten in den Reihen der Intelligenz wirkte sie niederschmetternd. Schließlich hatten die »Faschisten« bis gestern als Bestien gegolten, mit denen kein Dialog möglich sei. Über Nacht waren sie zu Verbündeten geworden.12
Auch während seines Aufenthalts in Moskau versuchte Broz noch immer Krleža und seine Gefolgsleute auf Linie zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Daher berichtet er in einem Schreiben, das im September 1939 an die Komintern ging, dass Trotzkisten, die auf literarischem Gebiet tätig seien, mit ihrer Revision des Marxismus Unruhe in die Reihen der Intelligenz hineintrügen. Dagegen kämpfe die Partei geschlossen an.13
Diese Einstellung wurde von der EKKI am 23. November 1939 positiv gewertet, was aber nicht bedeutet, das Broz’ Feinde aufgehört hätten, gegen ihn zu intrigieren. Da ihn eine fiebrige Grippe ans Bett fesselte, konnte er Moskau erst am 26. November 1939 verlassen. (Seine engsten Mitarbeiter in Jugoslawien hatten ihn schon in einem NKWD-Gefängnis gesehen.) Über Odessa reiste er in die Türkei, weil ihm Karaivanov geraten hatte, nicht den Zug über Prag zu nehmen, da ihm in dem Falle ein Attentat seiner Moskauer Gegner drohe. In Moskau bestieg er zwar den Zug nach Prag, verließ ihn aber durch die gegenüberliegende Tür wieder und fuhr in die ukrainische Hafenstadt. In die Sowjetunion war er als der tschechische Ingenieur Tomanek eingereist, er verließ sie als der Kanadier griechischer Herkunft Spiridon Matas.14 Er blieb zunächst eine Weile in Istanbul, weil es ihm zu riskant erschien, die Fahrt mit einem sowjetischen Visum im Pass fortzusetzen.15 Außerdem fehlten ihm auch das bulgarische Transit- und das jugoslawische Einreisevisum, das die Belgrader Behörden seit Kurzem von Untertanen der britischen Krone verlangten. Deshalb beauftragte er die Genossen in der Heimat, ihm ein neues gefälschtes Dokument zu schicken. Dieses erreichte ihn auch, aber »Velebit und Herta«, erzählte Tito später, »brachten so schlecht gemachte Reisepässe an, dass uns der erstbeste Gendarm hätte hochgehen lassen können.« Und fügte nicht ohne Seitenhieb gegen Kardelj hinzu: »Wir verfügten über eine Technikabteilung, geleitet von Bevc [einer der Decknamen Kardeljs], dass wir falsche Banknoten hätten drucken können. Aber mir haben sie solche Pässe geschickt, als wollte mir jemand absichtlich schaden.«16 In einem Brief an Kopinič wurde er Jahre später noch deutlicher: »Kardelj hat mir 1940 nach dem Leben getrachtet!« Tito vermutete, dieser wollte ihn loswerden, da er auf eine Führungsrolle in der KPJ spekulierte.17 Was viel über sein stetes Misstrauen auch gegenüber den engsten Mitarbeitern aussagt.
Erst am 13. März 1940 kehrte Tito mit einem in der Komintern gefälschten Reisedokument nach Jugoslawien zurück.18 Um keinen Verdacht zu erregen, kaufte er eine Fahrkarte für den Ozeandampfer Rex, der Mitte März von Neapel bzw. Genua aus nach New York fahren sollte. Richtung Genua nahm er den Zug. An der griechisch-jugoslawischen Grenze erregte sein Reisepass, der scheinbar vom britischen Konsulat in der sowjetischen Hauptstadt ausgestellt worden war, Verdacht. Die Grenzbeamten verlangten eine Erklärung. Broz konnte sich damit herausreden, dass sein Originaldokument abgelaufen sei, während er sich wegen seiner Arbeit in der Sowjetunion aufgehalten habe, und er deshalb einen neuen Pass bekommen habe.19 In Zagreb stieg er aus, als wollte er sich auf dem Bahnsteig die Beine vertreten, und – blieb. Sein Gefühl, bedroht zu sein, war nicht unbegründet: Wenige Tage später erhielt er dafür die Bestätigung, als er im Café Corso die Meldung las, dass die britischen Behörden den italienischen Dampfer in Gibraltar gestoppt und durchsucht hätten, weil sie eine verdächtige Person suchten. Das Schiff habe sechs Stunden Verspätung gehabt, weshalb die Passagiere entrüstet protestiert hätten. »Und ich sitze hier in Zagreb.«20
Doch dieser kleine Triumph konnte nicht über seinen Eindruck hinwegtäuschen, dass seine Genossen versucht hatten, seine Ankunft zu vereiteln. Deshalb kam es auf der ersten Sitzung des ZK zu einer heftigen Konfrontation, bei der Broz seinem Zorn freien Lauf ließ. Mit Kardelj hatte er die Sache offenbar schon bereinigt, deshalb war jetzt Đilas an der Reihe, daran änderte auch die Erklärung nichts, dass der Stempelfälscher während seiner Abwesenheit in Haft gewesen war. Đilas war wegen der Vorwürfe so getroffen, dass er sich überhaupt nicht verteidigte, und ihm, als er zum Schluss etwas zu sagen versuchte, die Tränen in die Augen schossen. »Aber als die Sitzung beendet und ich noch ganz erstarrt war […], kam er zu mir und lud mich auf einen Spaziergang ein. Gewöhnlich ging er sonst selten durch Zagreb, weil er auf einen Bekannten treffen konnte. Diesmal aber tat er es. Ich dachte, dass er sich bei mir entschuldigen wolle, und in mir begann die Eisesstarre zu schmelzen. Aber das tat er nicht. Er fing einfach an über alles Mögliche zu sprechen, am meisten über mein Privatleben und meine Lebensverhältnisse. Von Zeit zu Zeit lächelte er milde. In all dem war etwas sehr Menschliches und Warmes, und als wir uns trennten, ging ich zufrieden weg wie ein Kind, dessen Vater erkannt hat, dass er es zu Unrecht bestraft hat, obwohl er es vor ihm nicht zugeben will.«21
In der kroatischen Hauptstadt sah sich Broz auch wieder mit Krleža konfrontiert, der ihm zweimal versprach, er werde seine »Kampagne« gegen den Hitler-Stalin-Pakt einstellen, diese Zusage aber nicht einhielt. In den folgenden Monaten verwendete er Herta Haas zufolge mindestens die Hälfte seiner Arbeitszeit auf Debatten mit den »Krležianern«.22Weil es ihm nicht gelang, sie zu überzeugen, stempelte er sie erneut als »Trotzkisten« ab und organisierte als Antwort auf ihre Artikel in Zagreb einen eigenen Sammelband, »Književne sveske« – ›Literarische Hefte‹, deren Redaktion er Vladimir Dedijer anvertraute, die er jedoch gemeinsam mit Kardelj las und zensierte.23
Krleža war besonders wegen des Schicksals jener getroffen, die »für den Bolschewismus lebten und durch die eigenen Reihen liquidiert wurden«.24 Tito gab ihm zur Antwort: »Was sollen wir in dieser Situation machen, wenn wir einen neuen Weltkrieg haben? Auf wen sollen wir uns stützen? Wir haben keine anderen Ausweg als die UdSSR, und sie ist nun mal, wie sie ist.«25 Alles vergebens: Krleža schloss sich während des Krieges nicht der Widerstandsbewegung an, obwohl ihn Tito sogar mit acht Depeschen einlud, in das befreite Territorium überzusiedeln. Aber Krleža glaubte einfach nicht an die Lebenskraft des Partisanenabenteuers, außerdem war er davon überzeugt, dass man ihn als Revisionisten »schlachten« würde, wenn er das täte.26 Wegen dieser Zurückhaltung gegenüber der Volksbefreiungsbewegung konnte ihm Tito nach dem Krieg nur mit Mühe den Kopf retten, obwohl er sich persönlich mit ihm ausgesöhnt hatte. Als der Schriftsteller im August 1945 auf eigene Bitte hin zum ersten Mal in den Weißen Palast kam, empfing Tito ihn so kühl, dass er ihm nicht einmal die Hand bot, sondern nur schroff zu ihm sagte: »Setz dich!« Aber schon nach einem halbstündigen Gespräch lud er ihn zum Mittagessen ein. Offensichtlich hatte die Kameradschaft die Oberhand gewonnen, die sich schon vor dem Ersten Weltkrieg in der Zagreber Kaserne, wo sie beide den Militärdienst ableisteten, zwischen den beiden gebildet hatte.27
Der Hitler-Stalin-Pakt änderte auch die innenpolitische Linie der KPJ. Während sie zuvor den Dialog mit all jenen gesucht hatte, die bereit waren, ihn zu führen, galt es nun die Anweisungen der Komintern umzusetzen. In den Direktiven, die im November 1939 an Broz ergingen, hieß es ausdrücklich, dass die KPJ die »bolschewistische Wachsamkeit und Disziplin« bedeutend verstärken müsse und nicht nur ein »Anhängsel von Vladko Maček und der Sozialdemokratie« sein dürfe.28 Dies war besonders an die fraktionistischen Elemente in Dalmatien gerichtet. Broz rief alle loyalen Parteimitglieder dazu auf, diese zu boykottieren und alle Verbindungen mit ihnen abzubrechen, ja, sie nicht einmal auf der Straße mehr zu grüßen.29
Das Abkommen zwischen dem Ministerpräsidenten der Belgrader Regierung Cvetković und dem Führer der Kroatischen Bauernpartei Maček hinsichtlich einer Autonomie der kroatischen Banschaft innerhalb Jugoslawiens, das die Kommunisten kurz zuvor noch begrüßt hätten, war in diesem Kontext zu einem Abkommen zwischen zwei Bourgeoisien erklärt worden, die unfähig seien, die nationale Frage in Jugoslawien zu lösen. In Bezug auf die Außenpolitik befürchtete Broz, dass sich die neue Koalitionsregierung Cvetković-Maček zu sehr Großbritannien und Frankreich zuwenden und sich in deren »imperialistischen « Krieg verwickeln lassen könnte. Um dies zu verhindern, müsse rasch ein Bündnis mit der Sowjetunion geschlossen werden, »die mit ihrer friedliebenden Politik der stärkste Feind des imperialistischen Krieges und ein Garant der Unabhängigkeit und des Friedens der kleinen Staaten« sei.30 Genau so hatte es die Komintern von den Balkanvölkern in einer Sonderresolution gefordert.31 Die Tatsache, dass sich Stalin Mitte März 1940 einen erheblichen Teil Finnlands einverleibt hatte und dass er das Gleiche mit Bessarabien vorhatte, störte die Rechtgläubigen der Partei offensichtlich wenig32, genauso wenig wie Hitlers Überfall auf Norwegen und Dänemark. In einer Ende Mai nach Moskau übermittelten mündlichen Mitteilung erwähnt Broz diese Tatsache überhaupt nicht. Dafür lässt er sich ausgiebig über anglo- und frankophile Gefühle aus, die »bedauerlicherweise « noch immer in Jugoslawien verbreitet seien: »Der Abschluss des deutsch-sowjetischen Paktes hat die antideutsche Stimmung ein wenig gemildert. Die antideutschen Gefühle haben aber mit dem Angriff Hitlers gegen Norwegen und Dänemark wieder zugenommen und sich zusätzlich noch vertieft, seit der Krieg auch die Niederlande und Belgien erfasst hat. Die Erkenntnis, dass diese Staaten durch die kriegshetzerische Politik Großbritanniens und Frankreichs in den Krieg verwickelt wurden, ist noch nicht zu den breiten Massen durchgedrungen.«33
Als die Wehrmacht in der ersten Junihälfte 1940 ohne Mühe Frankreich besiegte, entschied Broz aber, dass etwas getan werden müsse, wenn Jugoslawien vom Krieg verschont bleiben solle. Er dachte an einen Bund der Balkanstaaten, die sich gegenseitig helfen und sich vor den Deutschen unter den Schutz der Sowjetunion begeben sollten. In einem Artikel in der Zeitschrift Der Proleter wurde diese Option diskutiert, wobei der Autor zu dem Ergebnis kommt, dass es falsch wäre, nur auf die Rote Armee zu warten, damit sie die jugoslawischen Völker vor dem Krieg bewahre. Wenn die Rote Armee zu Hilfe kommen solle, dann müsse sich das Volk selber helfen; und zwar, in Übereinstimmung mit Lenins Lehre, indem es eine eigene »progressive« Regierung bilde.34
In den Archiven der Komintern findet sich ein Dokument vom 15. September 1940, das eine interessante Geschichte erzählt. Es handelt sich um das Protokoll einer Sitzung, an der die vier Führer der Dritten Internationalen, Pieck, Ercoli (Togliatti), Gottwald und Manuilski, über einen mündlichen Bericht debattierten, den Broz nach Moskau übermittelt hatte.35 Darin hatte er seinen Vorgesetzten vorgeschlagen, dass die KPJ den Sturz der Koalition Cvetković-Maček herbeiführen und sie durch eine »wirkliche Volksregierung« ersetzen solle. Ein solcher Schritt sei notwendig, da die Gefahr bestehe, dass Italien und Deutschland Jugoslawien unter sich aufteilten. Eine »wirkliche Volksregierung «, die die Unterstützung der Arbeiter und Bauern hätte, solle den bewaffneten Widerstand gegen jeden Versuch der benachbarten faschistischen Staaten vorbereiten, die jugoslawischen Völker unter ihr Joch zu zwingen.36 Tito glaubte lange Zeit, dass sich in Jugoslawien die russische Erfahrung wiederholen werde. Zuerst würde es zur bürgerlich-demokratischen Revolution kommen, deren Träger die werktätigen Massen und die liberal ausgerichtete Mittelschicht wäre, erst in der nächsten Etappe würde das Proletariat die ganze Macht übernehmen. Er zeigte sich überzeugt, dass man in diesem Sinne arbeiten und dass die KPJ der Motor des Geschehens werden müsse.37
Doch die Führer der Komintern kamen auf dieser Konferenz zu einer anderen Einschätzung, nämlich der, dass die Partei die gegnerische Stärke unter-, die eigene aber überschätze. Ihrer Meinung nach sei Jugoslawien für einen Wandel, wie ihn Russland nach der Februarrevolution von 1917 erlebt hatte, noch nicht reif, denn die Partei habe keinen großen Einfluss auf die Industriearbeiterschaft, geschweige denn auf die bäuerlichen Massen. Deshalb warnten sie vor jeder verfrühten Aktion, und betonten, dass sich niemand Illusionen über eine mögliche Hilfe der Roten Armee machen solle. In dem Dokument, in dem sie Broz zum ersten Mal als Sekretär des ZK der KPJ ansprachen, beschränkten sich Pieck, Ercoli, Gottwald und Manuilski nicht nur auf Verbote. Im zweiten Teil ihrer »Resolution« zeichneten sie die politische Linie vor, die die Partei in Zukunft einschlagen solle: Dem Plan einer Zerstückelung Jugoslawiens müsse sie sich widersetzen, indem sie jene Gruppierungen innerhalb der breiten Schichten der Bevölkerung, des Bürgertums und des Militärs unterstütze, die bereit seien, einen militärischen Aufstand zu organisieren. »Wenn es zur Teilung des jugoslawischen Staates in deutsche und italienische Protektorate ohne bewaffnete Auseinandersetzungen kommt, muss die Partei die Massen im Kampf gegen den Verrat der jugoslawischen Bourgeoisie und gegen die Gewalt der fremden imperialistischen Mächte organisieren.« Zu diesem Zweck möge die KPJ darüber nachdenken, ob es nicht angezeigt sei, für die verschiedenen nationalen Gebiete und für ganz Jugoslawien Militärprogramme mit konkreten politischen, wirtschaftlichen und nationalen Forderungen zu entwerfen. »Die Partei muss jede Möglichkeit der Zusammenarbeit mit oppositionellen Elementen und oppositionellen Gruppierungen der kleinbürgerlichen Parteien und auch mit der Sozialdemokratie ausnutzen, um die Kampffront gegen die Reaktion zu erweitern und zu stärken und die Massen zur Verteidigung der Unabhängigkeit der Völker Jugoslawiens zu ermuntern.«38