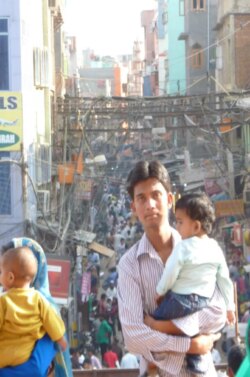Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 124
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBessergehensmotiv, Gleichgehensmotiv und Schlechtergehenseingeständnis
Hunderte Millionen, vermutlich Milliarden Personen wurden Eltern und dachten dabei, den Kindern möge es einmal besser gehen. Womit diese unzähligen Personen ihr eigenes Dasein dahingehend beurteilten, dass es nicht zufriedenstellend sei.
Überaus selten ist der Ausruf zu vernehmen: Möge es meinen Kindern einmal ebenso gut gehen wie mir! Selten ist dieser Ausruf deshalb, weil es auch den wirtschaftlich Arrivierten dieser Erde psychisch häufig nicht so gut geht – dies ist der Preis fürs wirtschaftliche Wohlergehen –, dass sie einen vergleichbaren seelischen Zustand ihren Kindern wünschen würden.
Ein Schlechtergehenseingeständnis hingegen verbietet sich aus moralischen Gründen: Wir werden kaum Personen treffen, die da sagen: „Ich entscheide mich für Kinder, obwohl ich davon ausgehen muss, dass es ihnen einmal schlechter gehen wird!“ Kaum eine Person möchte sich nachsagen lassen, dies geäußert zu haben. Folglich wird das Schlechtergehenseingeständnis umgemodelt in ein bloßes Andersgehensgeständnis. Liest man folgende Andersgehensgeständnis, bleibt allerdings – gegen die Intentionen des Autors – keine Selbstrechtfertigung übrig, Kinder in die Welt treten zu lassen:
„Ja, liebe Kinder-denen-es-einmal-besser-gehen-sollte, so sieht’s aus, ihr seid dreifach verschuldet, ökonomisch, ökologisch und moralisch. [...] Der plumpe Satz jedenfalls, dass es unseren Kindern mal besser gehen soll, ist kaputt, ungültig, gelöscht. Zeit, zu fragen, ob wir ihn wirklich noch so dringend brauchen: Muss es unseren Kindern besser gehen? Warum eigentlich? [...] Und haben wir nicht gerade wegen des Anspruchs, dass alles immer besser werden muss, diese ungeheuren Schulden erst angehäuft? Wollten sich die westlichen Gesellschaften mit ihrem virtuellen Geld nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aufstiegs- und Wachstumsautomatik außer Kraft gesetzt ist? Im Grunde muss man froh sein, dass es jetzt vorbei ist, die Ankunft in der Wirklichkeit erfolgte womöglich gerade noch rechtzeitig.
Vielleicht genügte es ja, wenn man aufhörte, die Kinder als Sinnersatz und Generalausrede zu missbrauchen. Ihnen wird es weder besser gehen noch schlechter, sondern anders. Sie werden Glück neu definieren (müssen), sie werden uns dabei womöglich unähnlicher werden, aber auch das ist ihr gutes Recht. Wie das Demonstrieren gegen die Welt, wie wir sie ihnen hingestellt haben.“ (Bernd Ulrich, DIE ZEIT, 20.10.2011; S.1)
Um seinen Pronatalismus nicht aufgeben zu müssen, deutet der Autor – um nur dieses Beispiel zu nennen – mit kaum zu überbietendem Zynismus die von der Industriegesellschaft verwüstete Welt kurzerhand in eine bloß anders gewordene Welt. Er gibt sogar zu, dass diese Welt so grundsätzlich anders sein wird, dass es einer Umdefinition des Begriffs „Glück“ bedarf, sollen die eigenen Kinder davon reden können.
Hoffnungsübersprung
Kaum hat eine Person eingesehen, dass alle Hoffnung auf eine Verbesserung des Daseins trügerisch war, überträgt sie die für das eigene Leben durchschaute Illusion der Verbesserbarkeit des Daseins und den Hoffnungsfunken auf die eigenen Kinder. Weswegen uns allerorten und aus allen Zeiten entgegenschallt: Meine Kinder sollen es einmal besser haben: „Es lag für mich etwas heiß Berauschendes in dem Gedanken: dass den noch Ungeborenen, für die ich grübelte und träumte, das ›Glück der Jugend‹ besser gelingen würde, als es mir geraten war!“ (Ganghofer, Lebenslauf eines Optimisten, Bd. 2, S. 578)