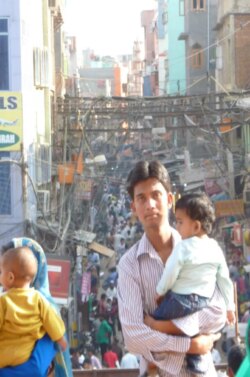Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zur Antinatalismen-Sammlung
ОглавлениеDer israelische Philosoph Saul Smilansky ist mit mehreren bedeutenden Aufsätzen zum Antinatalismus hervorgetreten. Gleichwohl hat ihn seine intensive Beschäftigung mit dem Thema nicht vor der grotesken Fehleinschätzung bewahrt, Daseinsverfluchungen nach dem Vorbild Hiobs (Biblischer Antinatalismus) seien rar gesät. Selbstbezügliche Daseinsverfluchungen sind eine Vorform des Antinatalismus. Denn wir müssen annehmen, dass andere Personen in ähnliche Situationen geraten wie wir selbst. Und dann impliziert die – ethisch stets gebotene – Universalisierung des Wunsches, nie geboren zu sein, einen Zweifel daran, ob überhaupt jemand gezeugt und geboren werden sollte. Im Glauben, die Präsenz antinatalistischer Vorstufen in der kulturellen Überlieferung vernachlässigen zu können, sagt Smilansky:
„It also seems significant that there is so little expression of the wish not to have been born, or at least this is so with most people who live under objectively tolerable conditions. If life were so bad, then – even if we bracket the possibility of suicide – we could expect much more expression of the Job-like wish not to have been born, in common sentiments, literature and the like. The idea is culturally available. Yet the sentiment is hardly to be found, except with those who are by temperament unusually melancholy, or are in depression, or, like Job, have some good reason for feeling so.“ (Smilansky, Life is good, S. 73)
Unser Handbuch belegt, dass nicht nur Smilansky sich täuscht. Selbst Heinz Rölleke, dem wir in Gestalt der Abhandlung „O wär‘ ich nie geboren…“ eine der umfassendsten Zusammenstellungen von Niedagewesenseinswünschen verdanken, unterschätzt die Präsenz antinatalistischer Formeln grandios, wenn er beispielsweise sagt: „Im übrigen finden sich in der pathos- und emotionsfeindlichen Gegenwartsliteratur weder direkte Verfluchung noch Preisung der Geburt. Offenbar nimmt man das Dasein eher als unabänderlich-undurchschaubare Realität hin.“ (Rölleke, S. 29)
Im Hinblick auf zahlreiche von uns und anderen Autoren aus Lyrik, Drama und erzählender Literatur zusammengetragene und kommentierte Deklamationen des „O wär‘ ich nicht geboren!“ sowie hinsichtlich anderer Antinatalismen ist zweierlei zu berücksichtigen. Zum einen ist zu bedenken, dass es sich in der großen Mehrzahl der Fälle um Äußerungen des Selbstverständnisses fiktionaler Figuren handelt, nicht hingegen notwendigerweise um Überzeugungen der jeweiligen Autoren. Zum anderen ist zu beachten, dass in diesen Ausrufen oftmals nicht mehr als eine momentane Niedergeschlagenheit zum Ausdruck kommt und dass sich aus derartigen transitorischen Stimmungen nicht auf die Weltanschauung einer literarischen Figur oder gar des sie gestaltenden Autors schließen lässt. Von daher stellt sich die Frage, ob wir spontanen Niedagewesenseinswünschen und antinatalistischen Spuren nicht zu viel Gewicht beimessen. Auf diesen Einwand wäre zu antworten, dass die literarische Überlieferung derart viele Antinatalismen (indirekte oder explizite antinatalistische Formen oder Aussagen) birgt, dass dem Antinatalismus in der Literatur allein schon durch die Vielzahl der Belege ein nicht zu unterschlagendes Gewicht zukommt – so ephemer die einzelne antinatalistische Äußerung im Kontext eines Romans, Dramas oder Gedichts auch scheinen mag. Ferner ist in Rechnung zu stellen, dass in der Literatur anzutreffende antinatalistische Topoi sedimentierte überindividuelle Stimmungen oder Strömungen sein können, die zunächst Eingang in den geistigen Haushalt Gebildeter finden mussten, um schließlich literarisch verarbeitet werden zu können, was für eine gewisse außertextuelle Präsenz spricht. Ein Beispiel hierfür ist Emile Zolas Roman Fruchtbarkeit.
Mit der Zusammenstellung und Kommentierung antinatalistischer Zeugnisse und Keimformen aus Jahrhunderten möchten wir unseren Lesern spezifische Weisen demonstrieren, in denen – nach unserer Lesart – die Menschheit in den Aussagen Einzelner gleichsam zur Vernunft kommt, indem sie sich von der Naturwüchsigkeit der Fortpflanzung distanziert und emanzipiert. Der Antinatalismus nimmt den Menschen als ein Kulturwesen ernst, das in der Lage ist, das Naturerbe der Fortpflanzung kritisch zu hinterfragen und sich diesem fatalen Erbe unterlassend zu entziehen. Bei der Vorstellung eines Seinsollens von Menschen handelt es sich unseres Erachtens um einen teils bionomen, teils kulturell unterfütterten Verblendungszusammenhang. Wie stark dieser Verblendungszusammenhang ist, erhellt etwa daraus, dass Vertreter radikaler Gesellschaftskritik wie Adorno zwar von einem „gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang“ reden, gleichwohl aber nicht in der Lage waren, die Perpetuierung des „Ganzen als des Unwahren“ im Sinne einer Philosophie der Nachkommenlosigkeit radikal in Frage zu stellen. Unsere Zusammenstellung von Antinatalismen dokumentiert Momente der Philosophie-, Literatur- und Kulturgeschichte, in denen dieser Verblendungszusammenhang brüchig oder durchschaut wird.
Zu den in Moderne und Gegenwart fortdauernden Mythologemen naturwüchsiger Provenienz gehört die Aussage, es sei nun einmal naturgegeben, dass Menschen sterben müssen. Der Antinatalismus entlarvt die angebliche Naturgegebenheit des Sterbenmüssens von Menschen als Ideologie. Denn als sterbliche Wesen sind wir nicht naturgegeben, sondern menschenverursacht. Tatsächlich kommt es nicht nur darauf an, die Gesellschaft in ihrem Sosein zu kritisieren und sie zu verändern, sondern sie in ihrem Dasein vernünftig aufzuheben.