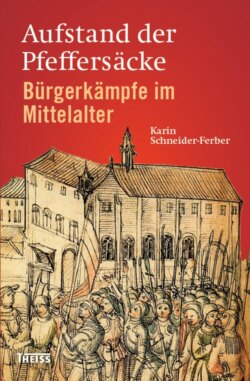Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DER RÄDELSFÜHRER
ОглавлениеDer Mut war ihm nicht abzusprechen, jenem namenlosen Kölner Kaufmannssohn, der die Machtprobe mit dem mächtigen Erzbischof wagte. Jung, kühn, kraftvoll sei er gewesen, sagt Lampert über ihn aus, „wegen seiner Verwandtschaft wie wegen seiner Verdienste bei den ersten Leuten in der Stadt sehr beliebt und geschätzt“. Kein Angehöriger der Unterschichten, sondern ein allseits wegen seiner Fähigkeit beliebter Mitbürger trat hier hervor, ein informierter und politisch handelnder Kopf. Als sich die Lage am Hafenkai einigermaßen beruhigt hatte, war es dieser junge Mann, der „in seinem wilden Wesen und ermutigt durch den ersten Erfolg“ die Situation zuspitzte. Mit aufrüttelnden Reden lief er durch die Stadt, klagte lauthals über die Unerträglichkeit und Strenge des Stadtherrn, der schon oft „ungerechte Befehle gegeben, Unschuldigen oft das Ihre weggenommen habe und noch angesehene Bürger mit den unverschämtesten Worten angegangen“ sei. Bei seinen Zuhörern musste der Redner nicht lange um Zustimmung bitten, er traf auf offene Ohren, überall diskutierte und debattierte man über die erlittenen Ungerechtigkeiten, schließlich erörterte man auch die „hervorragende und berühmte Tat der Wormser, die ihren Bischof aus der Stadt vertrieben hatten, als der sich unerträglich zu verhalten begonnen hatte“, berichtet Lampert. Es war die Stimmung, aus der Revolutionen geschmiedet werden: „Die Führenden fassen törichte Pläne, das ungezügelte Volk tobt süchtig nach neuen Dingen und ruft in der ganzen Stadt, vom Geist des Teufels besessen, nach Waffen.“ Die Kölner stellten die Machtfrage und waren sich einig – der tyrannische Bischof muss weg.
Mit den Waffen in der Hand eilten die Bürger zum Bischofshof, wo es dann zu den geschilderten Ausschreitungen kam. Die Belagerung des Doms nahm militärische Züge an, mit Belagerungsmaschinen rückte man den festen Mauern zu Leibe. Nachdem bekannt wurde, dass der Erzbischof nach Neuss geflohen sei, brach sich die angestaute Wut in erneuten Gewaltexzessen Bahn und forderte zwei weitere Todesopfer, ein Mann wurde am Stadttor aufgehängt, eine Frau von der Mauer gestürzt. Schon debattierten die aufgebrachten Revolutionäre, ob sie auch die Mönche von Sankt Pantaleon wegen ihrer neumodischen Mönchsregel vertreiben oder die Vorsteherin des Cäcilienstifts, eine Nichte Annos, umbringen sollten, da machte sich gerade noch die Erkenntnis breit, dass es Wichtigeres zu tun gab. Der Erzbischof würde vermutlich nicht kampflos seine Stadt preisgeben, was die Organisation der Verteidigung der Stadt notwendig machte. Rasch verteilten die Bürger Wachtposten auf den Wehrmauern und schickten Boten zum König um Hilfe. Drei Tage der Unsicherheit gingen ins Land, bis den Kölnern vor Augen stand, was ihnen blühte: Anno rückte mit Heeresmacht vor die Tore der Stadt. Im Gegensatz zu seinen Kontrahenten war es ihm gelungen, seine militärische Schlagkraft zu reaktivieren. Auf dem Land hatte der Erzbischof viele Anhänger unter den Bauern, die sich entsetzt zeigten über das „gottlose“ Treiben in der Stadt und ihm ihre Unterstützung anboten. Eine große, bewaffnete Menschenmenge strömte aus dem Umland herbei, um den Bischof in seine angestammten Rechte wieder einzuführen.
In Köln dagegen kam das von den Bürgern angestrebte Bündnis mit dem König nicht zustande. Alleingelassen, mussten sie ihre Kapitulation anbieten. Nachdem Anno ein Hochamt in der vor den Mauern der Stadt liegenden Kirche Sankt Georg gefeiert hatte, nahm er das Bußritual der verängstigten Bürgerschaft an. Barfuß und in wollenem Büßerhemd zogen ihm die Kölner entgegen. Doch beileibe nicht alle. Über 600 der reichsten Kaufleute flohen in der Nacht vor der Rückkehr des Erzbischofs heimlich aus der Stadt, um beim König um Vermittlung in diesem Konflikt zu bitten. Derweil hatte Anno alle Hände voll zu tun, die überkochenden Emotionen in den Griff zu bekommen. Die ihm treu ergebenen Bauern lechzten nach Rache wie nach Beute. Nur mit Mühe konnte er den größten Teil der bewaffneten Menge überreden, nach Hause zurückzukehren. Trotzdem kam es zu wilden Plünderungen, als der Erzbischof mit dem Rest seiner Kriegsknechte in Köln einzog. Häuser wurden gestürmt, Wertsachen gestohlen, Gefangene in Fesseln geschlagen.
Aber auch Annos eigenes Strafgericht nahm sich nicht gerade kleinlich aus. Er verhängte hohe Vermögensstrafen gegen die Aufrührer, sprach den Kirchenbann über sie aus und ließ sie mit Leibesstrafen wie Auspeitschen oder Stockhieben belegen. Die Haupträdelsführer aber, darunter auch der namenlose Kaufmannssohn, wurden geblendet. Selbst der Anno wohlgesonnene Lampert berichtet nur schaudernd über das Strafgericht, das die Stadt beinahe veröden ließ. „Wo deren Straßen kaum die Mengen der Passanten fassten, zeigt sich nun selten ein Mensch. Schweigen und Schrecken lasten auf allen Orten des einstigen Vergnügens und Genusses.“ Selbst der Erzbischof musste einsehen, dass solche harschen Strafen nichts brachten und die Stadt nur wirtschaftlich schädigten. Kurz vor seinem Tod am 4. Dezember 1075 lenkte er, wie es ihm König Heinrich nahegelegt hatte, ein, söhnte sich mit den Bürgern aus, erließ ihnen ihre Strafen und erstattete ihnen ihr Vermögen zurück. Über das Schicksal des geblendeten Kaufmannssohnes ist dagegen nichts mehr zu erfahren, die Quellen hielten ihn nicht mehr für erwähnenswert.