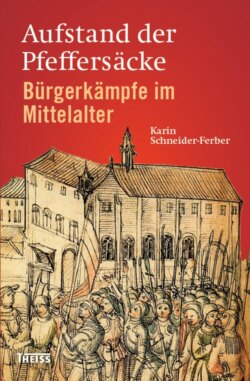Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SELBSTBEWUSSTE BÜRGER
ОглавлениеMit steigendem wirtschaftlichem Wohlstand wuchs auch das Selbstbewusstsein der Leipziger Bürger. Langsam, aber sicher, begannen sie, die Herrschaft ihres Stadtherrn abzuschütteln. Der wohlwollende Markgraf Dietrich von Landsberg gestand 1263 der Stadt zu, nicht mehr vor dem Gericht seines Vogtes, der die Hochgerichtsbarkeit ausübte, erscheinen zu müssen, sondern dass sie allein vor dem Schultheiß und den ihn beratenden Bürgern ihr Recht suchen sollten. Berufungen waren direkt an ihn selbst, den Landesherrn, zu richten. „Wenn jemand Klage vor dem Schultheißen und den Bürgern nicht klären kann, soll er sie vor uns selbst bringen, und wir werden ihm ein gerechtes Urteil sprechen“, verfügte Dietrich. Damit erloschen die Rechte des bislang ranghöchsten markgräflichen Amtsträgers, des Vogtes, in der Stadt, der nun nur noch für das Umland zuständig war. Die Herren von Schkeuditz, die die Vogtei erblich in ihrer Familie weitergegeben hatten, mussten sich diesem Machtverlust fügen. Damit bekamen die Leipziger das wichtige Amt der Rechtsprechung weitestgehend in die eigenen Hände, denn der Schultheiß war zwar ebenfalls ein markgräflicher „Beamter“, hatte sich aber mit den Bürgern, den „cives“, wie sie in der Urkunde bezeichnet werden, zu beraten.
In diesen „cives“ darf man wohl zu Recht die Vorläufer der Ratsherren sehen, da auch in anderen Städten Schöffenkollegien und beratende Gerichtsgremien als Keimzellen der Ratsverfassung anzusprechen sind. 1270 werden die Leipziger Ratsherren in einer weiteren Urkunde dann als solche erstmals auch so bezeichnet. Markgraf Dietrich erteilt darin dem „Schultheißen Symon und den 12 Ratsherren“ die Erlaubnis, „jeden Einheimischen oder Fremden ohne Ausnahme (…), der die Ordnung der Stadt übertritt oder sich ihnen widersetzt (…), festzunehmen oder zur strengeren Bestrafung vor uns selbst zu bringen“. Damit wurde der Rat zum Hüter des Stadtfriedens, dem es oblag, eigene Gesetze zu erlassen und deren Einhaltung zu kontrollieren. Für Ruhestörer konnte er Stadtverweisungen aussprechen. Das weite Feld der Marktaufsicht, der Beglaubigung von Immobiliengeschäften, Erb- und Vormundschaftsfällen eröffnete dem Rat einen großen Spielraum bei der Verwaltung der Stadt.
Die Kommune konnte nun selbst Rechtsgeschäfte beglaubigen, Urkunden ausstellen und besiegeln. So erteilten die Ratsherren 1287 dem Nonnenkloster Sankt Georg die Erlaubnis, eine Mühle und einen Mühlengraben zu errichten, und bestätigten die Urkunde mit einem eigenen Stadtsiegel. Das große und besonders sorgfältig gestaltete Siegel zeigt, wie stolz und selbstbewusst die Leipziger Bürger in der Zwischenzeit auftraten: Es stellt eine mächtige, zinnenbekrönte Stadtmauer mit Tor dar, hinter der sich die Silhouette einer turmreichen Kirche erhebt, in der man vielleicht ein idealisiertes Abbild der Nikolaikirche sehen kann. „Siegel der Bürger von Leipzig“ vermeldet die Umschrift des Siegelbildes. Der Rat ließ erkennen, dass er sich bei der inneren Verwaltung der Stadt vom Markgrafen und seiner Vertreter nicht mehr hineinreden lassen ließ. Wer Urkunden ausstellte und verwahren musste, brauchte verständlicherweise auch Räumlichkeiten für die Kanzlei und das Archiv. Vermutlich besaß Leipzig zu dieser Zeit bereits ein Rathaus, dessen genaue Lage und Aussehen allerdings umstritten sind. Vermutlich ist es im romanischen Vorgängerbau des heutigen Alten Rathauses zu suchen, von dem nur ein kleines Zwillingsfenster, das in den jüngeren Bau integriert wurde, den Zahn der Zeit überdauert hat. Aber auch eine Lage im Bereich der Nikolaikirche wäre möglich.
Doch auch dem Schultheißen gewährten die Leipziger Stadtväter kein langes Überleben. Seit 1301 stellte der Rat seine Urkunden ohne Mitwirkung des Schultheißen aus, der nun auf den Bereich der Hochgerichtsbarkeit abgedrängt wurde. Die Stadt kaufte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts den wettinischen Landesherren dann aber auch diese hoheitliche Aufgabe gegen eine erkleckliche Geldsumme ab, sodass sie die Rechtsprechung völlig allein in Anspruch nahm. Mit der Verdrängung des Schultheißen tauchte an der Spitze der Kommune ein neuer Repräsentant auf, der Bürgermeister, der erstmals 1292 genannt wird. Der Rat bestand in der Regel aus zwölf Mitgliedern und wechselte im jährlichen Turnus. Es gab zunächst zwei Ratskollegien, ab dem 14. Jahrhundert drei Kollegien, die sich zu einem festen, zwischen November und Januar liegenden Termin in der Amtsführung abwechselten, wobei einige Ratsmitglieder in den jeweils neuen Rat übernommen wurden, um die Kontinuität der Stadtpolitik zu garantieren und die zeitlichen und finanziellen Belastungen der Ratsherren durch die Amtsführung zu begrenzen. Wie in anderen Städten auch, besetzten die führenden Familien Leipzigs die Ratsposten, wenn auch die Oberschicht durchlässiger war als andernorts. Das ständisch nicht so stark abgeschlossene Leipziger Patriziat ermöglichte es reichen, zugewanderten Kaufleuten, leichter in die städtische Führungsriege aufzusteigen und an der Macht zu partizipieren, was der Stadt innere Konflikte im krisengeschüttelten 14./15. Jahrhundert weitgehend ersparte. Reiche Schenkungen und Stiftungen wie die der Familien Spielmann, Bec, de Grimmis oder de Lubnize, die teilweise über beträchtlichen Grundbesitz im Umland verfügten, künden vom Aufstieg einzelner Leipziger Bürgerfamilien.
Ein besonderer Erfolg für die Stadt war der Erwerb der Leipziger Münzstätte im Jahr 1273. „Auf großes Drängen der Bürgerschaft von Leipzig“, berichtet die darüber ausgestellte Urkunde, vergebe Dietrich von Landsberg die von Otto dem Reichen begründete Münzstätte der Stadtgemeinde „zu dauerndem Besitz“. Der bisherige Pächter wurde abgefunden. Die weitreichende Entscheidung, die der Stadt die Münze nicht nur für einen begrenzten Zeitraum, sondern auf Dauer überließ, schränkte die Rechte des Stadtherrn in seiner eigenen Gründung erneut erheblich ein. Die Leipziger halfen der markgräflichen Entscheidungsfreude mit der stattlichen Summe von 100 Mark Silber nach – ein Angebot, das der Markgraf offenbar nicht ausschlagen konnte.
Innerhalb eines Jahrhunderts hatte es die Handelsstadt damit geschafft, sich aus der Dominanz der wettinischen Landesherrschaft zu lösen und ein hohes Maß an städtischer Selbstverwaltung zu erreichen. Mit Ratsherrschaft, Bürgermeisteramt, einem Rathaus, Siegel und einer Münzstätte stand Leipzig an der Spitze der Verfassungsentwicklung wie sie auch für Freie Städte und Reichsstädte kennzeichnend war. Der ökonomischen Vormachtstellung folgte die politische in diesem Fall (fast) von alleine, auch wenn formal die Wettiner noch das Sagen hatten. Die direkte Konfrontation mit dem Stadtherrn mieden die Leipziger seit ihren Erfahrungen von 1215/16. Ihre Methoden bestanden vielmehr im hartnäckigen Suchen nach dem Kompromiss, dem beharrlichen Pochen auf Selbstverwaltung und dem cleveren Einsatz ihrer finanziellen Mittel. Was die Markgrafen nicht von selbst herausrückten, kauften sie ihnen gegen Geldzahlung ab.