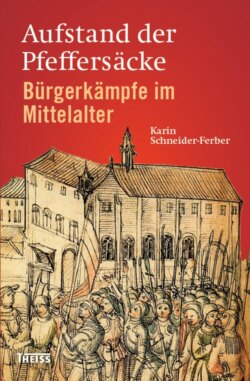Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SINNBILD DER MACHT UND DER WEHRHAFTIGKEIT – DAS KÖLNER DREIGESTIRN
ОглавлениеSie gehören zum Kölner Karneval wie der Dom zum Stadtbild: die „Lokalmatadore“ Prinz, Bauer und Jungfrau, die als „Kölner Dreigestirn“ Weltruhm genießen. Sie fehlen in keiner Karnevalssaison und ziehen als „Stars“ im Rosenmontagszug mit. Dabei haben die drei Figuren, die erst seit dem 19. Jahrhundert im Fastnachtstreiben auftauchen, eine tiefere Bedeutung. Prinz Karneval personifiziert zwar die närrische Zeit insgesamt, erinnert aber in seiner Kleidung, die der burgundischen Hoftracht der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entlehnt ist, an den kaiserlichen Stadtherrn, dem sich das stolze Köln seit dem Spätmittelalter allein unterzuordnen bereit war. Auf ihren Status als Reichsstadt war Köln von jeher besonders stolz. Der Bauer dagegen repräsentiert mit seinem Attribut, dem Dreschflegel, die Wehrhaftigkeit der Stadt. Er erinnert an die glorreich gewonnene Schlacht von Worringen (1288), als ein kölnisches Kontingent an der Seite des Herzogs von Brabant im limburgischen Erbfolgestreit dem Kölner Erzbischof und seinen Verbündeten eine schwere Niederlage bereitet und damit de facto das Ende der bischöflichen Stadtherrschaft eingeleitet hatte. „Seine Deftigkeit“, der Bauer, trägt daher als stattlicher Treuhänder an seinem Gürtel die Stadtschlüssel. Die 125 Pfauenfedern auf seinem prächtigen Hut stehen für die Unsterblichkeit der Stadt Köln. Nicht zuletzt nimmt die Figur Bezug auf Kölns Zugehörigkeit zur Reichsbauernschaft. Denn Köln zählte an der Seite von Konstanz, Regensburg und Salzburg zu den vier Bauernschaften des Reiches. Die Jungfrau wiederum weist mit ihrer Mauerkrone auf dem Haupt auf die Unbesiegbarkeit Kölns hin. Die nie eroberte Jungfrau – traditionell stets dargestellt von einem Mann – stellt über ihre Kleidung auch eine Verbindung zur antiken Frühzeit der Stadt her. Ihr römische Reminiszenzen aufnehmendes Gewand erinnert an die römische Kaiserin Agrippina die Jüngere, die gemeinhin als Stadtgründerin gilt.
Traten die heute so geläufigen Karnevalsfiguren erst seit 1883 als feste Einheit auf, so reichen die Wurzeln des Kölner Karnevals bis ins Mittelalter zurück. 1341 berichten die Quellen erstmals von einem „Fastelovend“. Mehrmals mussten sich die Ratsherren im Verlaufe des 14. Jahrhunderts eidlich verpflichten, keine öffentlichen Gelder für das Fastnachtstreiben zur Verfügung zu stellen, was offenbar aber niemanden davon abgehalten hat, an den närrischen Tagen vor Beginn der österlichen Fastenzeit seinen Mummenschanz auf der Straße abzuhalten. Immer wieder sah sich der Rat der Stadt genötigt, gegen das tolle Treiben einzuschreiten, bei dem es hin und wieder zu gefährlichen Ausschreitungen und sogar tödlichen Messerstechereien kam. Trotz aller Vermummungsverbote ließen sich die Kölner ihren Spaß jedoch nicht verderben. 1482 ging der Gürtelmacher Johann Hemmersbach aber doch zu weit: Er besetzte mit seinen Zunftgenossen das Rathaus, nahm die Bürgermeister und Ratsherren fest, sperrte sie in den Turm und stolzierte für die nächsten beiden Tage als Herr des Hauses durch die Ratsstuben. Am Aschermittwoch war der Spuk dann rasch vorbei – die Zunftgenossen zogen vom Rathaus ab und Hemmersbach landete auf dem Henkersblock. Das Bedürfnis, es der Obrigkeit im Schutz der Narrenmaske einmal so richtig zu zeigen, hat sich indes bis in die Moderne gehalten. In der „fünften Jahreszeit“ ist es bis heute erlaubt, den Politikbetrieb mitsamt seinem Führungspersonal ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Der Kölner Karneval gehört zu den beliebtesten Volksfesten in Deutschland überhaupt.