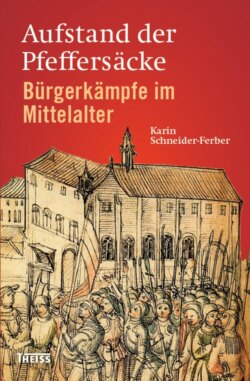Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die „wehrhafte Jungfrau“ am Rhein
Köln und seine rebellische Bürgerschaft EIN OSTERFEST OHNE FRIEDEN
ОглавлениеIm Bischofshof zu Köln hatte sich im April des Jahres 1074 eine illustre Gesellschaft versammelt. Das festliche Abendmahl, das Erzbischof Anno II. von Köln zu Ehren seines langjährigen Freundes, des Bischofs von Münster, in seiner Residenz ausrichtete, hätte der krönende Abschluss der gemeinsam gefeierten Ostertage werden sollen. Ein Galadiner vom Feinsten mit edlen Speisen und wertvollen Weinen, sorgenfrei und ungestört. Doch das prunkvolle Fest endete jäh im Desaster: Plötzlich sah sich der Erzbischof einem Ausbruch des Volkszorns ausgesetzt, mit dem er nie und nimmer gerechnet hätte. Aufgebrachte Kölner Bürger stürmten den Hof: „Als nun nach dem Mittag, als sich der Tag schon zum Abend wendete, zum Zorn – wie Öl zum Feuer – die Trunkenheit hinzukam, stürzen sie aus allen Teilen der Stadt zum Hof des Bischofs und greifen ihn, der an einem belebten Platz mit dem Bischof von Münster speist, an, schleudern Geschosse, werfen Steine, töten einige, die ihm beistehen, schlagen und verwunden die übrigen und treiben sie in die Flucht“, berichtet der zeitgenössische Chronist Lampert von Hersfeld über das unerhörte Geschehen.
„Den Erzbischof konnten die Seinen aus dem Heerhaufen der Feinde und unter der Wolke der Geschosse mit Müh und Not unversehrt in die Kirche des heiligen Petrus fortreißen, und sie festigten die Türen nicht nur durch Riegel und Balken, sondern auch durch herbeigewälzte große Felsen“, so Lampert von Hersfeld über den weiteren Verlauf des Tumults. Das hatte es noch nie gegeben: Der Erzbischof als Gefangener im eigenen Dom, die städtische Einwohnerschaft im Aufstand gegen den Stadtherrn! Aber es kam noch schlimmer: Während sich Anno im Dom verschanzte, tobte draußen der Volkszorn. Wütend und brüllend, so Lampert in seinen Annalen weiter, stürmten die Kölner den Bischofspalast, brachen die Türen auf, verwüsteten den Weinkeller, plünderten die Schatzkammern und die Kapelle des Erzbischofs, raubten dabei liturgische Gewänder und Altargefäße. Doch nach Lamperts Einschätzung war es nicht die Gier, die das Volk zu dieser Zerstörungswut trieb, sondern sein „unbeugsamer Hass“ auf den Erzbischof und dessen Stadtregiment. Als der Mob einen Unbeteiligten aufgriff, „der sich vor Furcht in der Ecke verbirgt“, kam es zu einem Fall von Lynchjustiz. „Im Glauben, es sei der Erzbischof, töten sie ihn, nicht ohne sich zu beglückwünschen, dass sie endlich der frechen Rede ein Ende gesetzt hätten.“ Nachdem sie ihren Irrtum bemerkt hatten, stürmten die Aufrührer zum Dom und „strengen sich mit größter Mühe an, die Mauern zu zerbrechen, und drohen auch, falls der Erzbischof ihnen nicht schnellstens ausgeliefert werde, Feuer anzulegen“.
Der in vielen Details durch den Benediktinermönch Lampert von Hersfeld überlieferte Aufstand zeigte unverkennbar politische Züge, auch wenn es sich um eine spontane Erhebung handelte. Keine wütende Soldateska stürmte den Kölner Domhof, keine beutegierige Horde Mittelloser plünderte die bischöflichen Gemächer, sondern aufgebrachte Kölner Kaufleute und Handwerker, die sich am selbstherrlichen Auftreten des Erzbischofs stießen und seine in ihren Augen ungerechtfertigten Forderungen zurückwiesen. Die „frechen Reden“ des Erzbischofs und sein unerträgliches Benehmen waren zum Auslöser für die Rebellion geworden. Wenige Stunden zuvor hatte Anno auf der Suche nach einer passenden Rückfahrtmöglichkeit für seinen Gast, Bischof Friedrich von Münster, ein Kölner Kaufmannsschiff beschlagnahmen lassen, das gerade im Rheinhafen für eine Handelsfahrt fertig gemacht worden war. Kurzerhand schickte der Erzbischof seine Knechte aus, um die Waren des Schiffes auszuladen und die Räumlichkeiten für den bischöflichen Freund vorzubereiten. Doch die Kaufmannsgehilfen, die die Fracht bewachten, weigerten sich standhaft, das Feld zu räumen, und informierten schließlich den erwachsenen Sohn des Kaufmanns. Dieser eilte mit einer Schar junger Leute herbei und vertrieb Annos Knechte in einem wilden Handgemenge, selbst den herbeigeeilten Stadtvogt, einen der höchsten erzbischöflichen Amtsträger, schlug er in die Flucht. Die Auseinandersetzung drohte schon in einen Straßenkampf zu entarten, als es den vom Erzbischof gesandten Vermittlern in letzter Minute gelang, die Gemüter zu beruhigen. Allerdings nur für kurze Zeit.
Annos unmäßiger Zorn und seine wüsten Racheandrohungen provozierten das erneute Aufflammen des Aufstands am frühen Abend, das in dem beispiellosen Gewaltausbruch im Hof der bischöflichen Residenz endete. Dass es den Kölnern gezielt um die Person des Erzbischofs ging, machten sie klar, als sie die Auslieferung Annos vor dem Dom forderten. „Als jene, die sich im Innern befanden, sahen, dass der Sinn des Volkes hartnäckig auf seinen (Annos) Tod zielte, und die Leute nicht nur von Trunkenheit, die mit der Zeit zu vergehen pflegt, sondern auch von unbeugsamem Hass und fanatischer Wut getrieben wurden, rieten sie ihm, er möge in Verkleidung sein Heil in der Flucht aus der Kirche und die Belagerer zu täuschen suchen“, berichtet Lampert weiter. Ausgerechnet der Kölner Erzbischof, einer der mächtigsten Männer im Reich, sah sich plötzlich in die Verliererrolle gedrängt. In einer waghalsigen Nacht-und-Nebel-Aktion floh er dann tatsächlich unerkannt aus der Kirche in den Schlafsaal des Domstiftes und von dort über einen Innenhof in das Haus eines Kanonikers, das direkt an der Stadtmauer lag. Hier rettete er sich durch eine kleine Hintertür, die kurz zuvor dort in die Mauer gebrochen worden war, ins Freie, wo einige Unterstützer schon mit Pferden auf ihn warteten. Verschämt stahl sich der Stadtherr so aus seiner eigenen Stadt.
Die Auseinandersetzung zwischen dem namenlosen Kölner Kaufmannssohn und dem mächtigen Erzbischof Anno bedeutete im 11. Jahrhundert mehr als nur einen handfesten Skandal. Noch nie war der Machtanspruch eines Stadtherrn vonseiten der Beherrschten so direkt und handgreiflich infrage gestellt worden. Der fromme Lampert von Hersfeld, der um 1078 seine Annalen zu schreiben begann, missbilligte das Vorgehen der Städter als groben Unfug, der sich gegen die göttliche Ordnung richte. Andere Autoren der Epoche wie der Abt Guibert von Nogent oder der Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux, die größte moralische Autorität seiner Zeit, taten es ihm nach und verurteilten ebenfalls mit harschen Worten die frühen kommunalen Bewegungen, in denen sie nur Aufruhr und Gottlosigkeit sahen. Den überwiegend aus adligen Kreisen stammenden geistlichen Autoren erschienen die Veränderungen im Sozialgefüge, die sich im 11. Jahrhundert abzuzeichnen begannen, als unerhörte Neuerungen, die die althergebrachte Weltordnung ins Wanken brachten.
Das Lehnssystem mit seinen vielfältigen, auf persönlichen Abhängigkeiten beruhenden Bindungen hatte der Gesellschaft bislang einen Rahmen gegeben, in dem jedes Individuum seinen festgefügten Platz einnahm. Der schollengebundene Bauer fügte sich unter die Herrschaft seines Grundherrn, der Grundbesitzer stand in Abhängigkeit zu seinem Lehnsherrn, selbst der vornehmste Vasall beugte vor dem König die Knie. Doch mit der günstigen demografischen Entwicklung des Früh- und Hochmittelalters und dem dadurch bedingten Anwachsen der Städte schoben sich die von Handel und Handwerk lebenden Städter wie ein Fremdköper unter die altbewährte feudale Ordnung. Die vielfältigen Belastungen an Abgaben, Frondiensten und Ehebeschränkungen, die in der ländlichen Grundherrschaft noch Sinn machten, verloren innerhalb der Stadtmauern an Bedeutung und wurden vielfach nur noch als drückende Ungerechtigkeit empfunden. Für einen aus eigener Kraft zu Wohlstand gekommenen Händler oder Handwerker waren Formen der persönlichen Abhängigkeit nur mehr schwer erträglich und er tat, was „Wutbürger“ zu allen Zeiten taten: Er ging auf die Barrikaden.