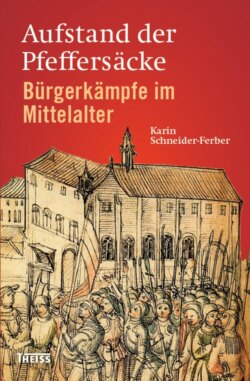Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AUFSTIEG DER „PFEFFERSÄCKE“
ОглавлениеSie heißen Godefridus und Ripertus, die ersten namentlich bekannten Kaufleute der Stadt Leipzig, die in einer Urkunde 1218 erwähnt werden. Damit erfolgte die Nennung von Kaufleuten für die Stadt, die schon seit ihrer Gründung dank ihrer verkehrsgünstigen Lage vom Handel- und Markttreiben lebte, relativ spät. Doch die Quellenarmut sagt nichts über die Bedeutung des Handels für den Aufstieg Leipzigs aus. Zweifelsohne lag die Stadt wie ein goldener Apfel inmitten eines prosperierenden Umlandes. Die Bevölkerungszahl nahm durch die rege Siedlungstätigkeit in der Markgrafschaft stetig zu und sorgte für ein gehöriges Anwachsen der landwirtschaftlichen Produktion. Das in Freiberg geförderte Silber entwickelte sich zu einem gefragten Exportschlager, der seinen Weg nach Köln, Italien und auf die Messen der Champagne fand und für hochwertige Artikel wie flandrisches Tuch eingetauscht werden konnte. An Handelswaren hatte es im aufblühenden Leipzig folglich keinen Mangel. Wie sehr die Stadt auf den Nah- wie Fernhandel ausgerichtet war, zeigte schon ihre Anlage, denn die wichtigsten Verkehrsadern, die Via regia und die Via imperii, führten mitten durch sie hindurch. Die Via regia erreichte das Stadtzentrum durch das später sogenannte Ranstädter bzw. das Grimmaische Tor, von Norden kommend gelangte die Reichsstraße durch das Hallesche Tor zur Stadt, um sie in südlicher Richtung durch das Peterstor wieder zu verlassen. Ein erster Straßenmarkt befand sich vermutlich schon zu Füßen der alten Hauptburg, bevor dann bei der Stadtgründung ein Neumarkt vor der Nikolaikirche dazukam. Der heutige großzügige Markt vor dem Rathaus wurde mit steigendem Platzbedarf Ende des 13. Jahrhunderts im Schnittpunkt der Stadtanlage angelegt. Wie eine hebräische Quelle aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts berichtet, besuchten auch jüdische Kaufleute, die traditionellerweise eng mit dem Fernhandel verbunden waren, den Leipziger Markt und trafen dort sogar auf Mitglieder einer in der Stadt lebenden jüdischen Gemeinde.
Archäologisch gesichert ist das Wachsen der Stadt im Laufe des 13. Jahrhunderts. Die einzelnen Siedlungszellen wuchsen allmählich zusammen, bis etwa um 1300 ein geschlossenes Stadtensemble entstanden war. Von den in diesem Zeitraum überlieferten rund 100 Personennamen deuten viele auf eine rege Zuwanderung aus dem näheren Umland hin. Leipzigs Neubürger kamen häufig aus Eilenburg, Wurzen oder Roßwein, aus Pegau, Halle oder Jena, seltener aus weit entfernten Gegenden wie Bayern oder Paris. Entsprechend der Zuwanderung wuchsen Gewerbe und Handwerk. Kürschner, Leineweber, Bäcker, Färber und Seiler werden als erste Handwerksberufe in den Quellen genannt, die bis zur Wende zum 14. Jahrhundert auch Zünfte bildeten. Der einsetzende „Bauboom“ in der rasch wachsenden Stadt dürfte ebenfalls so manchem Neuankömmling das tägliche Brot gesichert haben. Neben den notwendigen Häuserbauten für die Zuwanderer sorgten kirchliche Prachtbauten wie die von Sankt Nikolai und Sankt Thomas sowie die großen Klosterbauten der Franziskaner und Dominikaner innerhalb des Stadtgebiets sowie der Zisterzienserinnen vor den Toren der Stadt für genügend Beschäftigung. Der Bau großer Pfarr- und Klosterkirchen hielt Zimmerleute, Maurer, Fuhrleute oft über Jahre hinweg in Lohn und Stellung. Insgesamt dürfte die Einwohnerzahl bis 1300 auf etwa 3000 Personen gestiegen sein.
Die Markgrafen begleiteten die Entstehung des Leipziger Handels mit fördernder Hand. Schon bei der Stadtgründung verfügte Otto der Reiche den Schutz des Leipziger Marktes vor unliebsamer Konkurrenz im Umkreis von 15 Kilometern und wies seinen Vogt an, nicht bezahlte Waren mit einer Lösungsfrist von 14 Tagen zu pfänden. Auch die Zusicherung des Markgrafen, den Bürgern bei Eigentumsklagen zu ihrem Recht zu verhelfen, diente dem Aufbau und dem Schutz eines geregelten Marktlebens. Ottos Enkel, Dietrich von Landsberg, setzte die wirtschaftsfreundliche Politik seiner Vorfahren fort und bekräftigte in einer Urkunde 1268, „dass alle Kaufleute, woher sie auch kommen mögen, wenn sie Kaufmannswaren in unserer Stadt kaufen oder verkaufen wollen“, seinen vollen Schutz genössen, und zwar auch dann, „wenn wir mit den Landesherren dieser Kaufleute in offener Fehde liegen“. Die Sicherheit auf Leipzigs Straßen und der Schutz fremder Händler und ihrer Waren gehörten zu den unabdingbaren Voraussetzungen für das Gedeihen des Wirtschaftslebens. Ohne Rechtssicherheit kein Wirtschaftswachstum – das wussten schon die Meißener Markgrafen. Die Urkunde beweist nicht zuletzt, dass Leipzig in dieser Zeit bereits zu einem überregional bedeutenden Handelsplatz aufgestiegen war und vom Fernhandelsgeschäft zunehmend profitierte.
Im 15. Jahrhundert ließen sich dann immer mehr Kaufleute in der Stadt nieder, die im Handels- und Geldgeschäft tätig waren und ihren Reichtum mit Spekulationen im Bergbau anhäuften. Vor allem Nürnberger Kaufleute wählten die Stadt als geeigneten Ausgangspunkt für ihre Geschäfte mit Polen und Schlesien. Und auch die neuen Silberfunde in Schneeberg/Erzgebirge versprachen hohe Renditen. Damit wuchs Leipzig endgültig aus dem Bereich des wettinischen Territorialstaates hinaus und stieg zu einem europaweit bedeutenden Messeplatz auf. Kaiser Maximilian I. verlieh der Stadt am Ende des Mittelalters, 1497 und 1507, zwei große Messeprivilegien, in denen er die Leipziger Jahrmärkte zu Ostern, Michaelis (Herbst) und Neujahr ausdrücklich bestätigte und unter Reichsschutz stellte. Der Kaiser verbot die Errichtung neuer Märkte im gesamten weiteren Umland, in den Bistümern Magdeburg, Halberstadt, Meißen, Merseburg und Naumburg unter Androhung einer Strafzahlung von 50 Mark lötigen Goldes. 1507 definierte er das Verbot noch genauer, schaltete den Erfurter Markt aus und untersagte die Einrichtung von Jahrmärkten im Umkreis von 115 Kilometern! Gleichzeitig wurde strenger Marktfrieden verordnet: Das Sperren von Straßen und die Beschlagnahmung von Handelsgut wurde als Landfriedensbruch gewertet und mit der Reichsacht bestraft. Erstmals tauchte in dieser Urkunde das Wort „Messe“ für die Leipziger Märkte auf. Der so ausgezeichnete und in besonderer Weise geschützte Leipziger Handel konnte ungehindert wachsen: Die Stadt wurde zum Umschlagplatz für besonders wertvolle Güter wie Metalle, Tuche, Seide, Pelze, Weine, Gewürze, Keramik und Farben. In der Neuzeit gewann Leipzig Bedeutung durch seine Buchmesse.