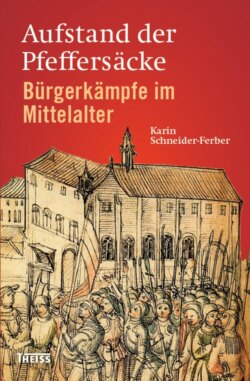Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BÜRGER IM AUFRUHR
ОглавлениеWoche für Woche demonstrierten sie friedlich – für den Erhalt ihres alten Bahnhofs und gegen die Abholzung der Bäume im Schlossgarten. An den Montagsdemonstrationen gegen den neuen Tiefbahnhof „Stuttgart 21“ nahmen ab November 2009 anfangs einige Tausend, später sogar einige Zehntausend Bürger teil, unter ihnen viele, die sich noch nie zuvor an Protestaktionen beteiligt hatten. Doch am 30. September 2010 eskalierte die Lage in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern ging ein Großaufgebot der Polizei gegen die demonstrierenden Bürger vor, die den Abriss der ersten 25 Bäume verhindern wollten. Am Ende gab es 114 Verletzte, 16 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, vier Menschen erlitten schwere Augenverletzungen. Einen Tag später, am 1. Oktober 2010, demonstrierten 100.000 aufgebrachte Bürger gegen das geplante Großprojekt.
„Wutbürger“ wurden sie genannt, die Menschen, die nicht nur in Stuttgart, sondern überall in der Bundesrepublik gegen derartige Großprojekte aufstanden und gegen Entscheidungen der politisch Verantwortlichen rebellierten. Sie misstrauten der Obrigkeit, forderten mehr Transparenz und mehr Teilhabe, sie wollten mitreden und mitentscheiden und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Das Wort traf die politische Stimmung, die Gesellschaft für deutsche Sprache kürte „Wutbürger“ zum „Wort des Jahres 2010“. Es dokumentiere „ein großes Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger, über Wahlentscheidungen hinaus ein Mitspracherecht bei gesellschaftlich und politisch relevanten Projekten zu haben“, hieß es in der Begründung der Jury.
Ein neuer gesellschaftlicher Trend? Von wegen. Zornerfüllt und waffenklirrend, lärmend und gewaltbereit – so standen aufgebrachte Bürger schon in den mittelalterlichen Städten vor ihrer Obrigkeit. Ein Bannerlauf mitten im Zentrum der Stadt verhieß auch damals nichts Gutes, vor allem nicht für diejenigen, die an den Schalthebeln der Macht saßen: für Ratsherren, Bischöfe und Landesherren. Vor nichts fürchtete sich die Obrigkeit mehr als vor „Auflauf“, „Sammlung“, „Unmut“ und „Zwietracht“ unter der Stadtbevölkerung, wie das zeitgenössische Vokabular dafür lautete. Denn dann drohte in jedem Fall Ungemach: Vom Ämterverlust bis hin zum Todesurteil konnte die Palette der „Bestrafung“ durch den Volkszorn reichen. Der mittelalterliche Stadtbürger gab keine pflegeleichte Klientel für die Regierenden ab. Nach einer ungefähren Schätzung kam es zwischen 1301 und 1550 in über 100 Städten des Reiches zu rund 210 Bürgerunruhen.
So vielfältig der Verlauf der Aufstände, so unterschiedlich fielen ihre Beweggründe aus. Zu meckern gab es jedenfalls in einer hoch- und spätmittelalterlichen Stadt nicht weniger als heute: Ungerechte Steuerlasten, Geldverschwendung und Amtsmissbrauch, Krieg- und Fehdeführung zum Nachteil der Stadt, willkürliche Rechtsprechung, mangelnde Kontrolle der Entscheidungsgremien, so lauteten die Vorwürfe. Die Rezepte dagegen klingen überraschend modern: mehr Bürgerbeteiligung in der Politik, mehr Transparenz in Steuer- und Finanzverwaltung, stärkere Kontrolle der Regierung. Ging es in einer frühen Phase der Stadtentwicklung noch darum, den Einfluss der geistlichen oder weltlichen Stadtherren einzudämmen und die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, regte sich ab dem 14. Jahrhundert zunehmend die innerstädtische Opposition der Handwerker und Gewerbetreibenden, die sich gegen die Herrschaft der Ratsgeschlechter einen Platz an der Sonne reservieren wollten.
Dabei entwickelten die Bürger ein recht beachtliches Repertoire an Konflikt- und Schlichtungsritualen. Dem bewaffneten Auflauf vor dem Rathaus folgte in der Regel die Bildung eines Ausschusses der Bürgergemeinde, der die Beschwerden der Obrigkeit vortrug und die Übergabe der Insignien der Macht – Siegel, Stadtkasse, Torschlüssel, Sturmglocke, Stadtbanner und Rechtsbuch – verlangte. Konnten sich die Streitenden gütlich einigen, kam es zu einem Kompromiss, einer Neufassung der Stadtverfassung, der schriftlich niedergelegt und beeidet, zuweilen auch an jährlich zu wiederholenden Schwörtagen bekräftigt wurde. Ließ sich eine friedliche Einigung nicht erzielen, drohten die Aufstände jedoch rasch in blutige Aktionen umzukippen. Der Bürger in Waffen, dessen vornehmste Bürgerpflicht der Schutz und die Verteidigung der Stadt war, bedeutete eine ständige Bedrohung für die Mächtigen. Der Harnisch war rasch angelegt, Spieß und Schwert schnell ergriffen und das Zunftbanner aus dem Zunfthaus geholt, wenn es darum ging, den Rat das Fürchten zu lehren.
„Gesellschaftliche Elite ärgert sich häufiger“, lautete das überraschende Ergebnis einer Langzeitstudie der Freien Universität Berlin und des sozio-ökonomischen Panels (SOEP) im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die im Oktober 2012 veröffentlicht wurde. Demnach ärgerte sich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Elite des Landes weitaus stärker als andere gesellschaftliche Gruppen wie z.B. Arbeitslose. Ärger, so die Analyse der Wissenschaftler, würde in mittleren und hohen Bildungsschichten häufiger empfunden als in sogenannten bildungsfernen Schichten. Dieser Befund könnte praktisch wortgleich auf die mittelalterliche Gesellschaft übertragen werden. Denn auch hier ärgerten sich die wohlhabenden Schichten weitaus stärker als das große Heer der Stadtarmen, das allein mit Existenznöten beschäftigt war. Bei den Stadtunruhen handelte es sich keineswegs um soziale Revolutionen, die grundlegende Änderungen der Besitzverhältnisse und einen völligen Umsturz der Verfassungsordnung angestrebt hätten, sondern um ein heftiges Aufbegehren wohlhabender Kaufleute- und Handwerkerkreise, die unter Beibehaltung der traditionellen Stadtverfassung mehr Mitsprache im Stadtregiment forderten. Ihnen ging es um die Pfründen der Macht, nicht um eine neue Gesellschaftsordnung. So treten als handelnde Akteure nicht etwa Angehörige der Unterschichten hervor, sondern reiche Händler und Handwerker aus der Mittel- und Oberschicht. Ihre Namen sind längst vergessen, sofern sie die mittelalterlichen Chronisten überhaupt überlieferten. Trotzdem verdankt die Nachwelt ihnen eine gehörige Portion dessen, was man heute als Zivilcourage umschreiben würde: Ein mutiges Eintreten für die eigenen Belange, ein offenes Widerwort den Mächtigen gegenüber, ein wacher Sinn für Ungerechtigkeiten, ein streitbares Auftreten in der Sache bei gleichzeitiger Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft.
So keimten in den Städten neue Tugenden, die der feudalen Welt eigentlich entgegengesetzt waren. Persönliche Freiheit statt Leibeigenschaft, Mitbestimmung statt vasallischer Unterordnung, Aufstiegsmöglichkeit durch Reichtum statt geburtsständischer Hierarchie. Kein Wunder, wenn selbst Könige und Kaiser das gewachsene Selbstbewusstsein der Städte und ihrer Bewohner fürchteten. Insbesondere, wenn sich Städte zusammenschlossen und gemeinsame Ziele verfolgten – wie bei den Städtebünden und der Hanse der Fall –, konnten sie zu einem bedeutenden politischen Faktor neben Kaiser und Fürsten aufsteigen. Die Städte ließen sich nicht mehr so leicht überstimmen, sie verschafften sich mit ihrer Wirtschaftskraft und ihren Söldnerheeren Gehör. Als eigenständige politische Gebilde überlebten manche Reichsstädte bis ins 19. Jahrhundert.
Neun Städte – zehn Ereignisse. Exemplarisch für die vielen Aufstände in deutschen Städten des Mittelalters sind in diesem Buch zehn Bürgerunruhen vorgestellt, die in Verlauf und Ergebnis ganz unterschiedlich ausfallen, aber das volle Potenzial des widerborstigen Bürgers aufzeigen. Ob in Köln, in Worms, in Erfurt oder Augsburg – die Bürger auf den Barrikaden kämpften für ihre Rechte und lieferten damit das Urbild aller Wutbürger.