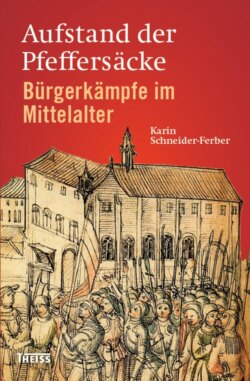Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINE FOLGENREICHE KLOSTERGRÜNDUNG
ОглавлениеWie sein Vater zeigte sich auch Dietrich der Bedrängte den Städten gegenüber nicht unfreundlich. Er gewährte ihnen Schutz und wirtschaftliche Privilegien, sofern sie seiner eigenen Machtstellung nicht abträglich waren. Die Krise nach dem Tode seines Bruders Albrecht des Stolzen, als Kaiser Heinrich VI. versuchte, die aufstrebende Markgrafschaft als erledigtes Reichslehen an sich zu ziehen, hatte er alles in allem gut überstanden. Nach dem frühen Tod des Kaisers 1197 gelang es dem von einem Kreuzzug im Heiligen Land rasch herbeieilenden Dietrich, im väterlichen Erbe Fuß zu fassen. Der Staufer Philipp von Schwaben belehnte ihn bereits ein Jahr später mit der Markgrafschaft Meißen, der Welfe Otto IV. gab ihm 1210 noch die Ostmark (Niederlausitz) dazu. Zum Stauferkaiser Friedrich II. pflegte er ein einvernehmliches Verhältnis, was ihm den weiteren Ausbau seines Herrschaftsgebietes ermöglichte. Wieder fest im Sattel sitzend, ging der neue Markgraf daran, auch in Leipzig seine fürstlichen Rechte wahrzunehmen. 1212/13 kündigte er an, das Augustinerchorherrenstift Sankt Thomas gründen zu wollen.
Eine Klostergründung stellte damals unter dem Blickwinkel der Machtpolitik und des Landesausbaus einen hochpolitischen Akt dar. Das Stift genoss den markgräflichen Schutz und unterstand einem vom Markgrafen ernannten Vogt, der die Gerichtsbarkeit im Stiftsgebiet ausübte.
Zur Versorgung der zehn bis 20 Chorherren, die mit ihrem Probst aus Halle kamen, verfügte Dietrich die Übertragung von reichem Landbesitz, der fünf Dörfer, darunter Propstheida, Baalsdorf und Olschwitz, mit insgesamt ungefähr 1500 Hektar Ackerland umfasste. Dazu gewährte Dietrich der Gemeinschaft komplette Abgabenfreiheit. Die Leipziger empfanden die Gründung als Affront. Nicht nur, dass ihnen weite Gebiete im Umland der Stadt an einen fremden, kirchlichen Grundherren, der nicht einmal selbst Steuern zahlte, verloren gingen, der Markgraf besaß auch noch die Unverfrorenheit, dem neuen Thomasstift die anderen beiden geistlichen Einrichtungen der Stadt, die Nikolaikirche und die Peterskapelle, zu unterstellen. Die Bürger identifizierten sich aber in besonderem Maße mit der Nikolaikirche, wie schon das Patrozinium des heiligen Nikolaus anzeigte, der als Schutzpatron der Kaufleute galt. Den Bau der romanischen Nikolaikirche seit dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts begleiteten die Bürger mit großem Interesse und vor allem wohl mit großer Spendenfreude. Denn obwohl die Kirche wie auch die gesamte Stadt eine markgräfliche Gründung war, wäre der überaus stattliche Bau von 56 Metern Länge im Stil der Spätromanik, von dem noch heute Reste des Westwerks erhalten sind, ohne die Opferbereitschaft der Leipziger nicht zu finanzieren gewesen.
Nun also sollte die für die geistliche Versorgung der Städter so wichtige Pfarrkirche in die Hände der Augustinerchorherren übergehen, die damit auch die Besetzung der Pfarrstelle vornahmen. Für die selbstbewussten Leipziger, die nicht nur für den Kirchenbau, sondern auch für den Bau, den Unterhalt und die Verteidigung der Stadtmauern zur Kasse gebeten wurden, bedeutete diese Maßnahme eine ungeheure Provokation. Die gleichzeitige Ankündigung Dietrichs, darüber hinaus noch die Hauptburg in der Stadt ausbauen zu wollen, nährte die Befürchtung, der Landesherr wolle seine Herrschaft in Leipzig verstärkt zur Geltung bringen. Mit aller Macht versuchten die Bürger daher, den Bau der neuen Thomaskirche, die über einem älteren Vorgängerbau errichtet wurde, zu hintertreiben. Heimlich rissen sie die tagsüber errichteten Mauerteile wieder ab und warfen das Baumaterial in den Pleißenmühlgraben.
Doch nicht nur die Leipziger Bürger wehrten sich gegen den Machtanspruch des Markgrafen, auch der Dienstmannschaft des Wettiners, Ministerialen und ritterlichen Vasallen, wurde die Konzentration seiner Herrschaftsrechte allmählich zu bunt. Nach dem Zeugnis der Pegauer Annalen schmiedeten engste Mitarbeiter Dietrichs ein Mordkomplott gegen ihn, das sie im thüringischen Eisenberg zur Ausführung zu bringen hofften. Da ihnen der Zutritt zum markgräflichen Schlafzimmer aber verwehrt wurde, misslang der Anschlag und die Attentäter flüchteten nach Leipzig, das sich ihrem Aufstand anschloss, obwohl sich rasch die Nachricht verbreitete, der Markgraf erfreue sich bester Gesundheit. Die Aufständischen sammelten ein Heer und es kam zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Landesherrn, in deren Verlauf die Stadt Leipzig sogar drohte, die Kommune einem der Gegner Dietrichs zu übergeben.
Der Markgraf, nicht zum ersten Mal in seinem Leben der „Bedrängte“ und in Notsituationen allmählich erfahren, gab taktisch klug zunächst nach und unterzeichnete 1216 einen Schiedsspruch, in dem er die Bestimmungen des Stadtbriefes seines Vaters sowie einige nicht näher bestimmte Zollprivilegien bestätigte. Er war sogar bereit, auf den Ausbau der in der Stadt gelegenen Burg zu verzichten, was den Leipzigern indirekt die Kontrolle und Besetzung der Verteidigungsanlagen in die Hände spielte. Zuletzt bestätigte der Markgraf das Stadtgericht unter Führung von Vogt und Schultheiß und schwor Urfehde, das heißt er verzichtete auf Rachehandlungen. Nach dem Austausch von Gefangenen schien die Sache glücklich für die Stadt enden zu wollen. Die gemeinsam handelnde und gut organisierte Bürgergemeinde, die den Inhalt des Schiedsspruches so nachdrücklich in Gegenwart hochrangiger geistlicher Verhandlungsführer wie dem Erzbischof von Magdeburg bestimmte, hatte dem Stadtherrn in seiner Machtvollkommenheit deutliche Zugeständnisse abgerungen.