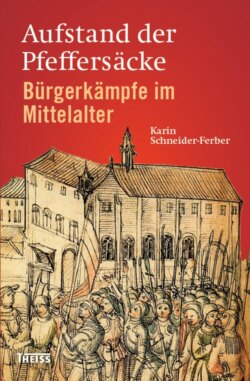Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DAS „HEILIGE KÖLN“ UND SEINE MÄCHTIGEN STADTHERREN
ОглавлениеBis dato waren die Erzbischöfe von Köln die unbestrittenen Herren der blühenden Handelsstadt am Rhein gewesen. In der alten Römerstadt, in der das städtische Leben auch in den wirren Zeiten der Völkerwanderung nie ganz erloschen war, hatte sich schon in spätantiker Zeit eine christliche Gemeinde etabliert, der seit dem 4. Jahrhundert ein Bischof vorstand. Nach dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft am Rhein und der Entstehung des fränkischen Reiches unter den Dynastien der Merowinger und Karolinger wuchsen Köln vor allem durch die Eroberungspolitik Karls des Großen neue administrative Aufgaben zu. Die im eroberten und frisch missionierten Sachsenland gegründeten Bistümer Bremen, Münster, Minden und Osnabrück wurden zusammen mit den älteren Diözesen von Lüttich und Utrecht der Kölner Kirche unterstellt. Schon damals führte Bischof Hildebold, der enge Vertraute Karls des Großen und Leiter der Hofkapelle, den Ehrentitel „archiepiscopus“ (Erzbischof). Ein großer karolingischer Dom, 870 geweiht, kündete vom gewachsenen Einfluss der Kölner Kirche.
Im 10. Jahrhundert wurde diese Stellung noch einmal gestärkt, als die ottonischen Könige dazu übergingen, zur Verwaltung ihres Reiches zunehmend die hochrangigen Reichsbischöfe heranzuziehen. So ernannte Otto der Große seinen Bruder Brun, der 953 von Klerus und Volk zum neuen Erzbischof von Köln gewählt worden war, gleichzeitig zum Herzog von Lothringen und übertrug ihm eine Fülle von Herrschaftsrechten, die dieser in seiner Doppelfunktion als Herzog und Erzbischof, in den Quellen als „archidux“ umschrieben, ausübte. Im Auftrag seines Bruders nahm Brun königliche Hoheitsrechte wie das Markt-, Zoll- und Befestigungsrecht, die Münzhoheit und die hohe Gerichtsbarkeit in Köln wahr. Mit dieser Machtfülle bestimmte der Stadtherr das Leben der Bewohner in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Doch Brun war in der Bevölkerung beliebt, er unterstützte Handel und Handwerk, sorgte für eine Trockenlegung des sumpfigen Geländes am Rhein, erbaute eine neue Pfalz, ließ den alten Dom erweitern und gründete eine Reihe von Stiften und Klöstern wie das Benediktinerkloster Sankt Pantaleon vor den Mauern der Stadt. Seine Verdienste um die wachsende Gemeinde waren unbestritten, als er 965 von der Bevölkerung tief betrauert verstarb. Mit den unter seinen Nachfolgern gegründeten Kirchen wuchs die Stadt allmählich zur „Sancta Colonia“, zum „heiligen Köln“ heran, das von Dichtern gerühmt und gefeiert wurde. Köln sei „die schönste Stadt, die entstanden jemals in deutschen Landen“, reimte der unbekannte Verfasser des Annoliedes Ende des 11. Jahrhunderts. Um das Jahr 1000 dürften bereits etwa 10.000 Menschen in der Stadt am Rhein gewohnt haben.
Bei der Ausübung ihrer Herrschaftsrechte stützten sich die Erzbischöfe auf unfreie Dienstleute, die Ministerialen. Den Vorsitz im Hochgericht führte der hochadlige Burggraf oder sein Stellvertreter, der Greve, die bei ihrer Tätigkeit von Schöffen unterstützt wurden, die aus der Kölner Bürgerschaft stammten. Der Stadtvogt, ebenfalls ein erzbischöflicher Ministeriale, nahm Funktionen im Gerichts- und Polizeiwesen wahr. Daneben gab es eine Reihe weiterer Dienstmannen, die im Auftrag des Stadtherrn Zölle einzogen, die Markt- und Gewerbeaufsicht führten und die Einkünfte verwalteten. Besonders einflussreich unter ihnen waren die Münzerhausgenossen, die die Aufsicht über die Münzprägung übernahmen. So wichtig die Tätigkeiten der Ministerialen für das Funktionieren des Stadtlebens auch waren, sie selbst blieben persönlich unfrei und ihrem Herrn und Meister, dem Erzbischof, zu Abgaben und Diensten verpflichtet. Auch die übrigen Stadtbewohner standen in vielfältigen Abhängigkeiten zu irgendeinem Grundherren, der entweder der Bischof in der Stadt oder auch ein außerhalb der Stadt lebender weltlicher oder geistlicher Großer oder eine kirchliche Institution sein konnte. Die persönlichen Dienstleistungen, die dem Herrn geschuldet waren, konnten je nach Grad der Unfreiheit höchst unterschiedlich ausfallen und im günstigsten Fall durch Geldzahlungen ersetzt werden, was den Status der Zensualität begründete. Doch gerade die vielen, mit der Unfreiheit einhergehenden Abgaben, zu denen ein jährlich zu leistender Kopfzins, diverse Heiratsgebühren, hohe Todfallabgaben und Beschränkungen im Erbrecht gehörten, empfanden die Menschen als drückende Belastung. Vor allem in wachsenden Handelsstädten wie Köln reifte ein neues Selbstbewusstsein der Stadtbewohner heran.
Bereits im 10. Jahrhundert gehörte Köln zu einem der bedeutendsten Marktorte im Reich. Der Rhein als Wasserstraße ermöglichte den Warenaustausch von der Schweiz bis zur Nordsee und darüber hinaus bis nach England. Dazu kamen Kontakte nach Brabant, Flandern, Dänemark und in den Osten des Reiches. Zu den beliebtesten Handelsprodukten zählten der Wein, den die Kölner Händler aus rheinischen und elsässischen Anbaugebieten bezogen, sowie die wegen ihrer Qualität allseits geschätzten „Luxusprodukte“ Metallwaren, Seidenstoffe, Glas, Töpfereien und Goldschmiedearbeiten. Aus dem Norden, allen voran aus England, bezog man wiederum Wolle zur Tuchproduktion, Rohmetalle, Häute und Felle. Daneben fanden viele Waren des alltäglichen Bedarfs ihren Weg in den Kölner Hafen, darunter Korn, Käse, Fische, Bienenwachs, Textilien oder Pelze, wie eine Auflistung des Koblenzer Zolltarifs aus der Zeit Annos II. beweist. In den Kölner Werkstätten blühten die Gewerbe, die sich immer stärker zu differenzieren begannen. Vor allem die Tuchproduzenten und die Waffenschmiede belebten das Wirtschaftsleben. Für ihren expandierenden Handel hatten die Kölner mit viel Mühe direkt am Rheinufer einen neuen Hafen angelegt und den alten, von den Römern benutzten, in einem Altwasser hinter der Insel vor Groß Sankt Martin gelegenen Hafen zugeschüttet. Das neu gewonnene Gelände hatten sie als Bauplatz für ein neues Handwerkerviertel verwendet und mit Wall und Graben gesichert.
Seitdem brummte das „Export-Import-Geschäft“ stärker denn je und begründete den wirtschaftlichen Aufstieg so mancher Kölner Familie. Lampert von Hersfeld nennt in seinem Bericht über den Aufstand von 1074 den geschädigten Handelsherrn einen „sehr reichen Kaufmann“, seinen Sohn einen „bei den ersten Leuten in der Stadt“ beliebten und geschätzten Mitbürger. Als Führer des Aufruhrs macht Lampert die „primores“ der Stadt aus, die Vornehmen und Großen, die das Volk zum Mitmachen animiert und schließlich vor den Bischofspalast geführt hätten. Für die wohlhabenderen Schichten waren die Übergriffe des erzbischöflichen Stadtherrn, die dieser wohl lediglich als Wahrnehmung der ihm zustehenden grundherrlichen Rechte interpretierte, unerträglich geworden. Allerdings hatten sie in ihrem Kampf um persönliche Freiheit einen Mann vor sich, der zu den einflussreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit zählte und keinerlei Bereitschaft zeigte, angestammte Herrenrechte einfach abzugeben.