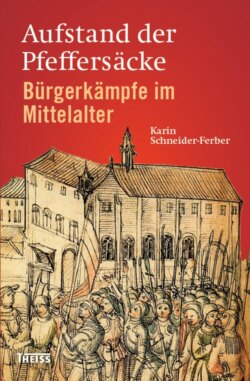Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
GRÜNDUNGSSTADT MIT POTENZIAL
ОглавлениеLeipzig profitierte vor allem durch seine günstige Lage am Schnittpunkt zweier bedeutender Handelsstraßen, der Via regia, der Königlichen Straße, die Mitteleuropa von West nach Ost durchquerte und das Rheinland mit Polen und weiter bis nach Kiew verband, und der Via imperii, der Reichsstraße, die von Norden nach Süden verlief und den Ostseeraum über Nürnberg und Augsburg mit den Handelsplätzen in Italien in Kontakt brachte. Die strategisch günstige Lage am Zusammenfluss von Weißer Elster, Pleiße und Parthe hatten schon die Slawen im 7. Jahrhundert zu schätzen gewusst, als sie sich in der Leipziger Tieflandebene niederließen und dabei den Ort Lipsk, den „Platz an den Linden“, gründeten, aus dem sich später Leipzig entwickelte.
Als die ottonischen Könige im 10. Jahrhundert ihren Herrschaftsbereich bis an die Elbe ausdehnten, fiel auch der nur dünn besiedelte Raum um den „Lindenort“ in ihre Hände. Zur Überwachung der wichtigen Handelswege legten die deutschen Könige auf einem erhöht gelegenen Geländesporn über dem Fluss Parthe eine Burg an, deren Reste später bei Ausgrabungen auf dem Gelände des Leipziger Matthäikirchhofes gefunden wurden. Im Schutze dieser Burg entwickelte sich eine Handwerker- und Händlersiedlung, die von weiteren Siedlungsschwerpunkten so wie jenen um die Kirchen Sankt Nikolai und Sankt Peter ergänzt wurde. Ausgehend von diesen vermutlich nur wenige Hundert Einwohner zählenden Siedlungszentren gründete Markgraf Otto der Reiche zwischen 1156 und 1170 im Bereich südlich der Nikolaikirche eine Neustadt und wies Grundstücke zu ihrer Bebauung aus.
Welche Vorteile für die Bürger mit der Stadterhebung verbunden waren, beweist der bis heute im Stadtarchiv Leipzig aufbewahrte, vermutlich aber erst um 1215 entstandene Stadtbrief. Das außergewöhnliche Dokument, nicht größer als eine Postkarte und beidseitig beschrieben, entstand allem Anschein nach nicht in der Kanzlei des Markgrafen.
So wurde das markgräfliche Siegel ausgerechnet auf dem Kopf stehend am unteren Rand des Pergaments angeheftet und eine andere Schrift als die damals üblichen Urkundenminuskeln verwendet, was zu der Vermutung Anlass gab, dass die Stadterhebung zunächst mündlich erfolgte und erst später, vielleicht im Zusammenhang mit dem Bürgeraufstand von 1215, der schriftliche Beweis dafür „nachgeliefert“ wurde. Der Rechtsinhalt wird in der Forschung aber als glaubwürdig eingestuft.
Nach dem Wortlaut der Urkunde verlieh Markgraf Otto den Bürgern das Stadtrecht nach Hallischem und Magdeburgischem Vorbild und teilte das neu zur Bebauung ausgegebene Land um die Nikolaikirche in Parzellen ein. Der Fürst gewährte weitgehende Abgabefreiheit, lediglich für Italienreisen im Dienste des Kaisers sicherte er sich einen maßvollen Beitrag der Bürger zu. Ein markgräflicher Vogt, namentlich genannt wird Gottfried von Schkeuditz, wachte über die Aufrechterhaltung der Ordnung, ihm wurden Stadt, Umland und Burgdistrikt unterstellt. Die Rechtsprechung übernahm ein vom Landesherrn eingesetzter Richter, der vermutlich mit dem später erwähnten Schultheißen identisch ist. Unklar bleibt dagegen die Funktion des Dekans, der als dritter Amtsträger des Markgrafen genannt wird. Wichtig für das Prosperieren der Stadt wurde die Bestimmung, dass im Umkreis von einer Meile um die Stadt (etwa 15 Kilometer) kein konkurrierender Markt abgehalten werden dürfe. Der in Leipzig abgehaltene Markt wurde dadurch geschützt und in seiner Zentralfunktion für das Umland gestärkt. Auf Bitten der Bürger hin steckte Otto den Geltungsbereich des Stadtrechts, das sogenannte Weichbild, mithilfe von Grenzzeichen an den vier Hauptausfallstraßen nach Erfurt, Halle, Wurzen und Zeitz ab. Das Stadtrecht galt so weit über das engere Siedlungsgebiet hinaus und bot damit genügend Raum für das Entstehen von Vorstädten und die weitere Entwicklung der Kommune.
Der vorausschauende Markgraf, der das Entwicklungspotenzial Leipzigs erkannte, ließ eine erste Grabenwall-Anlage um die Stadt errichten und siedelte auf der alten Reichsburg, die er mit einem stattlichen Palas zum Wohngebäude ausbauen ließ, eine Münzstätte an. Denn auch Otto trug seinen Beinamen „der Reiche“ nicht umsonst. In seine Regierungszeit fiel die Entdeckung von ergiebigen Silbervorkommen am Rande des Erzgebirges. Nach den ersten Funden von 1168 strömten zahlreiche Bergleute aus dem Harz ins Meißener Land, um unter dem Schutz und der Förderung des Markgrafen planmäßig die reichen Vorkommen abzubauen. Die meist aus Goslar kommenden Bergmänner genossen gegen Abgabe des zehnten Teils der zutage beförderten Metallerze an den Landesherrn freie Schürfrechte, was sowohl für die Bergmänner als auch für die Wettiner ein lukratives Geschäft war.
Aus der losen Bergleutesiedlung entwickelte sich um 1186 schließlich die Stadt Freiberg. In dem entstehenden und immer bedeutender werdenden Handel mit Silberbarren nahm eine verkehrsmäßig günstig gelegene Stadt wie Leipzig naturgemäß eine Schlüsselstellung ein. Otto der Reiche war bereit, Leipzig eine gewichtige Rolle in seiner aufstrebenden Landesherrschaft einzuräumen, und ließ sich auf seinen Münzumschriften zeitweise als „Markgraf von Leipzig“ bezeichnen. Anlass zu kühnsten Hoffnungen gab indes auch die seit der Mitte des 12. Jahrhunderts anlaufende Kolonisation der dünn besiedelten, waldreichen Markgrafschaft. Auf der Suche nach frischem Rodungsland zogen immer mehr Siedler aus dem Westen ins Saale-Elb-Gebiet, wo sie sich eine neue Zukunft mit besseren Lebensbedingungen erhofften. Junge, arbeitswillige Leute wanderten in die Markgrafschaft ein, erschlossen bislang unbesiedeltes Land für die Herrschaft der Wettiner, legten in schöner Regelmäßigkeit Straßen- und Angerdörfer an, steigerten die landwirtschaftliche Nutzfläche auf das Doppelte und sorgten für ein hohes Bevölkerungswachstum. Mehr Menschen bedeuteten nicht zuletzt auch mehr Konsumenten. Verkauft wurden die überschüssigen Agrarprodukte in den Märkten der Städte, in denen wiederum Handwerksprodukte und Fernhandelsgüter willige Abnehmer in den in die Stadt strömenden Bauern fanden.
Auf die wirtschaftliche Bedeutung der Städte als Warenumschlagsplatz konnte das Umland bald nicht mehr verzichten. Otto der Reiche hatte all diese Faktoren im Blick, als er Leipzig als erste Stadt in seinem Herrschaftsgebiet gründete und privilegierte. Nicht zuletzt konnte er damit konkurrierende Herrschaftsträger wie die Bischöfe von Merseburg, denen das Leipziger Gebiet in geistlicher Hinsicht unterstand, oder das staufische Königtum, das durch eigene Kolonisationstätigkeit im Pleißenland südlich von Leipzig ein größeres Reichsterritorium aufzubauen versuchte, ausbooten. Die Städte besaßen für den Ausbau der wettinischen Herrschaft hohe Bedeutung, in wirtschaftlicher wie in machtpolitischer Hinsicht. Schutz und Förderung der Städte lagen daher im ureigensten Interesse der Meißener Markgrafen, die sich allerdings auch die Verfügungsgewalt über diese wichtigen Wirtschaftsplätze nicht aus der Hand nehmen lassen wollten.