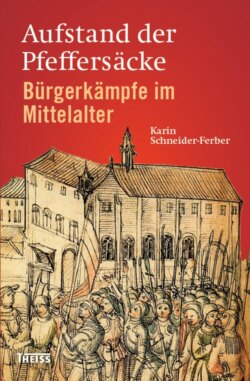Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
STADTHERR MIT „CHEFALLÜREN“: ANNO II. VON KÖLN
ОглавлениеAnno II., der 1056 von Kaiser Heinrich III. auf den Kölner Erzstuhl berufen wurde, fühlte sich ganz in der Tradition seiner Vorgänger als unumschränkter Stadtherr. Als Sohn eines unbedeutenden Rittergeschlechts aus Schwaben hatte er sich im Dienst der Kirche nach oben gearbeitet, war zunächst Mitglied des Bamberger Domstifts, bevor er 1054 zum Propst des kaiserlichen Lieblingsstiftes Sankt Simon und Juda in Goslar geholt und in die Hofkapelle, dem üblichen Sprungbrett für ein hochrangiges Kirchenamt, aufgenommen wurde. Schon zwei Jahre später schaffte er es auf die seit dem Tod Hermanns II. vakante Stelle des Kölner Erzbischofs. In der Ausübung seines Hirtenamtes ließ es Anno nicht an Tatkraft missen. Er gründete die Kanonikerstifte Sankt Maria ad Gradus und Sankt Georg sowie die Pfarrkirche Sankt Jakob, kümmerte sich um die Renovierung und Verschönerung zahlreicher bestehender Kirchen und baute gegenüber den lothringischen Pfalzgrafen zügig seine Machtbasis im Kölner Umland aus. Der Pfalzgraf Heinrich überließ dem Erzbischof schließlich „aus Sühne“ den oberhalb der Siegmündung gelegenen Siegberg, wo Anno das bedeutende Kloster Siegburg gründete und mit Mönchen aus dem Umkreis des Reformklosters Gorze besiedelte.
In die hohe Reichspolitik griff Anno während der Zeit der Minderjährigkeit König Heinrichs IV. ein. Er tat dies in einer außergewöhnlich aggressiven Art und Weise: Als Haupt einer oppositionellen Gruppe lockte er 1062 den erst 11-jährigen Heinrich IV. bei Kaiserswerth auf ein im Rhein ankerndes Schiff und entführte den Minderjährigen kurzerhand nach Köln.
Mit diesem „Putsch“ beendete er die Regentschaft der Kaiserwitwe Agnes und ihres Beraterkreises, die durch ihre Politik ein Papstschisma hervorgerufen hatte. Anno wirkte auf ein Ende der strittigen Papstwahl hin, indem er dem Reformpapst Alexander II. die nötige Anerkennung im Reichsepiskopat verschaffte und den vom kaiserlichen Hof favorisierten Kandidaten, Honorius II., fallen ließ. So sinnvoll diese Maßnahme im Rahmen der Reichspolitik auch gewesen sein mag, das brutale Vorgehen von Kaiserswerth warf ein schlechtes Licht auf den Charakter des skrupellosen Kirchenfürsten.
Mit List und Tücke hatte er den jungen Salierspross nach einem festlichen Mahl auf das Schiff gelockt, das extra prächtig ausgestattet worden war, um das Interesse des Jungen zu wecken. Als Heinrich an Bord war, legte das Schiff plötzlich ab, was bei diesem zu einer Panikreaktion führte: Er sprang beherzt ins kalte Wasser und wäre um ein Haar ertrunken, wenn ihn nicht Graf Ekbert von Braunschweig gerettet hätte. Gegen seinen Willen wurde der jugendliche König nach Köln gebracht, seine Mutter sah er erst zweieinhalb Jahre später wieder. Heinrich hat dem Erzbischof diesen Gewaltakt nie verziehen. Das Verhältnis der beiden blieb zeitlebens schlecht, am Tag seiner Mündigkeit zog der Salier gar das Schwert gegen seinen verhassten „Vormund“. An der Spitze der Reichsregierung konnte sich Anno indes nicht lange halten. Seine eigennützige Personalpolitik, mit der er Verwandte und Vertraute auf Schlüsselpositionen hievte, weckte den Neid anderer Großer. Mächtige Kollegen wie die Erzbischöfe Siegfried von Mainz und Adalbert von Hamburg-Bremen mischten sich in die Regierungsgeschäfte ein und drängten Anno allmählich zur Seite. Zu einer stabilen Regierung kam es daher bis zur Volljährigkeit Heinrichs IV. nicht – Streit, Neid und Missgunst prägten die Atmosphäre am Salierhof.
So mag man gerne glauben, was die Kölner an ihrem Erzbischof besonders störte: Sein Hochmut, sein herrisches Durchgreifen, seine strenge Behandlung Untergebener, sein mangelnder Respekt gegenüber auch wohlhabenden Städtern, die er spüren ließ, dass sie für ihn nur gewöhnliche Unfreie waren. „Er war gewiss ein Mann, in dem Tugenden aller Art blühten“, urteilte Lampert, der Anno wohlwollend gegenüberstand, über ihn. „Doch ein Fehler wurde bei so großen Tugenden gleichsam wie ein kleines Muttermal an einem sehr schönen Körper sichtbar, weil er, wenn der Zorn aufflammte, die Zunge nicht hinreichend zügeln konnte, sondern ohne Ansehen der Person gegen jedermann Beschimpfungen und bitterste Scheltworte herausschleuderte.“ Dieses ungezügelte Benehmen ließ sich in einer Zeit, in der Autoritäten zunehmend hinterfragt wurden, nicht mehr ohne Weiteres aufrechterhalten. Der aufkommende Investiturstreit, das Ringen zwischen Papst und König um die Besetzung der wichtigen Bischofsstühle im Reich stellte die grundsätzliche Frage nach der Legitimität jeder Macht. Welche Rechte standen dem König, welche dem Papst und seinen Bischöfen zu? Was tun mit einem König, der seinen Pflichten zur Friedenswahrung und Konsensbildung nicht nachkam? Wer durfte ihn wann und unter welchen Bedingungen absetzen? Und entsprach die Verquickung von geistlichen und weltlichen Kompetenzen, wie sie sich im Reichsepiskopat längst eingebürgert hatte, überhaupt dem Idealbild einer „reinen“, von weltlicher Verstrickung freien Kirche?
Diese Fragen begannen die Menschen des 11. Jahrhunderts immer lauter zu diskutieren. An größeren Orten, auf Straßen und Marktplätzen kam es zu einem allmählichen Meinungs- und Informationsaustausch, der zur Bildung einer ersten, bescheidenen „Öffentlichkeit“ führte. Die tief greifende Auseinandersetzung zwischen Papsttum und Königtum forderte auch die Bevölkerung zur Stellungnahme heraus – für oder gegen den König, für oder gegen die Reformpartei innerhalb des Klerus. Welche Konsequenzen die politische Parteinahme einer Bürgerschaft nach sich ziehen konnte, zeigte das Beispiel der Stadt Worms im Jahr 1073: Als Heinrich IV. wegen seiner Territorialpolitik einen Aufstand in Sachsen provoziert hatte und die deutschen Fürsten kurz davor standen, einen Gegenkönig zu wählen, da bezogen die Wormser die Position des Königs und öffneten dem fliehenden Salier die Tore, während sie ihren Bischof Adalbert, einen erklärten Gegner Heinrichs, mitsamt seinen Kriegsleuten aus der Stadt trieben. Mit großem Gepränge zogen die Wormser dann Heinrich IV. entgegen, um ihn in die Rheinstadt zu holen. „Bereitwillig geloben sie ihm Beistand, schwören ihm Treue, erbieten sich, jeder nach besten Kräften aus seinem eigenen Vermögen zu den Kosten der Kriegführung beizutragen, und versichern ihm zeit ihres Lebens treu ergeben für seine Ehre kämpfen zu wollen“, berichtet Lampert von Hersfeld.
Der bedrängte König konnte die Hilfe gut gebrauchen. Vom gut befestigten Worms aus, das mitten in salischem Hausbesitz lag, reorganisierte der König seine militärischen Kräfte und gewann seinen politischen Handlungsspielraum wieder. Großzügig bedankte sich Heinrich bei den Einwohnern am 18. Januar 1074 mit einem Privileg für ihre Hilfe. Er gewährte allen Wormsern, darunter auch den Juden, die Befreiung von Zollabgaben an den königlichen Zollstädten Frankfurt a. M., Boppard, Hammerstein, Dortmund, Goslar und Enger. Es war das erste Privileg, das ein König für die Bürger einer Stadt im Reich überhaupt ausstellte. Ausdrücklich lobte der Herrscher das Verhalten der Wormser, ihre unverbrüchliche Treue dem Königtum gegenüber, „obschon wir weder durch einen mündlichen noch durch einen schriftlichen Befehl, weder durch uns selbst noch durch einen Boten oder durch irgendeine Stimme zu dieser so ausgezeichneten Tat den Anlass gegeben haben“, wie das Privileg hervorhob. Allen anderen Städtern wurde das Verhalten der Wormser als beispielhaft empfohlen und der daraus gezogene Nutzen – die wirtschaftlichen Erleichterungen – als lockendes Angebot vor Augen gestellt. Selbstständiges politisches Handeln lohnt sich, so die Botschaft, die Treue zum König allemal, auch wenn sie sich wie im Falle Worms gegen den eigenen geistlichen Stadtherrn wandte. Obwohl dem Bischof untertänig, hatten die Wormser dem König aus eigenem Antrieb einen Treueid geleistet, was dieser ganz offensichtlich billigte.
Der Erfolg der Wormser Bürger sprach sich rasch herum, nicht zuletzt in Köln, wo man nach den Aussagen Lamperts „das schlechte Beispiel nachahmte“ und die Ergebenheit dem König gegenüber „durch eine rühmenswerte Tat beweisen wollte“. Nach der überstürzten Flucht Annos schickten die aufständischen Kölner einige junge Männer zum König, um ihn aufzufordern, so rasch wie möglich zu kommen und die „herrenlose“ Stadt zu seinem eigenen Vorteil in Besitz zu nehmen. So zeigte sich der Kölner Aufstand eingebettet in die politische Situation seiner Zeit.