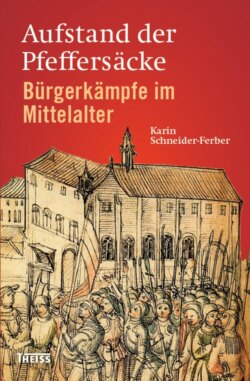Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DER ZORN DES STADTHERRN
ОглавлениеDoch der Markgraf hatte dem Vergleich nur zähneknirschend zugestimmt. Ein glücklicher Zufall spielte ihm schließlich die Stadt in die Hände. Nur wenige Monate nach dem Schiedsspruch gelang es ihm, den gerade in Altenburg weilenden Stauferkönig Friedrich II. zu einem Besuch in Leipzig zu überreden. Die Bürger konnten einen so hohen Besucher unmöglich abweisen und mussten dem König und dem Markgrafen die Tore öffnen, auch wenn sie in Anbetracht der angespannten Lage auf ein möglichst kleines Gefolge Wert legten. „Aber der Markgraf veranlasste, dass seine Ritter allmählich bald durch dieses, bald durch jenes Tor hereinkamen, den größeren Teil der Stadt anfüllten, sich aber vorsichtig in die Herbergen zurückzogen“, berichten die Pegauer Annalen. Schlauerweise sorgte der Markgraf dafür, dass das Glockengeläut, das die Bürger normalerweise zu Versammlungen rief oder vor Gefahren warnte, diesmal nicht zu hören war. „Der Markgraf ließ den Klöppel der Glocke heimlich entfernen und aufbewahren, damit nicht durch eine Zusammenkunft der Menge seine Absicht vereitelt würde. Wie ebenfalls auf Befehl des Markgrafen verabredet worden war, musste auf ein gegebenes Zeichen hin jeder der Bewaffneten darangehen, seinen Wirt gefangen zu nehmen und sein Hab und Gut zu plündern.“ Mit List und Tücke setzte sich Dietrich also wieder in den Besitz der Stadt, die angesichts der Anwesenheit des Stauferkönigs nicht zu einer militärischen Gegenwehr in der Lage war. Danach hielt der Markgraf Strafgericht über die aufmüpfige Kommune. Teile der Stadtmauern wurden abgetragen und geschleift, innerhalb des Stadtgebietes drei befestigte Häuser zur Sicherung der markgräflichen Macht errichtet, „damit die Bürger nichts Ähnliches wieder würden versuchen können“. Die ritterlichen Verschwörer ließ Dietrich gefangen nehmen, wobei einer sich geschickt auf sein Pferd schwang und „entkam, indem er das verschlossene Tor mit einer Axt aufschlug“. „Sein Bruder dagegen“, so der Annalenbericht weiter, „wurde verhaftet und in die Hände des Königs Friedrich übergeben. Er zog später als Kreuzfahrer übers Meer und nahm so von den irdischen Dingen Abschied.“
Leipzig musste sich der Herrschaft des Wettiners wieder beugen. Die genaue Lokalisierung der drei befestigten Häuser, in den Quellen als „castra“, Burgen, bezeichnet, bleibt umstritten. „Es war aber eine Befestigung am Ende des Gartens der Predigerbrüder gelegen, eine andere bei den Minderbrüdern, die dritte dort, wo sie heute ist“, schrieb der Autor der Pegauer Annalen rund zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen. Eine Lokalisierung der befestigten Plätze, die man gemeinhin auf dem Gelände der Dominikaner und Franziskaner vermutete, ist jedoch schwer, archäologisch nachgewiesen ist bislang keine. Die alte Hauptburg wird in diesem Zusammenhang wohl ausgebaut und befestigt, die Pleißenburg, die in veränderter Form bis in die Neuzeit bestand, neu angelegt worden sein. Doch allzu beeindruckend wirkte die markgräfliche Machtdemonstration auf die Leipziger offenbar nicht. Ein erster Schritt, die landesherrliche Herrschaft abzuschütteln, gelang schon 1224, als die Bürger nach dem Tod Dietrichs des Bedrängten dynastische Streitigkeiten ausnutzten und erneut einen Aufstand wagten. Gemeinsam mit Landgraf Ludwig II. von Thüringen zerstörten sie die Zwingburgen, von denen nur die Pleißenburg den Sturm überstand, und überließen das Gelände den Dominikanern und Franziskanern zur Bebauung. Leider schweigen die Quellen über die Umstände und den Verlauf der Aktion, sodass hier nur der Wille der Bürgerschaft, sich gegen den übermächtigen Markgrafen zu behaupten, erkennbar wird.