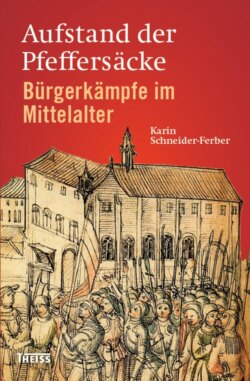Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE QUELLEN DES SELBSLBEWUSSLSEINS – WANDEL DURCH HANDEL
ОглавлениеSie waren nicht immer beliebt – die weit gereisten Händler, die von Ort zu Ort zogen, überhöhte Preise für ihre Waren verlangten oder Produkte von minderwertiger Qualität an unwissende Käufer verkauften. Das Mittelalter brachte dem Berufsstand des Kaufmanns durchaus ambivalente Gefühle entgegen. Allerdings wusste man auch um seine Notwendigkeit: „Wir brauchen die Kaufleute, denn sie schaffen die Dinge, die wir benötigen, von einem Land in das andere“, predigte um die Mitte des 13. Jahrhunderts der Franziskanermönch Berthold von Regensburg, selbst Kind einer großen Handelsmetropole. Das Bevölkerungswachstum des Hochmittelalters und die zunehmende soziale Differenzierung kurbelten die Nachfrage nach Gebrauchs- wie Luxusgütern stark an. Salz, Erze, Fische aus den Küstengebieten, orientalische Gewürze oder byzantinische Seidenstoffe waren ohne die risikoreichen Reisen der Fern- und Überlandhändler nicht zu haben. Je weiter und gefahrvoller die Reise, umso höher stiegen die Preise und damit die Gewinnspannen. Denn die oft monatelangen Handelsfahrten bargen Gefahren in sich: Schiffe konnten sinken, Landtransporte überfallen, ungerechtfertigte Zölle von hohen Herren eingetrieben werden. Erfolgreiche Fernkaufleute, deren Waren auf dem langen Transportweg nicht verloren gegangen oder verdorben waren, konnten daher bei ihrer Rückkehr auf märchenhafte Gewinne aus den heiß begehrten Handelsgütern hoffen und gehörten damit schon früh zur städtischen Oberschicht. Die im Fernhandel erzielten Erträge investierten sie in Landbesitz oder in Beteiligungen an Mühlen und Bergwerken sowie in den Renten- und Kreditmarkt. Ihr Reichtum und ihre Übernahme politischer Ämter ließen sie in der sozialen Hierarchie rasch nach oben steigen, auch wenn so mancher Bettelmönch über den „wucherisch“ erworbenen Wohlstand die Nase rümpfen mochte. Am Ende stand doch wieder ein gerüttelt Maß an Bewunderung, wenn Hugo von Sankt Victor resümierte: „Der Kaufmann dringt in die Geheimnisse der Erde ein, bereist nie gesehene Küsten, durchmustert raue Wüsten und pflegt mit barbarischen Stämmen in unbekannten Sprachen freundschaftlichen Handelsverkehr. Sein Eifer einigt Völker, dämpft Kriege und festigt den Frieden.“ Mehr Anerkennung konnte man als „Pfeffersack“ nicht erwarten.
Der gegebene Ort für den Austausch von Produkten war die Stadt. Der Marktplatz gehörte daher zu den pulsierenden Lebensadern einer jeden Gemeinde, der mehr und mehr auch baulich gestaltet wurde. Handelte es sich bei den frühen Märkten häufig um einfache Freiflächen, auf denen die Händler nach Bedarf Buden und Zelte aufstellten, holte man sie in den rasch wachsenden Städten ins Zentrum der Stadtanlage und rahmte sie durch repräsentative Steinbauten ein. Kirche, Rathaus, Patrizierhäuser und Marktplatz bildeten damit den architektonischen Mittelpunkt einer Stadt. Häufig dienten neben den mobilen Buden und Ständen die Untergeschosse der Rathäuser und die den Erdgeschossen der Kaufmannshäuser vorgelagerten Marktlauben als Verkaufsbereiche, die Schutz vor Regen und Sonne und damit mehr Komfort boten. Ab dem Spätmittelalter wurden eigene Kaufhäuser errichtet, in deren gewölbten Erdgeschosshallen oder Obergeschosssälen die Fernhandelswaren angeboten wurden. Das Mainzer Kaufhaus, 1317 eingeweiht und damit das älteste seiner Art, diente zugleich als städtischer Festsaal und zeigte an seiner Außenfront aufwendige Fassadenmalereien. Auch das 1388 errichtete Konstanzer Kaufhaus am Ufer des Bodensees bestach durch seine imposante Größe. In ihm fanden nicht nur die über die Alpenpässe transportierten wertvollen Waren aus Italien einen würdigen Rahmen, sondern 1414 sogar die ganze Versammlung des Konstanzer Konzils. Neben dem zentralen Markt im Herzen der Stadt konnte in größeren Gemeinden eine ganze Reihe von Spezialmärkten in einzelnen Stadtbezirken existieren. Den „Alten Markt“ ergänzte dann ein „Neumarkt“ in einem jüngeren Stadtviertel, dazu konnten „Fischmarkt“, „Kornmarkt“, „Weinmarkt“ oder „Ledermarkt“ treten.
Eine verkehrsgünstig gelegene Stadt hatte die besten Chancen zu einem überregional bedeutenden Markt- oder Messeort aufzusteigen. Den Anfang machten die Champagne-Messen, die zwischen 1150 und 1350 den Zwischenhandel mit Gütern aus dem Mittelmeerraum übernahmen. Zeitlich aufeinander abgestimmt, fanden in Troyes, Provins, Bar-sur-Aube und Lagny-sur-Marne sechs Einzelmessen statt, zu denen Kaufleute aus ganz Europa anreisten. Aus dem Reichsgebiet waren Händler aus Freiburg i. Br., Konstanz, Speyer, Mainz, Augsburg, Köln, Aachen oder Lübeck vertreten, aus dem übrigen Europa Kaufleute aus Frankreich, England, Schweiz, Italien, Spanien und Flandern. Die Messen der Champagne entwickelten sich vor allem zum größten Umschlagplatz für flandrische und nordfranzösische Tuche, die in den Mittelmeerraum verkauft wurden, von wo andererseits die Schätze des Orients eintrafen. Die deutschen Kaufleute brachten Leinwand vom Bodensee, Metalle wie Zinn und Kupfer oder Pelze aus dem Norden mit. Als Treffpunkte der Welt eigneten sich die Champagne-Messen auch für das „internationale“ Kredit- und Wechselgeschäft. Mit der Änderung der Verkehrswege ab Ende des 13. Jahrhunderts verloren die französischen Messeorte ihre Bedeutung. Die Genuesen liefen erstmals um 1277 die flandrischen Seehäfen durch die Straße von Gibraltar direkt an. Venezianische Galeeren folgten bald, sodass die Hafenstädte von Brügge und Antwerpen nun zu neuen europäischen Handelszentren aufstiegen.
Die für den Frachtverkehr neu erschlossenen Landwege über die Alpenpässe Sankt Gotthard, Brenner und Septimer beflügelten dagegen den Aufstieg Nürnbergs, Augsburgs oder Ravensburgs. Der Verkehrsknotenpunkt Frankfurt a. M. eröffnete dem Italienhandel den Weg zur wichtigen Rheinschiene, wo Köln die Richtung in den Nord- und Ostseeraum wies. Gegen Ende des Mittelalters musste es seine führende Rolle an Leipzig abgeben, das, vom Kaiser protegiert und günstig zu den ostmitteleuropäischen Märkten gelegen, zum neuen führenden Messeort aufstieg.
Schon für das 12. Jahrhundert ist Frankfurt als Messeplatz nachgewiesen, doch erst dank eines Privilegs von Kaiser Ludwig dem Bayern von 1330, der zusätzlich zur üblichen Herbstmesse eine Fastenmesse für das Frühjahr bewilligte, nahm dieser einen großen Aufschwung. Allen Messebesuchern gewährte Ludwig jeweils acht Tage vor und nach der 14-tägigen Messezeit königlichen Schutz, Frieden und Sicherheit. Diese Protektion nutzend, trafen Kaufleute in großer Zahl in Frankfurt ein. Das Einzugsgebiet der Messer reichte über Fulda, Limburg und Marburg bis nach Köln, Aachen, Trier und weiter nach Luxemburg und Metz. Zu den Haupthandelsartikeln zählten preiswerte Tuche aus mittelrheinischen Weberstädten, die eine Marktlücke zwischen den exklusiven italienischen und flämischen Stoffen und den billigen Produkten aus dem heimischen Webstuhl füllten. Daneben fand eine recht umfangreiche Warenpalette ihren Weg auf die Frankfurter Verkaufsbänke: Nürnberger Metall- und Glaswaren, eingesalzene Ostseeheringe, Barchent, ein Baumwollgewebe aus Oberschwaben, Waid aus Thüringen und fässerweise Rheinwein. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts trat jener Handelsartikel in den Vordergrund, für den die Frankfurter Messe bis heute berühmt ist: das gedruckte Buch. 1454 wurde auf der Herbstmesse die 42-zeilige Gutenberg-Bibel dem staunenden Publikum vorgestellt. Doch trotz dieses bunten Angebots zeigte sich auch Frankfurt in seiner Stellung als Messeort nicht unverwundbar.