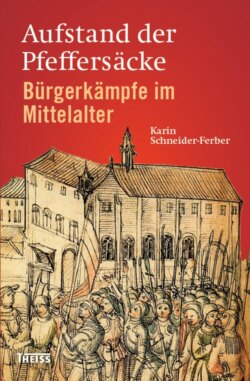Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aufstand der „Pfeffersäcke“
Leipzig und sein Ringen gegen die wettinischen Landesherrn MARKGRAF IN NÖTEN
ОглавлениеMarkgraf Dietrich von Meißen bekam in seinem Leben wirklich nichts geschenkt. Erst verdrängte ihn sein älterer Bruder Albrecht der Stolze gegen den Willen der Mutter aus der Erbfolge in der Markgrafschaft Meißen, dann zog auch noch Kaiser Heinrich VI. nach dem Tod Albrechts 1195 das Herrschaftsgebiet als erledigtes Reichslehen ein – und er selbst hatte wieder einmal das Nachsehen. Die Geschichtsschreibung gab dem gedemütigten Dietrich, der erst nach des Kaisers Tod in den Besitz der Markgrafschaft kam, den Beinamen „der Bedrängte“. Bedrängt wurde Dietrich aber nicht nur von der eigenen Familie und vom Kaiserhaus, sondern zusätzlich noch von einer Seite, von der er es nie und nimmer erwartete hätte: von den Bürgern seiner Stadt Leipzig. 1215 läuteten in der aufstrebenden Handelsstadt die Sturmglocken zum Aufstand gegen den Landesherrn. Denn nicht nur bischöfliche, sondern auch weltliche Stadtherren konnte der Zorn ihrer Bürger treffen. Dabei hatte ausgerechnet Leipzig dem Hause Wettin so viel zu verdanken. Stadtwerdung und frühe Privilegierung erreichte sie durch Otto den Reichen, den Vater des bedrängten Dietrich. Doch nun verbündete sich die „undankbare“ Stadt mit aufständischen Ministerialen, die dem Markgrafen nach dem Leben trachteten, und öffnete den Attentätern die Tore. Der überrumpelte Dietrich sah sich zum Nachgeben gezwungen und unterschrieb unter Vermittlung des Erzbischofs von Magdeburg und des Bischofs von Merseburg einen Vergleich, in dem er der Stadt alle Gründungsrechte und Zollprivilegien bestätigte und sogar auf sein Befestigungsrecht verzichtete. Heimlich schwor der Markgraf jedoch Rache bei nächster Gelegenheit.
Es gab einen Punkt in der Geschichte Leipzigs, in der die Stadt die landesherrliche Bevormundung hätte abschütteln und womöglich den Sprung zur Reichsstadt hätte schaffen können. Dieser Zeitpunkt war mit dem großen Bürgeraufstand von 1215/16, von dem die Klosterannalen des Benediktinerklosters Pegau einige Jahrzehnte nach dem Ereignis berichten, gegeben. Doch das Schicksal wollte es anders. Der rachsüchtige Markgraf befreite sich nur wenige Monate später aus der Rolle des ewig „Bedrängten“ und unterwarf die Stadt mit brutaler Macht wieder seiner Gewalt, wodurch Leipzig dauerhaft unter die Landesherrschaft der Wettiner geriet. Gleichzeitig aber ist Leipzig das beste Beispiel für eine Territorialstadt, die sich trotz der machtpolitisch ungünstigen Lage ein erstaunliches Maß an städtischer Autonomie erkämpfte. Die steigende Wirtschaftskraft der überregional bedeutenden Handelsstadt gab ihr ganz von selbst ein politisches Gewicht, das die wettinischen Landesherren nicht ignorieren konnten. So erreichte auch Leipzig bis zum Ende des 13. Jahrhunderts eine fortschrittliche Ratsverfassung mit Bürgermeister, Rathaus und Stadtsiegel. Die von den Landesherren und den Kaisern gleichermaßen privilegierte Messe wurde dabei zur sprudelnden Quelle des bürgerlichen Wohlstandes.