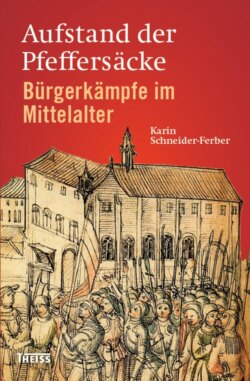Читать книгу Aufstand der Pfeffersäcke - Karin Schneider-Ferber - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE SAAT GEHT AUF
ОглавлениеAuch wenn Kölns Bürger kurzfristig in der Auseinandersetzung mit dem Erzbischof den Kürzeren gezogen hatten, war der Aufstieg der Kommune doch nicht aufzuhalten. Am geplanten Bündnis mit dem König gegen den geistlichen Stadtherrn hielten sie fest. 1106 ergriffen sie in den Kämpfen zwischen Heinrich IV. und seinem Sohn Heinrich V. die Partei des unter ehrenrührigen Umständen entmachteten Vaters, boten ihm Zuflucht in ihrer Stadt und leisteten ihm einen Treueid. Mit Billigung Heinrichs IV. verstärkten sie daraufhin auf eigene Faust die Stadtbefestigung und bezogen einige Vorstädte in den Mauerring mit ein, obwohl die Wehrhoheit eigentlich dem Erzbischof zustand. Dadurch wuchs das Stadtgebiet auf 204 Hektar an und sprengte die Grenzen, die ihm der römische Mauergürtel bislang vorgegeben hatte. Die koordinierte und umsichtige Arbeit der Bürgergemeinde zeigte schon drei Monate später ihre Wirkung, als die Stadt einer Belagerung durch Heinrich V. standhielt. Sogar den Rhein sperrten die Kölner mit ihren Handelsschiffen, um die Belagerer vom Nachschub abzusperren. Diese höchst erfolgreichen militärischen Aktionen wären ohne organisierte und selbstständig handelnde Bürgergremien unmöglich gewesen.
Und in der Tat werden in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in den Quellen die ersten Selbstverwaltungsorgane der Stadt Köln genannt. Das Schöffenkolleg, das im erzbischöflichen Hochgericht unter Leitung des Burggrafen Recht sprach, eignete sich mehr und mehr öffentliche Aufgaben an und wuchs damit zu einer ersten „Stadtbehörde“ heran. Obwohl dem Erzbischof als eigentlichem Gerichtsherrn verpflichtet und von diesem ernannt, nahmen die Schöffen, die sowohl der Ministerialität als auch der vornehmen Bürgerschaft entstammten, doch die Interessen der wachsenden Stadtgemeinde wahr und emanzipierten sich vom Stadtherrn. Als Repräsentanten der Kommune schlossen sie 1114 gemeinsam mit dem Erzbischof und einigen niederrheinischen Großen eine „Schwureinung für die Freiheit“, die sich gegen Heinrich V. und dessen Plan richtete, das Rheinland gewaltsam zu erobern. Dafür gestand der Erzbischof seinen ausnahmsweise einmal kooperierenden Kölner Bürgern das Führen eines Stadtsiegels zu, das als ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Emanzipation der Gemeinde gesehen werden kann, stellte das Siegeln von Urkunden im Mittelalter doch einen hochbedeutenden rechtsverbindlichen Akt dar. Wer über das Siegel verfügte, entschied über die Geschicke der Stadt, konnte Rechtssicherheit schaffen und die Grundlagen des Zusammenlebens der Gemeinde bestimmen. Kein Wunder, wenn das Siegel zu einem wichtigen Element der städtischen Selbstdarstellung wurde. Dem Kölner Selbstbewusstsein entsprechend fiel das Siegel besonders groß aus, es zeigte den heiligen Petrus als obersten Stadtherrn vor den Mauern der Stadt Köln und trug die stolze Umschrift: „Heiliges Köln, durch Gottes Gnade der römischen Kirche treue Tochter“. In späteren Zeiten wurde es in einem mit 23 Schlössern gesicherten Schrank im Rathaus aufbewahrt. Um die städtischen Angelegenheiten zu besprechen, trafen sich die Schöffen im „domus civium“, dem Bürgerhaus als Vorläufer des Rathauses, das erstmals um 1135 Erwähnung findet.
In der prosperierenden Handelsstadt blieb es nicht lange beim Schöffenkolleg als einzigem Vertretungsorgan der Gesamtgemeinde. Die Stadt wuchs und mit ihr die Aufgaben, die für das Zusammenleben der Gemeinschaft wichtig waren. So entstanden bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts eine ganze Reihe weiterer Selbstverwaltungsorgane in Köln. Auf der untersten Verwaltungsebene, den Pfarrgemeinden, etablierten sich bruderschaftlich organisierte Amtleutekollegien, die für die niedere Gerichtsbarkeit und das Führen der Grundbücher, der sogenannten Schreinskarten, verantwortlich zeichneten. Sie waren die erste Anlaufstelle für die Bevölkerung, wenn es um Schuldklagen, Eigentumsübertragungen, Pfand- und Leihgeschäfte, Stiftungen und Schenkungen, die Verwaltung des Kirchenvermögens oder baupolizeiliche Fragen ging. Die Amtleute, an deren Spitze jeweils für ein Jahr zwei Meister standen, die nach Ablauf ihrer Amtszeit in die Bruderschaft der Amtleute überwechselten, entstammten der in den Kirchsprengeln ansässigen Bevölkerung, zu denen neben Schöffen auch reiche Kaufleute und angesehene Bürger zählten. Sie tagten in eigenen sogenannten Geburhäusern, wo sie den Neuzugezogenen den Bürgereid abnahmen, und organisierten im Kriegsfall auch die Verteidigung einzelner Abschnitte der Stadtmauern.
Hatten zu den Amtleutekollegien breitere Schichten der Bevölkerung Zugang, so schlossen sich Kölns Millionäre zu einem eigenen exklusiven Kreis zusammen. Die Richerzeche, zwischen 1114 und 1119 entstanden, aber erst um 1180 erstmals erwähnt, vereinigte die Superreichen der Stadt zu einer Bruderschaft, in die nur eine Handvoll Familien, die noch dazu personell in enger Verbindung zum Schöffenkolleg standen, Zugang fand. Dieser „Kölsche Klüngel“ eroberte sich mehr und mehr Kompetenzen in der Stadtpolitik, die vor allem im wirtschaftlichen Bereich lagen. Die Richerzeche übernahm Aufgaben in der Zunft- und Gewerbeaufsicht, kontrollierte mit Verordnungen Handel und Marktleben und verhängte Leibes- oder Geldstrafen bei Verstößen gegen sie. Mit ihrer Dominanz über das Wirtschaftsleben besaß die Richerzeche eine entscheidende Machtposition, um die Handelsstadt allmählich unter ihre Kuratel zu bringen. Wenige führende Geschlechter, untereinander jeweils durch Einheirat verbunden, begannen das Stadtleben zu dominieren, was für die Zukunft natürlich Konfliktpotenzial in sich barg. An der Spitze der Bruderschaft standen zwei jährlich neu gewählte Bürgermeister, jeweils ein Schöffe und ein Nicht-Schöffe, deren Amt hohes Prestige, aber auch hohe Kosten mit sich brachte: Teure Geschenke mussten verteilt, Wachs- und Weinlieferungen geleistet und für die gesamte Bruderschaft aufwendige Gastmähler ausgerichtet werden. Nichts für kleine Habenichtse! Obwohl nur ein kleiner Teil der Stadtbevölkerung, präsentieren sich die stolzen Herren bereits im 13. Jahrhundert als Vertreter der Gesamtgemeinde: Sie schlossen Verträge ab, bewahrten das Stadtsiegel und stellten Geleitbriefe für Kaufleute aus.
Was als spontanes Aufbegehren gegen einen willkürlichen Stadtherrn begann, hatte sich für die Kölner bereits nach wenigen Jahrzehnten gelohnt. Auf dem Weg zur freien, selbst verwalteten Stadt waren sie ein gutes Stück vorangekommen. Die Kinder und Enkel des geblendeten Kaufmannssohnes kamen bereits in den Genuss erster Formen der Selbstverwaltung und der persönlichen Freiheit. Die Macht des Erzbischofs war gezügelt, das Bündnis mit dem Königtum geschlossen, die kommunalen Gremien mit wachsenden Kompetenzen gegründet.
Ohne die Beteiligung der einflussreichen Schichten der Stadt – Schöffenkolleg, Richerzeche, Amtleutekollegien – lief nichts mehr in der Metropole am Rhein.
1179/80 begannen die Kölner wieder einmal eigenmächtig und ohne Einwilligung des Erzbischofs zu bauen. Die gewaltige, rund 7,5 Kilometer lange Stadtmauer, die sie in über 60-jähriger Bauzeit errichteten, verdoppelte nahezu das Stadtgebiet und holte Häusersiedlungen und Kirchen, die wie das Kloster Sankt Pantaleon oder die Stifte Sankt Severin und Sankt Gereon bislang vor der Stadt gelegen hatten, in den Schutz der Mauern. Das gewaltige Befestigungswerk mit seinen zwölf Torburgen, 52 Wehrtürmen und einer umschlossenen Fläche von 405 Hektar, von Kaiser Barbarossa 1180 in einer Urkunde ausdrücklich gebilligt, wurde zur größten Stadtmauer, die je eine deutsche Stadt umgab. Gleichzeitig war sie auch ein Symbol der Wehrhaftigkeit, der Uneinnehmbarkeit und der politischen Eigenständigkeit der Stadt, „ihr Schmuck und Stolz“, wie es die Barbarossa-Urkunde ausdrückte. Erstmals traten die Bürger in diesem Vertragstext als gleichberechtigte Partner neben Kaiser und Erzbischof auf. Erzbischof Philipp von Heinsberg stimmte dem Bau gegen Zahlung von 2000 Mark Silber zu – ein schwacher Trost, denn er hatte mit der Wehrhoheit eines seiner wichtigsten hoheitlichen Rechte in der Stadt endgültig verloren.