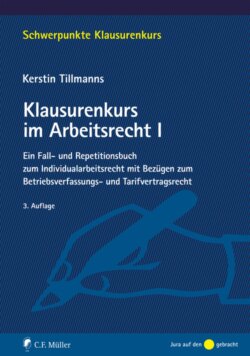Читать книгу Klausurenkurs im Arbeitsrecht I - Kerstin Tillmanns - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Anspruch des A auf Einstellung gem. §§ 280 I, 278 BGB i. V. m. §§ 241 II, 311 II Nr. 1 BGB
Оглавление24
A könnte gegen die D-GmbH einen Anspruch auf Einstellung aus den §§ 280 I, 278 BGB i. V. m. §§ 241 II, 311 II Nr. 1 BGB haben.
Ob eine rechtswidrige und schuldhafte Pflichtverletzung und ein adäquat kausal entstandener Schaden des Erfüllungsgehilfen P der D-GmbH vorliegen, kann dahinstehen. Die Rechtsfolge der Einstellung ließe sich zwar im Wege des Schadensersatzes durch Naturalrestitution (§ 249 I BGB) herleiten. Rechtsfolge eines Anspruchs aus vorvertraglichem Verschulden ist aber grundsätzlich nur das negative Interesse.[1]
Entscheidend spricht jedoch die spezielle Regelung des § 15 VI AGG gegen einen Anspruch auf Einstellung. Zwar verdrängt das AGG gem. § 15 V und § 32 grundsätzlich nicht allgemeine schuldrechtliche Ansprüche. Die systematische Stellung hinter Absatz 5 spricht jedoch dafür, dass sich der Ausschluss des Einstellungsanspruchs auch auf die allgemeinen Ansprüche bezieht.[2] Unter einem „anderen Rechtsgrund“ im Sinne des Absatz 6 sollte daher nicht eine andere Anspruchsgrundlage, sondern ein anderer materieller Grund für die Einstellung (z. B. bei Anspruch auf Wiedereinstellung) verstanden werden.[3]
Exkurs/Vertiefung: Auch aus der Richtlinie 2000/78[4] ergibt sich nichts anderes. Diese richtet sich zum einen nur an die Mitgliedstaaten der EU, zum anderen fordert sie keinen Einstellungsanspruch.[5]
Exkurs/Vertiefung: Eine Verschuldenszurechnung ist bei P nur über § 278 BGB möglich. Hätte der Geschäftsführer der D-GmbH gehandelt, läge ein Fall der Organhaftung vor und die Zurechnung würde über § 31 BGB erfolgen. Da die Organhaftung im weiteren Sinne als Repräsentantenhaftung verstanden wird,[6] wäre eine Zurechnung über § 31 BGB auch denkbar, wenn P als leitender Angestellter selbständig die Einstellungsentscheidungen treffen würde.