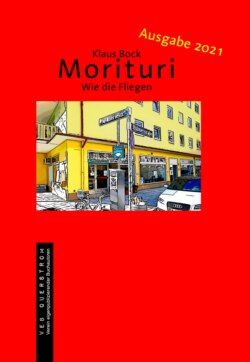Читать книгу Morituri - Klaus Bock - Страница 15
20. März. Im „Wiener Café“
Оглавление15.30 Uhr. Sarah, Udo, Hanna, der Graf und Tante Greten sowie ein paar andere Trauergäste aus dem Laden gingen durch das Café, mit etwas Abstand kamen noch Frau Z. und Herr F. hinterher. Das Café verströmte mit der Holz- und Messingeinrichtung und ein paar billigen Drucken an der Wand den Charme der Achtziger Jahre. Es durfte, wie auch immer, tatsächlich auch etwas „echten Wiener Schmäh“ für sich beanspruchen.
Es war leicht (oder doch schon ein bisschen mehr?) heruntergekommen, ohne dass man genau sagen konnte, woran sich dieser Eindruck festmachte...
Vielleicht lag es einfach an der etwas angeschmutzten Karte, aus der man mindestens zehn verschiedene Formen von Kaffee bestellen konnte: Vom Kleinen oder Großen Braunen, über Wiener Melange, Einspänner und Fiakerkaffee (mit Obstler und Schlagobers) zu Kaffee Maria Theresia (mit Orangenlikör, Schlagobers und bunten Zuckerstreuseln) bis hin zum (gar nicht mehr wienerischen) Pharisäer (mit Rum und Sahne).
Eine kleine Ausstellung von Handkaffeemühlen und Kaffeedosen aus Blech ergänzte das Interieur in Fachrichtung „Wiener Kaffee“.
Die ca. vierzig Plätze im eigentlichen Gastraum waren zu einem Drittel besetzt, die ebenfalls Gäste passten perfekt in das lädierte Ambiente. Sie hätten von einem Filmbesetzungsstudio stammen können: Die drei Paare aus jeweils zwei alten Damen, von denen immer mindestens eine ihren Löffel im Kaffee drehte und von denen ebenfalls immer mindestens eine unablässig sprach, wobei es offen blieb, ob die andere am Tisch ihr zuhörte; der alte Herr mit seiner Bulldogge unter dem Tisch, für die er einen eigenen kleinen Perserteppich mitgebracht hatte, auf dem der Hund gelangweilt und langsam und träge, ab und zu blinzelnd und mit hängender Zunge um sich schauend saß; die einzeln sitzende Dame, deren sehr dünne Haar“pracht“, die die Kopfhaut durchscheinen ließ, auf eine abgeschlossene Chemotherapie schließen ließ und zwei gemischtgeschlechtliche Paare, die sich gelangweilt nichts zu sagen habend stumm gegenüber saßen.
Die Gruppe durchquerte das Lokal, um in den hinteren Raum, der zum Garten große Fenster hatte, zu gelangen. Zwanzig Plätze waren auf mehreren Tischen eingedeckt, aber so viele waren sie gar nicht, einige Trauergäste waren gar nicht mitgekommen.
Hanna, Udo, Wolf-Dieter und Sarah nahmen an einem Tisch Platz, hielten aber zwei Plätze für Edgar und den Grafen frei, die sich noch das Grab von Väterchen Timofei auf dem Friedhof anschauen wollten.
Die anderen Trauergäste verteilten sich um Frau Z und Herrn F. auf die anderen beiden eingedeckten Tische. Man schaute sich die Karte an und bestellte Kaffee und Kuchen – „guten deutschen Kaffee“, um das ausländische, sprich „wienerische“ Zeug machten die meisten einen Bogen, weil man ja nicht wissen konnte, was man bekommen würde... Einige Gäste ließen sich zu den Kaffees mit Schnaps verleiten – kalt genug war es ja gewesen, um den anderen zu erläutern, dass man sich schließlich ein wenig aufwärmen müsse...
Inzwischen hatten auch der Graf und Edgar Platz genommen. Der Graf hatte einige Zeit gesucht, bis er den einzigen Bügel des Restaurants für seinen Mantel gefunden hatte. Was für ein gegensätzliches Paar: Der hagere, große und elegante Graf mit seinem vollen Blondhaarschopf und Edgar!
Kein Gutmeinender wurde Edgar als dick bezeichnen – eher als klein und am Bauch ziemlich kugelig, vielleicht... oder sogar wahrscheinlich. Nicht gut Meinende würden seine Beschreibung als „dick“ keinesfalls meiden wollen... Er war nie elegant gekleidet, auch nicht schick, er war der Typ, der nie vor den Auslagen eines Herrenausstatters stehen bleiben würde. Sein typisches Outfit bestand aus brauner Cordhose (erste Woche) oder grauer Cordhose (zweite Woche) oder beiger Cordhose (dritte Woche, eine vierte gab es nicht), kariertem Hemd (oberster Knopf geschlossen), grauem oder grauem Pullover mit V-Ausschnitt (ohne Ärmel, er nannte zwei identische sein Eigen) und Schuhe vom Karstadt-Sonderangebots-Grabbeltisch. Im Sommer trug er gerne Outdoor-Sandalen zu grauen oder braunen Socken. Ach ja, eine grau karierte Schiebermütze machte ihn zusammen mit der kurzen Pfeife unverwechselbar!
An seine Haare hatte er seit Jahren keinen Friseur mehr gelassen – was auch kein Friseur des Quartiers bedauerte, denn keiner könnte aus dem dünnen Kranz der verbliebenen Haare eine vernünftige Frisur herzaubern, noch könnte er gar den vollen Listenpreis berechnen, wenn er auch nur einen Funken Ehre im Leib hätte. Also erledigte Edgar das selber mit seinem Rasierer...
Essen war für ihn aber nicht Lust, sondern seit dem Tod seiner Frau nur noch Befriedigung eines elementaren Bedürfnisses – falls das Mittagessen, das er sich täglich um Punkt eins bei Frau Z. abholte, schon kalt war, wenn er endlich zuhause eintraf, stopfte er es ohne Murren in sich hinein, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass es wärmer sein könnte. Der Geschmack war ihm egal, was Frau Z. auf die Palme bringen konnte, gab sie sich doch so viel Mühe...
Meist las er beim Mittagessen die Zeitung oder eine Fachzeitschrift oder auch Teilelisten und die interessierten ihn viel mehr... Denn bei ihm drehte sich alles um sein Hobby: Modellbau. Genauer gesagt, Modelle, die sich fernsteuern ließen. Da war er ein echter Freak – nachdem er Schiffe und Boote für sich als modellbauerische Fingerübungen abgehakt hatte und Modellautos nicht sein Ding waren, beschäftigte er sich mit Flugzeugen!
Kein Wunder, als ehemaliger Flugzeug-Mechaniker der Bundeswehr war ihm das Fliegen in Fleisch und Blut übergegangen: Segelflugzeugmodelle, Motorflieger und insbesondere Hubschraubermodelle hatten seine ganze Liebe. Seine Wohnung war Warenlager, Werkstatt und Hangar zugleich.
Manchen Hubschrauber-Jungfernflug hatte er im nahe liegenden Olympiagelände gestartet – und die Zuschauer (meistens Männer) hatten fasziniert zugeschaut, wenn er die ersten Kunstfiguren flog.
Aber da man dort nicht fliegen (lassen) durfte und die „Schandis“ meist nicht weit waren, fuhr er oft weit raus aufs Land für seine Flugübungen – die „Vereinsmeierei“ der Modellflugvereine hasste er, da ging er nicht hin, auch wenn es manches vereinfacht hätte...
Als alle ihre Bestellung erhalten hatten und manche schon kräftig in den Kuchen „reinhauten“, bat Hanna um Ruhe. Sie saß zwar im Rollstuhl, aber ihre Ausstrahlung, veranlasste die Mehrzahl der anderen Gäste zu verstummen. Die letzten, die Schwatzhaften, wurden von den anderen mit einen gezischten „schhhh“ zum Schweigen gebracht.
„Die meisten von uns haben den Brief wohl nicht verstanden, den sie vorgelesen haben, Frau Z.“, sagte Hanna als es im Raum ruhig war, „es hat da drüben so gehallt, wissen Sie, würden sie uns Hannelores Worte bitte noch einmal vorlesen, ich glaube, hier wird man sie viel besser verstehen“.
Frau Z. stand auf, fingerte den Brief aus der Jackentasche und begann zu lesen. Atemlose Stille war im Raum – bis zum letzten Wort... und darüber hinaus.
„Ich meine, das kann man doch nicht machen, einfach einen zu erschießen, den man nicht mag, ich meine, wo kämen wir denn da hin, wenn jeder anfängt rumzuballern, wie es ihm gefällt?“, sagte Frau Plüschke unter ihrer lila Perücke.
„Sie meinen „ihr““, sagte jemand.
„Wie?“, fragte Frau Plüschke irritiert.
„Ihr gefällt... weil, Hannelore war eindeutig eine sie.“
„Ist doch egal, sie wissen doch, wie ich es meine...“, antwortete die wieder einmal kritisierte Frau Plüschke, die ja auch sonst nicht gerade beliebt war bei den anderen, beleidigt.
„Das Schwein wird es schon verdient haben!“, sagte wieder jemand.
„Ja, aber du sollst nicht töten, sagt die Bibel!“, gab die Frau aus der Parallelstraße zu bedenken.
„Wer fragt die Bibel?“, wollte jetzt Frau Z. wissen.
„Naja, die Gesetze, also unsere Gesetze verbieten es auch, übrigens in jedem zivilisierten Staat...“, sagte wieder die Parallelstraßenfrau.
„Schon“, sagte da eine ruhige Stimme bedächtig, „aber wenn jemand so alt ist und so krank und nur noch kurze Zeit zu leben hat, wer will dann jemanden wie die Hannelore hindern, es zu tun. Ich meine, da greift doch keine Drohung mit einer Strafe mehr...“, sagte Wolf-Dieter
„Weder im Diesseits noch im Jenseits, wenn du nicht an einen Gott glaubst, der dich im Jenseits bestrafen wird“, ergänzte Hanna, „und Hannelore hat nicht geglaubt, wie sie ja schreibt, also war sie frei. Absolut frei. Zumindest zu frei für unsere Gesetze, denn sie wusste, selbst wenn sie gefasst werden würde, würde sie nie ins Gefängnis kommen. Sie würde einfach sowieso früher sterben, früher, als dass die Schergen des Gesetzes sie noch festsetzen könnten.“
„Na, na“, sagte eine Stimme, „Schergen würde ich da jetzt nicht sagen.“
„Was ist denn das: Ein Scherge?“, fragte Frau Plüschke aus dem Hintergrund, sie ging gerade in Richtung Klo.
„Ein Büttel, Häscher, Folterer, auf jeden Fall nichts Gutes. Jedenfalls sollte man die Vertreter der demokratisch gewählten Staatsmacht nicht als Schergen bezeichnen.“
„Gut“, sagte Hanna einlenkend, „ich revoziere.“
„Was macht sie?“, fragte die Plüschke immer noch aus dem Hintergrund, sie schien eine dehnbare Blase zu haben.
„Sie nimmt das zurück!“, das war Wolf-Dieter.
„Was?“
„Das mit dem Schergen.“
„Ach so. Ist das wichtig?“, Frau Plüschke erhielt keine Antwort auf diese Frage und suchte endlich die „Damen“ auf.
„Die Frage ist doch“, sagte Wolf-Dieter, „wenn jemand nur noch eine sehr überschaubare Zeit zu leben hat, sagen wir einmal, unter einem Jahr oder gar nur noch ein halbes Jahr, und er oder sie entschließt sich, jemanden umzubringen, wer soll ihn oder sie daran hindern – wenn nicht etwas in ihm oder ihr selber?“
„Aus welchem Grund soll überhaupt jemand umgebracht werden?“
„Das spielt in der Situation doch nun wirklich keine Rolle mehr... moralisch ist das auf jeden Fall zu verdammen, da sind wir uns ja wohl einig, oder? Das ist ja wohl gesellschaftlicher Konsens, oder? Aber wenn sich jemand außerhalb dieser Moral gestellt hat, entweder weil es für ihn oder sie keine Moral mehr gibt oder weil er oder sie Moral nicht mehr anerkennt, was soll ihn respektive sie stoppen?“
„Oder sie?“
„Richtig, oder sie, wer oder was soll ihn oder sie davon abhalten, irgendjemanden umzubringen?“
„Sie meinen also schlussendlich, dass es individuelle Situationen geben kann, in der die Gesellschaft nicht in der Lage ist, gesetzes- oder moralkonformes Verhalten zu erzwingen? Der Mord also denkbar und eine realistische Größe wird?“
„Ja, das liegt doch auf der Hand - und Hannelore hat es bewiesen!“
„Sie befürworten ihren Mord?“
„Nein, das tue ich nicht! Ich sage nur, dass es Situationen gibt, in denen Menschen sich nicht mehr davon abhalten lassen, einen Mord zu begehen... sonst würde es ja auch keine Morde geben. Aber es gibt sie. Unbezweifelbar. Also gibt es auch die Situationen. Nur wollen die meisten Mörder nicht gefasst werden – das können sie in jedem Krimi sehen oder lesen. Der Mörder begeht seine Tat (vermutlich in einer Ausnahmesituation) und versucht dann – mehr oder weniger verzweifelt – seine Täterschaft zu vertuschen, weil er nicht für fünfzehn oder mehr Jahre in den Knast will.“
„Und was bedeutet das jetzt für uns?“
„Naja, für uns ja wohl nichts, denke ich, aber jemand, die oder der nur noch kurz zu leben hat, dem könnte alles egal sein – zumindest, was die Bestrafung angeht, weil er oder sie die nicht mehr erleben wird.“
„Ich verstehe das alles nicht“, kam es wieder aus dem Hintergrund, Frau Plüschke war fertig, „wollen wir jemanden umbringen?“.
„Nein! Wollen wir nicht, sie etwa?! Ach, ist ja auch Unsinn“, sagte Udo energisch, „ich finde wir sollen es dabei bewenden lassen... Hannelore hat etwas Fürchterliches gemacht und damit basta... ist doch inzwischen völlig egal, warum!“, und damit schlug er mit der flachen Hand so auf den Tisch, dass die Tassen auf den Untertassen klirrten, „Ende der Diskussion, sage ich! Und sie bleibt uns eine liebe Erinnerung!“
Damit waren alle einverstanden, Mord hin oder her, und die einzelnen Gespräche an den Tischen begannen wieder. Unter anderem wurde besprochen, ob es den Schweinebraten immer am Mittwoch geben müsse oder vielleicht auch mal am Dienstag. Als das erschöpfend - aber ohne Ergebnis - diskutiert war, ging es darum, ob die Königsberger Klopse mit mehr oder weniger Kapern besser schmecken würden. Am anderen Tisch wurde herzhaft besprochen, warum es „nicht einmal zu einem richtigen Kranz mit Schleife“ gereicht hätte, „sondern nur zu diesem unsäglichen Gefummel von Blumengestrüpp, wie sah denn das aus, bitteschön?“. Einige wollten beim nächsten Mal wieder einen Kranz, einen klassischen, andere fanden aber den Blumenteppich besonders schön, „irgendwie, als ob die Hannelore damit geradewegs in den Himmel fliegen würde...“, was lautstarke Proteste hervorrief, denn „einen fliegenden Teppich würde es wohl eher bei den Islamisten oder wie die heißen, den Arabern halt geben, als bei uns guten Christen.“ Erst der Hinweis, dass Hannelore wohl erstens keine gute Christin gewesen sei und zweitens, selbst wenn, nach Mord und Selbstmord wohl eher in der Hölle schmoren werde, als im Himmel die Lyra (oder die Harfe, ist doch egal) schlüge, brachte diese Diskussion zu einem Ende.
Nach einer weiteren Tasse Kaffee (dem deutschen) erhob sich Udo und sagte, er würde jetzt mal schauen, ob das Taxi vor der Tür stünde, wenn nicht, würde er vielleicht fünf oder zehn Minuten brauchen, dann sollten sie mit Hanna herauskommen. Und leise fügte er hinzu, so, dass man das nur an ihrem Tisch verstand, dass sie ja zuhause weiterreden könnten, da seien vorhin ja einige interessante Aspekte dabei gewesen und die solle man doch nicht vergessen...