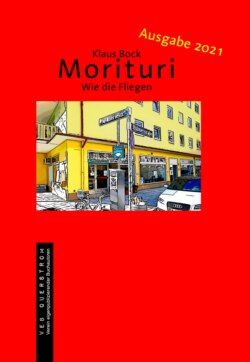Читать книгу Morituri - Klaus Bock - Страница 3
26. Februar. Salvatorplatz, München
ОглавлениеGewidmet…
… der echten Hanna, die nie auch nur einer Fliege etwas zuleide tun konnte, und die leider viel zu früh starb
und
ihrem Kater „Herr Freitag“, der Chef im Hof war und so manche Maus und mehr nach Hause brachte
23.30 Uhr. Sie saßen zu dritt im Wagen. Zwei alte Männer und eine alte Frau. Es war stockdunkel hinter der alten griechisch-orthodoxen Kirche am Salvatorplatz gleich neben dem Literaturhaus. Die Kirche strahlte etwas Düsteres aus.
Ein empfindsamer Mensch hätte vielleicht sogar ein Kraftfeld verspürt, das von den dicken fast schwarzen Mauern ausging, als ob die Masse der Kirche eine Delle in das Raumzeitgefüge drücken würde.
Aber keiner der drei schaute die eindrucksvoll aufragenden Backsteinmassen der Kirche an, auch sagte niemand etwas – es war sowieso alles gesagt, fanden sie. Der Fahrer rauchte die x-te Zigarette seit sie hier geparkt hatten. Ab und zu hustete er keuchend. Er klang dann gar nicht gut!
„Du wirst noch einmal an den Zigaretten krepieren“, sagte die Beifahrerin leise.
„Ich weiß“, antwortete der Fahrer ebenso leise, „wahrscheinlich bald... Na und? Sollte ich deshalb aufhören?“
Ein Handy meldete sich vibrierend auf der Mittelablage. Der Fahrer nahm das Gerät in die Hand, schaute auf das Display, nahm das Gespräch an, meldete sich aber nicht, hörte nur einen Moment lang zu, dann sagte er knapp: „Okay!“
Er klappte das Telefon zu, steckte es in die Jackentasche, drehte sich zu der alten Frau neben ihm und sagte leise: „Er kommt. Gleich!“
Als der alte Herr, auf den sie so geduldig gewartet hatten, um die Ecke der Salvatorkirche hinkte, nickte der Fahrer mit dem Kinn in seine Richtung und sagte in die Dunkelheit: „Da ist er …“, und der andere sagte von hinten: „Hannelore, du musst jetzt nicht … Das weißt Du. Niemand wird es dir vorwerfen, wenn du jetzt doch nicht aussteigst, noch kannst du zurück, noch ist nichts passiert!“
Sie schüttelte nur wortlos den Kopf, öffnete entschlossen die Autotür und begann auszusteigen. Das Aussteigen war schmerzhaft, richtig schmerzhaft, verdammt. Diese Schmerzen ließen sich ohne Morphium nicht mehr aushalten. Morphium zu nehmen, war für sie kein Problem. Eher es zu bekommen, denn der Arzt meinte, sie könne süchtig werden und stellte ihr viel zu selten ein Rezept aus.
Dieses miesepetrige Arschloch von Doktor, als ob ihr ihre Sucht in ihrer Situation noch etwas ausmachte. Was glaubte der denn, warum sie ihn immer wieder angebettelt hatte, ihr „das Zeug“ zu verschreiben, etwa weil sie es lustig fand oder weil sie danach „fliegen“ wollte?
Sie brauchte es. Punkt. Ohne Morphium waren die Schmerzen nicht mehr auszuhalten! Klar, es dämpfte auch – aber das war nur gut, fand sie. Für die nächsten Momente jedoch wollte sie einen klaren Kopf haben – also hatte sie kein Morphium genommen, also spürte sie die verdammten Schmerzen!
Als sie draußen war, beugte sie sich mühsam ins Auto und sagte: „Adieu, und danke!“
Der alte Herr war inzwischen nähergekommen, ging über den dunklen Platz in Richtung seines Autos, das drei Wagen vor ihrem geparkt war.
Sie hörte seinen Stock auf dem nassen Pflaster: Tock, tock, tock …
Sie hatte die Autotür leise geschlossen und ging langsam auf den Mann zu. Ihr Stock machte das gleiche Geräusch wie seiner, nur langsamer. Sie schaute ihn an, er sah irgendwie immer noch so aus wie früher, nur waren seine Haare weiß geworden. Komisch, dachte sie, wie wenig sich Menschen verändern: Sie mögen alt und krumm werden, sie mögen keuchen und krauchen, sie mögen die Haare verlieren, sie bleiben doch dieselben!
Als sie sich an seinem Auto trafen, hatte er immer noch nicht in ihre Richtung geschaut, geschweige denn, dass er sie angeschaut hätte, er kümmerte sich nicht um sie, machte sogar einen kleinen Bogen, als er sie endlich wahrnahm und bediente die Fernbedienung seines Autos, als ob sie nicht da wäre.
Sie hob ihren Stock in Brusthöhe in seinen Weg, und er schaute sie erstaunt an. „Was soll das?“, fragte er.
Sie ging nicht auf seine Frage ein, stattdessen sagte sie: „Kennst du mich denn nicht mehr?“
Er schaute sie erstaunt an und schüttelte den Kopf: „Sollte ich?“
„Eigentlich schon“, sagte sie, „es ist zwar lange her … Aber du solltest die Mutter deiner Tochter doch erkennen – auch wenn ich inzwischen alt und hässlich geworden bin.“
Er schaute sie an, drehte sich ein wenig, damit das Licht der Straßenlaterne auf ihr Gesicht fiel. Dann kam ein Erkennen auf sein Gesicht: „Du? Du bist es?“, fragte er, „Was willst du denn? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen würden.“
„Das glaube ich dir“, sagte sie, „es sind übrigens zweiundvierzig Jahre“, und dann fuhr sie nach einer Pause fort: „Ziemlich genau zweiundvierzig verdammt lange Jahre.“
„Wie geht es dir?“, fragte er. Interesse klang anders.
„Ist doch scheißegal“, antwortete sie leise, und sie verspürte keine Schmerzen in diesem Moment, „das hat Dich nie interessiert und das Schicksal Deiner Tochter auch nicht … Nicht einmal, als sie gestorben ist! Du bist bei ihrer Geburt weggelaufen … Du hast dich einen Dreck um uns, um sie gekümmert. Du musstest ja Karriere machen, du, der berühmte Professor Doktor Doktor, natürlich ohne uns! Eine behinderte Tochter hätte ja nur gestört.“
Während sie redete, nestelte sie in ihrer Manteltasche und zog schließlich eine alte Pistole heraus.
„Aber du läufst nicht mehr weg, nie wieder!“
„Weißt du …“, begann er unsicher, und als er die Waffe schemenhaft sah, sagte er: „… was soll denn das? Was machst du denn da?“
„Halt einfach den Mund“, unterbrach sie ihn, „denn jetzt ist es zu spät!“
Als er sie anschaute, schaute sie zurück. Einen Moment lang passierte nichts.
Mit dem ersten Schuss schoss sie ihm die Eier weg. Er schrie nicht, blickte sie aber erstaunt an, ließ den Stock fallen, griff sich in den Schritt und sank dann – sie immer noch erstaunt ansehend – langsam zusammen.
Der zweite Schuss traf ihn in den Bauch. Da schaute er schon nicht mehr. Und als er am Boden lag, wartete sie – lange, dann endlich schoss sie ihm die dritte Kugel in den Kopf.
Die Schüsse waren gar nicht so laut gewesen, wie sie gedacht hatte.
Niemand kam aus der Dunkelheit gelaufen, um nachzuforschen, ob das Schüsse gewesen waren, und wer da auf wen geschossen haben mochte. Andererseits war die Gegend hinter der Salvatorkirche und dem unmittelbar benachbarten Literaturhaus nachts ziemlich verlassen, unwahrscheinlich, dass sich jemand dorthin verirrte. Außerdem wäre es ihr völlig egal gewesen.
Mit ihrem Stock stupste sie ihn an. Erst leicht, dann noch einmal etwas fester. Er rührte sich nicht mehr. Tot. Er war ein totes Stück Fleisch. Tot. Wie ein Stück Rindfleisch beim Metzger.
Sie war es zufrieden!
Sie schaute ihn noch einmal an, machte aber keinerlei Anstalten wegzulaufen. „Habe ich dich zum Schluss doch noch gekriegt, du Schwein …“, flüsterte sie.
Sie wunderte sich selber, dass sie gar nichts fühlte, weder Reue noch Befriedigung. Eigentlich fühlte sie sogar nur eine große Leere in sich.
Sie blickte zum Auto, mit dem sie gekommen waren, und winkte dann den beiden für sie fast unsichtbaren Insassen mit einer unsicher aussehenden Bewegung zu.
Jetzt fühlte sie doch etwas, urplötzlich waren die Schmerzen wieder da. Sie krümmte sich unwillkürlich zusammen, es tat plötzlich wieder alles so verdammt weh.
Sie hob die Pistole, schaute sie lächelnd an, ungefähr so, wie man einen guten Freund anschaut und schob sie sich in den Mund.
Dann gab einen vierten Schuss und sie war tot. Genauso tot wie er.
Ein paar Meter weiter fuhr ein dunkler Golf aus der Parklücke heraus und verschwand durch die Salvatorstraße in Richtung Rochusberg. Am Maximiliansplatz begegneten sie dem ersten Auto, aber da waren sie schon weit weg vom Ort des Geschehens.
„Sie hat es also tatsächlich gemacht“, sagte Wolf-Dieter, „ich habe nicht geglaubt, dass sie es tun könnte. Soll doch gar nicht einfach sein, einen Menschen zu erschießen, oder?“
„Wer sagt, dass es leicht für sie war? Aber sie wollte ihn sterben sehen, unbedingt … Ich glaube, das hat sie noch am Leben gehalten, das war das letzte Ziel, das sie noch hatte, das hat sie am Leben gehalten. Bei den Schmerzen… Wahrscheinlich wäre sie auch so bald gestorben.“ Und nach einer Weile fuhr Udo fort: „Und jetzt?“
„Warten wir!“
„Worauf?“
Wolf-Dieter zuckte mit den Schultern. „Dass die Polizei kommt, ihre Untersuchungen macht, feststellt, dass es Hannelore war, die ihn erschossen hat. Vielleicht werden sie Unterstützer suchen und uns hoffentlich nicht finden!“
Wolf-Dieter lachte kurz und trocken auf. „Warum sollten die großes Tamtam machen? Opfer tot, Mörderin daneben gefunden, sozusagen mit noch rauchender Pistole in der Hand, aber tot, Abschiedsbrief in ihrer Tasche – was sollen die Bullen mehr wollen?
Die Presse wird sich zwei oder drei Tage lang darauf stürzen, der Kerl war schließlich bekannt wie ein bunter Hund. Dann wird Hannelores Leiche freigegeben und wir können sie beerdigen, als die letzten Freunde, entfernte Freunde, eher Bekannte, die von nichts wissen und die natürlich absolut geschockt sind.
Nein, Herr Kommissar, das hätten wir uns nie vorstellen können, dass die gute alte Hannelore ihren Ex umnieten würde, wir wussten ja gar nichts von dessen Existenz, unvorstellbar, Herr Kommissar! Ich meine, der Grund für den Mord ist ja mehr als vierzig Jahre her, Herr Kommissar, das steht jedenfalls in der Zeitung … Stimmt denn das? Nein, darüber hat sie nie gesprochen, sie war ja sowieso sehr in sich gekehrt, Herr Kommissar.“
„Und die Waffe? Ich meine, wenn wir gefragt werden?“
„Waffe? Welche Waffe? Kennen wir nicht. Wir wussten ja nicht einmal, dass sie eine hatte! Ich habe sie nie mit einer Waffe gesehen, wußte nicht, dass sie eine besaß. Klar, ihr Vater war hoher Offizier im Krieg gewesen, im zweiten, Herr Kommissar, das war lange vor Ihrer Zeit, vielleicht hat sie die Waffe von dem geerbt? Und kann so eine alte Pistole denn überhaupt noch funktionieren? Naja. Muss sie ja wohl, Herr Kommissar, haha … Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen kann, man hört ja so vieles, Herr Kommissar.“
„Glaubst du ernsthaft, dass die uns verhören wollen..., werden?“
„Keine Ahnung, vielleicht, eher wohl nicht, aber wir müssen damit rechnen. Du, ich weiß ja auch nicht mehr, als man aus den Krimis im Fernsehen von der Arbeit der Kripo sieht. Aber man darf die sicher nicht unterschätzen. Die werden ihre Wohnung durchsuchen, klar, vielleicht werden sie auch die Nachbarn befragen, mit wem sie verkehrt hat.“
„Dann kommen sie auf uns?“
„Auf uns? Warum? Eher auf den Laden, da war sie ja regelmäßig …“
„Und dann auf uns, weil wir da auch immer sind?“
„Warum – wir sind doch nur Kunden, man hat sich gesehen, man hat sich bei der einen oder anderen Beerdigung getroffen, man hat ihr schon mal das Essen gebracht, wenn es ihr schlecht ging, Herr Kommissar, also mal der Eine, mal die Andere. Man wusste natürlich um ihre Krankheit, man hatte ja denselben Arzt, aber man war nicht wirklich befreundet, in unserem Alter, Herr Kommissar, da knüpft man keine Freundschaften mehr, wissen Sie.“
„Und wie ist sie zur Salvatorkirche gekommen?“
„Keine Ahnung? Straßenbahn? U-Bahn? Sie hatte doch extra die abgestempelte Streifenkarte in der Tasche.“
„Du meinst, die Bullen werden glauben, sie war ganz allein?“
„Das will ich doch hoffen, Udo. Warum sollten sie nicht? War sie doch auch, völlig allein! Wer, der nicht sehr allein ist, macht denn so etwas – in dem Alter und so krank? Verzweiflungstat, reine Verzweiflungstat.“