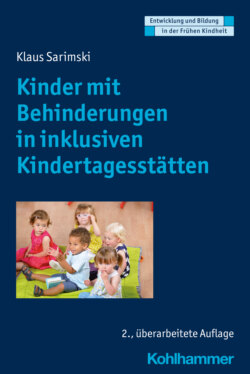Читать книгу Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten - Klaus Sarimski - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Sozial-kognitive Fähigkeiten und emotionale Selbstregulation
ОглавлениеSoziale Kompetenzen in der Interaktion mit anderen Kindern lassen sich definieren als die Fähigkeit, eigene (soziale) Ziele in angemessener Form und mit Erfolg in der Gruppe verfolgen zu können. Soziale Herausforderungen liegen dabei vor allem in der aktiven Kontaktaufnahme zu anderen Kindern, der Beteiligung an einem gemeinsamen Spiel und der Lösung von Konflikten, die dabei entstehen. Die Bewältigung dieser Aufgaben erfordert sowohl Fähigkeiten der sozialen Informationsverarbeitung (soziale Kognition) wie auch der emotionalen Selbstregulation.
Zu den sozial-kognitiven Prozessen gehört
• die Aufmerksamkeit für soziale Signale,
• ihre angemessene Interpretation,
• das Verstehen sozialer Absichten und Zusammenhänge,
• das Beachten sozialer Regeln und
• ein Wissen um Handlungsstrategien zum Verfolgen eigener Ziele
• sowie die Fähigkeit, diese Handlungsstrategien und ihre Konsequenzen zu bewerten.
Emotionale Selbstregulation umfasst die Fähigkeiten,
• die eigenen Handlungen zu steuern und
• emotionale Reaktionen wie Ärger oder Ängstlichkeit zu kontrollieren (Dodge, Pettit, McClaskey & Brown, 1986; Guralnick, 1999).
Die Entwicklung sozialer Kompetenz ist von individuellen und sozialen Faktoren abhängig. Zu den sozialen Faktoren gehören
1. die Erfahrungen, die ein Kind in seiner Familie im Rahmen der Eltern-Kind-Beziehung oder der Beziehung zu seinen Geschwistern macht,
2. die Konstellation der Gruppe, auf die es trifft, sowie die Qualität des sozialen Klimas in dieser Gruppe
3. und die Unterstützung durch die pädagogische Fachkraft.
Zu den individuellen Faktoren gehören seine Temperamentsanlage, seine Fähigkeiten zu Aufmerksamkeitssteuerung, kognitiver Verarbeitung, Handlungsplanung und Gedächtnisleistungen, die ihm als grundlegende kognitive Funktionen zur Bewältigung von Alltagsanforderungen zur Verfügung stehen, sowie seine kommunikativen Fähigkeiten. Sie sind für die Abstimmung der Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Thema mit einem Interaktionspartner, die Mitteilung eigener Wünsche und Vorhaben sowie das Aushandeln von Absprachen und Konfliktlösungen von Bedeutung. Hay, Payne und Chadwick (2004) leiteten in einer Übersichtsarbeit daraus sechs Vorläuferfertigkeiten ab, die Kinder in den ersten Lebensjahren als Voraussetzung für harmonische Interaktionen mit Gleichaltrigen und die Bildung von Freundschaften entwickeln ( Abb. 3).
Abb. 3: Vorläuferfähigkeiten für die Entwicklung harmonischer Beziehungen mit Gleichaltrigen (Daten aus Hay et al., 2004)
Kinder mit Behinderungen können in der Entwicklung sozialer Beziehungen zu anderen Kindern in vielfältiger Weise beeinträchtigt sein. Schwere Hör- oder Sehschädigungen haben unmittelbaren Einfluss auf die Möglichkeiten zur sozialen Beteiligung, kognitive Behinderungen erschweren das Verständnis sozialer Situationen und den Erwerb von sozialen Handlungsfähigkeiten, Störungen des Spracherwerbs können die Verständigung über gemeinsame Spielideen, Störungen der Selbstregulation die Steuerung der Aufmerksamkeit, der eigenen Handlungen und der emotionalen Reaktion in kritischen Momenten misslingen lassen. Schwierigkeiten in der Gestaltung sozialer Beziehungen lassen sich aus einer Kombination dieser individuellen Voraussetzungen der Kinder und der Rahmenbedingungen, auf die sie im Kindergarten treffen, verstehen. Die Untersuchungsergebnisse zur Bedeutung dieser Rahmenbedingungen sollen zunächst vorgestellt werden, bevor spezifische Probleme und pädagogische Interventionen bei den einzelnen Behinderungsformen in den Kapiteln 3 und 4 erörtert werden.