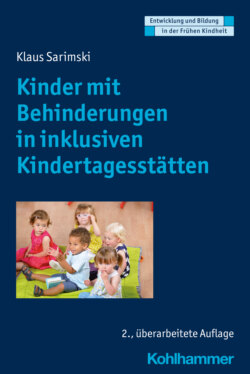Читать книгу Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten - Klaus Sarimski - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Studie: Inhaltliche Aktivitäten von behinderten und nicht behinderten Kindern in integrativen Gruppen
ОглавлениеOdom, Zercher, Marquart, Li, Sandall und Wolfberg (2002) berichteten über eine umfangreiche Untersuchung in integrativen Einrichtungen, bei der die aktive soziale Beteiligung von 112 (30 dreijährigen, 64 vierjährigen und 18 fünfjährigen) Kindern an sechs verschiedenen Terminen mit einem differenzierten Beobachtungsinstrument beurteilt wurde. Dabei zeigte sich, dass Kinder mit und ohne Behinderungen etwa gleich viel Zeit in Einzelbeschäftigungen, Kleingruppenaktivitäten mit einer pädagogischen Fachkraft oder in der Gesamtgruppe verbrachten. Kinder mit Behinderungen waren jedoch häufiger in 1:1-Aktivitäten mit einer pädagogischen Fachkraft involviert. Kinder ohne Behinderungen verbrachten mehr Zeit in selbst organisierten Kleingruppenaktivitäten. Die Verteilung der Aktivitäten, denen sie sich zuwendeten, unterschied sich nur wenig. Kinder mit und ohne Behinderung verbrachten die Zeit überwiegend mit Bewegungsspielen, feinmotorischen Beschäftigungen mit Spielsachen, in der Kreisrunde und mit Mahlzeiten. Das Anschauen von Bilderbüchern, Singen, Malen und Rollenspiele machte einen kleinen Teil der Zeit aus. Regelspiele wurden nur selten beobachtet ( Tab. 3).
Der relative Anteil von selbst-initiierten (d. h. nicht von einer pädagogischen Fachkraft angeleiteten Aktivitäten) lag in beiden Gruppen bei etwas über 40 %, wobei die Schwankungen zwischen den einzelnen Einrichtungen, in denen die Kinder beobachtet wurden, sehr groß waren. Dialoge mit den Kindern oder direkte Aufforderungen der Erzieherinnen machten in beiden Gruppen etwa 20 % aus. Kinder mit Behinderungen erhielten etwa dreimal so häufig die Unterstützung der pädagogischen Fachkraft wie Kinder ohne Behinderungen. Sie selbst wendeten sich etwa doppelt so oft an den Erwachsenen als die Kinder ohne Behinderungen. Kinder ohne Behinderungen richteten mehr positive Verhaltensweisen an die anderen Kinder als die Kinder mit Behinderungen, negative Interaktionen traten generell sehr selten in der Beobachtungszeit auf. Zusammenfassend zeigt also auch diese Studie, dass Kinder mit Behinderungen mehr direkte Kontakte mit den pädagogischen Fachkräften haben, mehr Hilfestellungen bekommen, sich aber seltener von sich aus an andere Kinder zum gemeinsamen Spiel wenden.
Tab. 3: Auswahl an Aktivitäten behinderter und nicht behinderter Kinder in integrativen Gruppen (in %) (Daten aus Odom et al., 2002)
behinderte Kindernicht behinderte Kinder
Anmerkung: Nur eine Auswahl an Kategorien, daher summieren sich die Spalten nicht zu 100 %.
Behinderte Kinder bevorzugen – wenn sie die Möglichkeit dazu haben – nicht behinderte Kinder als Spielpartner (Guralnick et al., 1996). Zumindest für Kinder mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten bedeutet das aber nicht, dass sie das gleiche Niveau von Spiel- und Sozialkompetenzen erreichen wie Kinder gleichen Alters mit unbeeinträchtigter Entwicklung. Kinder mit Lernbeeinträchtigungen haben vielmehr weniger und kürzere soziale Kontakte als sie, zeigen mehr negative Verhaltensweisen und weniger Kompetenz zur Konfliktlösung und haben weniger Erfolg bei ihrem Versuch, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen.
Das liegt nicht an mangelnder Bereitschaft der nicht behinderten Kinder, sich auf sie einzustellen. Kinder mit Behinderungen werden deutlich seltener als erste Wahl von Spielpartnerinnen und Spielpartnern in Spielsituationen genannt (Ytterhus, 2008). Wenn ältere Kinder mit unbeeinträchtigter Entwicklung sich ihnen im Kindergarten zuwenden, versuchen sie jedoch (wie in der Interaktion mit jüngeren Kindern), sich an die Verständnis- und Kommunikationsschwierigkeiten der behinderten Kinder anzupassen. Sie vereinfachen z. B. ihre Sprache und geben klare Anweisungen, übernehmen die Organisation von Spielabläufen; dennoch kommt es häufiger zu Konflikten, die die Interaktionen belasten.
Eindeutig bevorzugen sie jedoch nicht behinderte Kinder als Spielpartner/-in (Guralnick, 1999; Guralnick, Connor, Hammond, Gottman & Kinnish, 1995; Guralnick & Paul-Brown, 1989; Guralnick, Paul-Brown, Groom & Booth, 1998; Odom et al., 2002; Yu, Ostrosky & Fowler, 2015). Darin zeigt sich die Bedeutung des kommunikativen Austauschs für die Entwicklung sozialer Beziehungen. Kinder mit eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten sind in dieser Hinsicht benachteiligt und haben einen spezifischen Hilfebedarf.
Suhonen, Nislin, Alijoki und Sajaniemi (2015) beobachteten das Spielverhalten von 124 Kindern ohne und 89 Kindern mit besonderem Förderbedarf in integrativen Gruppen in Finnland. Es handelte sich um Kinder mit Sprachbehinderungen, Verhaltensauffälligkeiten und globaler Entwicklungsstörung. Sie waren wesentlich weniger an sozialen Spielformen beteiligt. Die Unterschiede waren bei Kindern mit globaler Entwicklungsstörung besonders deutlich.