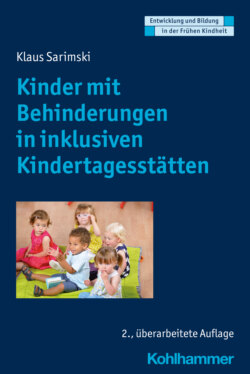Читать книгу Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten - Klaus Sarimski - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Entwicklungsverläufe bei integrativer Förderung
ОглавлениеDie Übersicht über die Forschung erlaubt somit zwei Schlussfolgerungen:
1. Die Voraussetzungen zur Entwicklung positiver sozialer Beziehungen behinderter Kinder zu anderen Kindern – Häufigkeit sozialer Kontakte und Bildung von Freundschaften – sind in integrativen Gruppen günstiger als in Sondereinrichtungen.
2. Jedoch besteht auch in diesem Kontext ein besonderer Hilfebedarf bei Kindern mit eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten zur Förderung sozialer Kompetenzen.
Kommunikative Fähigkeiten im Dialog, Initiative und Ausdauer im sozialen Spiel, Verstehen sozialer Absichten und Situationen, Empathie, emotionale Selbstregulation, Flexibilität und Strategien zur Konfliktlösung sind Voraussetzungen für das Gelingen sozialer Integration.
Eine effektive pädagogische Arbeit an diesen Zielen erfordert eine sorgfältige Beobachtung der Fähigkeiten und des Hilfebedarfs des einzelnen Kindes. Die Ziele und pädagogischen Handlungsstrategien sind für jedes Kind individuell zu bestimmen. Eine befriedigende soziale Integration ist erst dann erreicht, wenn die sozialen Beziehungen des behinderten Kindes eine ähnlich positive Qualität haben wie die Beziehungen der nicht behinderten Kinder in der Gruppe – und wenn seine Fortschritte in motorischen, kognitiven, sprachlichen und adaptiven Kompetenzen zumindest nicht geringer sind als beim Besuch einer Einrichtung für behinderte Kinder.
Ebenso große Fortschritte in integrativen Gruppen wie in separierten Einrichtungen. Ältere Forschungsarbeiten zum Entwicklungsverlauf behinderter Kinder – beurteilt mit standardisierten und normierten Entwicklungstests – kommen durchweg zu dem Schluss, dass sie sich unter integrativen Bedingungen ebenso gut entwickeln wie in Sondergruppen, d. h. sie von den dort bestehenden kleineren Gruppen und der dort gebotenen sonderpädagogischen Förderung per se nicht mehr profitieren (Fewell & Oelwein, 1990; Harri, Handleman, Kristoff, Bass & Gordon, 1990; Jenkins et al., 1989). Die Mehrzahl dieser Studien bezog sich allerdings auf relativ kleine Stichproben; so umfassten nur drei der 22 Studien, über die Buysse und Bailey (1993) in einer Übersichtsarbeit zu dieser Frage berichteten, mehr als 30 Kinder.
Bruder und Staff (1998) berichten z. B. über den Entwicklungsverlauf von 37 Kindern, von denen im Alter von zwei Jahren 18 Kinder in eine sonderpädagogische und 19 Kinder in eine integrative Gruppe aufgenommen wurden, über einen Zeitraum von sechs und zwölf Monaten. Bei 14 Kindern lagen allgemeine Entwicklungsrückstände vor, bei je neun Kindern körperliche oder mehrfache Behinderungen, bei zwei Kindern eine geistige Behinderung, bei je einem Kind eine Sinnesbehinderung oder Autismus-Spektrum-Störung. Zu jedem der drei Messzeitpunkte wurde ein allgemeiner Entwicklungstest, ein Motoriktest und ein Sprachtest durchgeführt. Die täglichen Betreuungszeiten in der integrativen Gruppe waren zwei Stunden pro Woche länger; die Kinder, die eine Einrichtung für behinderte Kinder besuchten, erhielten doppelt so viel zusätzliche Einzelförderung (vor allem Sprach- und Ergotherapie). Die integrativen Gruppen umfassten mehr Kinder; die Zahl der pädagogischen Fachkräfte und die pädagogische Qualität der Betreuungseinrichtungen (beurteilt mit einem Ratingverfahren) unterschieden sich nicht. Die Ergebnisse der Entwicklungstests zeigten in beiden Gruppen einen gleich großen Fortschritt: Demnach führte das höhere Maß an Einzeltherapien, das die Kinder in den sonderpädagogischen Gruppen erhielten, nicht zu einem besseren Entwicklungsverlauf als die zeitlich längere Betreuung in den integrativen Gruppen.