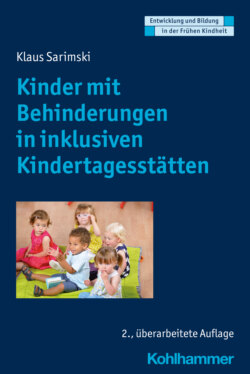Читать книгу Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten - Klaus Sarimski - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.1 Spielangebot und -inhalte
ОглавлениеZu den materiellen Rahmenbedingungen gehören die räumlichen Gegebenheiten in der Gruppe, die Art der verfügbaren Spielmaterialien, die Zahl der Kinder in der Gruppe und der Personalschlüssel, d. h. das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen. Klar voneinander abgegrenzte Bereiche für die verschiedenen Aktivitäten in der Gruppe begünstigen z. B. die Bildung von Kleingruppen und die aktive Beteiligung der Kinder. Eine geringe Ausstattung mit Spielsachen kann Konflikte zwischen den Kindern eher provozieren. Bei einem reichhaltigen Spielzeugangebot besteht andererseits die Möglichkeit, dass sich die Kinder ausgiebig allein beschäftigen, statt miteinander zu spielen. Puzzles, Knete und Bücher legen eher eine isolierte Beschäftigung nahe, Sand, Wasserspielzeug und Buntstifte eher parallele Aktivitäten, Puppen, Haushalts- und Verkleidungsmaterial eher ein soziales Spiel.
Ivory und McCollum (1999) beobachteten die Spielformen behinderter Kinder und variierten dabei systematisch die Verfügbarkeit von Spielsachen. Kooperatives Spiel mit anderen Kindern ergab sich häufiger, wenn solche Materialien verfügbar waren. Doch auch bei einem breiten Angebot von Spielsachen bleiben Unterschiede, welche Aktivitäten Kinder mit und ohne Behinderung bevorzugen.
Belege für die Bedeutung des Spielangebots für die Entwicklung sozialer Kontakte behinderter Kinder finden sich in einer Meta-Analyse von 13 Studien von Kim et al. (2003), die zeigte, dass die Verfügbarkeit von Spielsachen, die zu sozialen Aktivitäten einladen, einen nachhaltigen Einfluss auf die aktive soziale Beteiligung der Kinder in einer Gruppe hat. Häufiger sind sie auch bei Aktivitäten, bei denen eine gewisse Struktur vorgegeben ist (z. B. Doktorspiele oder Kaufläden), seltener bei wenig strukturierten Beschäftigungen (z. B. Wasserspiele, Malen; DeKlyen & Odom, 1989).
Kohl und Beckman (1984) beobachteten die sozialen Kontakte bei 3- bis 5-jährigen Kindern. Während soziale Interaktionen zwischen Kindern ohne Behinderungen in den Freispielzeiten am häufigsten (und doppelt so oft wie bei behinderten Kindern) zu beobachten waren, entstanden soziale Kontakte der behinderten Kinder am häufigsten während der gemeinsamen Mahlzeiten. Für die pädagogische Praxis bedeutet dies, dass die Strukturierung des Gruppengeschehens und die Anregung zu sozialen Spielformen eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen sozialer Integrationsprozesse sind.