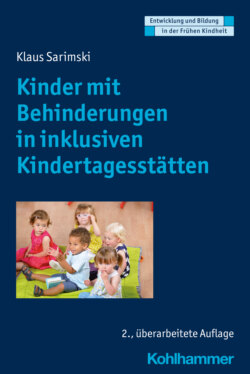Читать книгу Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten - Klaus Sarimski - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.2 Einfluss von Betreuungskontext, Art der Behinderung und familiärer Vorerfahrung auf die Bildung von Freundschaften
ОглавлениеBerichte von Eltern und pädagogischen Fachkräften sprechen dafür, dass zumindest junge Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen weniger reziproke Freundschaftsbeziehungen zu anderen Kindern ausbilden als Kinder ohne Behinderungen gleichen Alters (Buysse, Nabors, Skinner & Keyes, 1997).
Buysse, Goldman und Skinner (2002) analysierten den Effekt unterschiedlicher Betreuungskontexte auf die Zahl der Freundschaften bei 330 Kindern im Alter zwischen 19 und 77 Monaten, darunter 120 Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen. 15 % der nicht behinderten, aber 28 % der behinderten Kinder hatten nach Einschätzung der pädagogischen Fachkraft keinen Freund/keine Freundin. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind mindestens einen Freund/eine Freundin hat, war (um das 1.7-fache) höher, wenn das Kind eine integrative Gruppe statt eines Sonderkindergartens besuchte. Die Schwere der Behinderung spielte für die Zahl der Freunde/Freundinnen keine Rolle.
Die Befunde zu Freundschaftsbeziehungen sind jedoch nicht einheitlich. Kinder mit geistiger Behinderung finden – unabhängig davon, ob sie integrative oder homogen zusammengesetzte Gruppen besuchen – signifikant seltener Freunde/Freundinnen als Kinder mit leichteren (z. B. sprachlichen) Entwicklungsstörungen. Diese Schwierigkeiten in der Entwicklung reziproker Freundschaften sind offenbar dauerhaft. Sie finden sich auch bei Verlaufsstudien, wenn Kinder mit kognitiven Entwicklungsstörungen in den ersten Schuljahren in integrativen Klassen nachuntersucht werden (Guralnick, Neville, Hammond & Connor, 2007). Kinder mit leichteren (Sprach-) Behinderungen unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von Kindern mit unauffälliger Entwicklung (Guralnick et al., 1996).
Die Häufigkeit sozialer Kontakte und die Entwicklung von positiven Beziehungen zu anderen Kindern der Gruppe hängen auch von den Vorerfahrungen ab, die die Kinder im Kontext der Familie gemacht haben. Die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ist ein bedeutsamer Prädiktor für die Entwicklung sozialer Beziehungen zu anderen Kindern; d. h. Kinder mit positiven Beziehungserfahrungen und einer sicheren Bindung zu ihren Eltern entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit auch im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung positive soziale Beziehungen. In der alltäglichen Interaktion mit ihren Eltern erleben sie z. B., wie Emotionen am mimischen Ausdruck zu erkennen sind, Gefühle reguliert werden können, mit Ärger und Konflikten umgegangen wird (Guralnick, 1999).
Eltern können soziale Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern explizit fördern, indem sie dem Kind z. B. bei Besuchen oder auf dem Spielplatz zeigen, wie es mit anderen Kindern in sozial angemessener Form Kontakt aufnehmen, sie ansprechen oder Konflikte lösen kann. Sie können ihrem Kind helfen, in Kontakt mit anderen Kindern zu kommen, indem sie soziale Netzwerke aufbauen, um es Erfahrungen mit sozialen Situationen sammeln zu lassen. Eltern behinderter Kinder bleibt dafür oft weniger Zeit, weil sie mit vielfältigen Anforderungen in Therapie und Alltag ausgelastet sind.
Guralnick, Connor, Neville und Hammond (2002) befragten Mütter zu ihren Bemühungen, Spielkontakte zu anderen Kindern zu schaffen. Mütter von Kindern mit Spracherwerbsstörungen unternahmen weniger solche Versuche als Mütter von Kindern mit unbeeinträchtigter Entwicklung; Mütter von Kindern mit einer allgemeinen Entwicklungsstörung unterschieden sich signifikant von beiden Gruppen.
Außerdem scheinen sie sich in ihrer grundsätzlichen Einschätzung von anderen Eltern zu unterscheiden, welchen Einfluss sie auf die soziale Entwicklung ihrer Kinder haben. So fand Booth (1999), dass Mütter behinderter Kinder dem Erwerb sozialer Kompetenzen zwar eine hohe Bedeutung zumaßen, aber eher dazu neigten, Defizite ihrer Kinder in sozialen Kompetenzen als Ausdruck der Behinderung anzusehen und somit als wenig beeinflussbar zu betrachten.