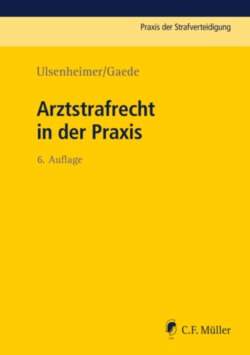Читать книгу Arztstrafrecht in der Praxis - Klaus Ulsenheimer - Страница 102
На сайте Литреса книга снята с продажи.
aa) Arbeitsteilung und Vertrauensgrundsatz im Bereich horizontaler Arbeitsteilung (1) Fallgruppe 1a: Interdisziplinäre ärztliche Zusammenarbeit im stationären Bereich
Оглавление225
Der BGH hat in zwei grundlegenden Entscheidungen[81] die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten bei der Kooperation von Fachärzten verschiedener Fachgebiete am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen Chirurgen und Anästhesisten behandelt. Die von der Rechtsprechung zu diesem Problemkreis aufgestellten Prinzipien sind jedoch grundsätzlicher Natur, so dass die maßgeblichen Entscheidungssätze vice versa auch im Verhältnis anderer Fachärzte zueinander Gültigkeit haben.
226
(a) Das erste Grundsatzurteil betraf eine Anästhesistin, die zu einer 18-jährigen Patientin gerufen wurde, als diese bereits auf dem Operationstisch lag. Da der Operateur aufgrund seiner Voruntersuchung eine „normale, akute Blinddarmentzündung“ diagnostiziert hatte, fragte die Anästhesistin die Patientin lediglich, ob sie nüchtern sei, was diese bejahte, unterließ es aber, ihren Bauch abzutasten oder nach Darmgeräuschen abzuhören. Da die Patientin jedoch zusätzlich an einer Darmlähmung erkrankt war, befanden sich im Magen und Darm mehrere Liter unverdauter Speisereste, die sie bei Einleitung der Narkose vor Einführung des Tubus erbrach. Dadurch kam es zu einer Aspirationspneumonie, an deren Folgen die Patientin zwei Tage später starb.
Der BGH bestätigte in dieser Entscheidung, dass zur Verantwortungsabgrenzung „bei der ärztlichen Zusammenarbeit im Operationssaal der Vertrauensgrundsatz zur Anwendung“ kommen müsse. Dieser besagt, „dass im Interesse eines geordneten Ablaufs der Operation sich die dabei beteiligten Fachärzte grundsätzlich auf die fehlerfreie Mitwirkung des Kollegen aus der anderen Fachrichtung verlassen können“. Denn die zunehmende Spezialisierung in der Medizin habe zu einer Vielzahl eigenständiger Fachgebiete geführt und mit dem Übergang fachlicher Zuständigkeit auch die rechtliche Eigenverantwortlichkeit des jeweiligen Spezialisten begründet. „Wenn Operateur und Anästhesist ihre Kräfte zu Gunsten einer wechselseitigen Überwachung zersplitterten, würde jede Form der Zusammenarbeit im Operationssaal fragwürdig und mit zusätzlichen Risiken für den Patienten verbunden.“[82]
227
Im Verhältnis zwischen Chirurg und Anästhesist bedeutet dies konkret: Die präoperative Versorgung des Patienten obliegt dem Anästhesisten. Er hat die „Narkosefähigkeit“, d.h. die operative Belastbarkeit des Patienten durch den beabsichtigten Eingriff und die Narkose zu prüfen. Er bestimmt das Narkoseverfahren und trifft danach seine Vorbereitungen, „zu denen es auch gehört, sich von der Nüchternheit des Patienten zu überzeugen“, um die „nahe liegende Gefahr einer Aspiration zu vermeiden“. Der Chirurg dagegen entscheidet darüber, „ob, wo und wann der Eingriff durchgeführt werden soll“. Dabei wägt er nicht nur das Operationsrisiko ab, sondern kalkuliert zumindest auch das allgemeine Narkoserisiko mit ein.
Daraus folgt: Die Anästhesistin war im vorliegenden Falle weder berechtigt noch verpflichtet, das Untersuchungsergebnis des Chirurgen zu überprüfen, sondern durfte sich auf dessen Anamnese und Diagnose („akuter Blinddarm“) verlassen. Denn jeder der beiden Ärzte darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass der andere seine Tätigkeit sachgemäß ausübt und mit der jeweils anderen richtig koordiniert. „Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn besondere Umstände den Schluss hätten nahe legen müssen, dass die chirurgische Diagnose nicht richtig“[83] oder die beabsichtigte Narkose offensichtlich unzulänglich war. Mangels solcher Anhaltspunkte hatte das Landgericht die angeklagte Narkoseärztin mit Recht freigesprochen.
228
Ein anderes Beispiel für die unterschiedliche Aufgabenstellung von Anästhesist und Operateur und die daraus sich ergebende Folgerung, dass keine gegenseitigen Kontrollpflichten bestehen, bietet der vom LG Kassel entschiedene Fall einer Lungenoperation, bei der infolge der im Operationsplan falsch ausgewiesenen Seitenlokalisation statt des rechten, an einem Bronchialkarzinom erkrankten Ober- und Mittellappens der Lunge, die linke, nicht vom Tumorleiden betroffene Lungenseite, operiert worden war. Die Frage, ob die Anästhesisten die falsche Seitenangabe bei Wahrung der zu fordernden fachlichen Sorgfalt hätten erkennen müssen, wurde vom fachanästhesiologischen Gutachter eindeutig – und mit Recht – verneint. Denn die Aufgabe des Anästhesisten besteht zum einen darin, den Patienten in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des geplanten operativen Eingriffs erlaubt, und zum anderen in der adäquaten Überwachung und gegebenenfalls Sicherung der Vitalfunktionen. Es ist aber „keinesfalls zwingende Aufgabe des Anästhesisten, die Richtigkeit der operativen Planung einschließlich der Angabe der Seitenlokalisation eines operativen Eingriffs im OP-Plan vor oder während des Eingriffs und der Anästhesie zu überprüfen“, so dass das Nichterkennen der Seitenverwechslung durch den Anästhesisten für diesen keinen Sorgfaltspflichtverstoß begründet.[84]
229
Umgekehrt folgt daraus aber zugleich, dass „die strafrechtliche Eigenverantwortung“ des Anästhesisten „für eine lege artis durchzuführende Narkose, wozu die entsprechende medizinisch mögliche Vorbereitung des Patienten gehört, durch die Verantwortung des Chirurgen für eine zutreffende Diagnose und seine Entscheidung über die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs nicht unmittelbar berührt wird. Eine Ausnahme könnte nur gelten, wenn nach dem Urteil des Chirurgen eine unverzügliche, keinerlei Aufschub mehr duldende Operation deshalb durchzuführen ist, weil anderenfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Tod des Patienten eintreten würde“[85].
230
Aus der dargelegten Aufgabenabgrenzung zwischen Chirurgie und Anästhesie folgt darüber hinaus, dass bei Meinungsverschiedenheiten der Chirurg die letztlich verantwortliche Entscheidung über die Vornahme der Operation und deren Zeitpunkt trifft[86]. Der Anästhesist darf seine Mitwirkung nur dann verweigern, wenn das Narkoserisiko offensichtlich höher als das Operationsrisiko einzuschätzen oder aber der Operateur, z.B. infolge eines epileptischen Anfalls, erkennbar seinen Aufgaben nicht gewachsen ist[87]. Der Anästhesist, der diese „Kompetenzkompetenz“ des Operateurs – von solchen Ausnahmefällen abgesehen – nicht beachtet und seine Mitwirkung bei der Operation verweigert, setzt sich nicht nur der Gefahr strafrechtlicher Konsequenzen aus, sondern auch seine berufliche Existenz aufs Spiel, da die außerordentliche Kündigung seines Arbeitsverhältnisses in einem derartigen Fall für rechtens befunden wird.[88]
231
Andererseits aber muss der Anästhesist nötigenfalls alles in seiner Macht Stehende tun, um den Operateur zum Abbruch einer keineswegs dringlichen Operation (Entfernung der Polypen bei einem 11-jährigen Kind) zu bewegen und seinen Standpunkt auch durchzusetzen, wenn sich z.B. in der ersten Phase des Eingriffs zweimal eine äußerst bedrohliche Verlegung des Tubus ereignet, die beide Male nur durch sofortige Extubation beseitigt werden konnte. Hier darf die Operation nicht fortgesetzt, vielmehr muss nach der Ursache der Beatmungschwierigkeiten gesucht werden, da dann der Narkosezwischenfall bei der dritten (!) Intubation mit bleibenden schweren cerebralen Funktionsstörungen vermieden worden wäre.
232
(b) Das zweite Grundsatzurteil des BGH[89] betraf die Kompetenzabgrenzung zwischen Chirurg und Anästhesist bei der postoperativen Überwachung:
Eine 38-jährige Patientin wurde nach einer fast 7 Stunden dauernden Operation (Reithosenplastik) in ansprechbarem Zustand auf die dem Chirurgen unterstehende Intensivstation gebracht, auf der ein Assistenzarzt und eine Krankenschwester den Nachtdienst versahen. In der Nacht erlitt die Patientin durch starke Nachblutungen einen erheblichen Blutverlust, der vom Nachtdienstpersonal nicht bemerkt und ausgeglichen wurde, so dass sie am folgenden Tag morgens nach einem erfolglosen Rettungsversuch infolge Herz-Kreislaufversagens starb.
Zutreffend wies der BGH darauf hin, dass es für den Grenzbereich bis zum Erwachen aus der Narkose oder darüber hinaus bis zur vollen Aufhebung der Betäubungswirkungen „einer konkreten Verteilung der Zuständigkeiten“ bedarf, „um Überschneidungen und Lücken in der ärztlichen Betreuung zu vermeiden“[90]. Maßgebend ist dabei regelmäßig die jeweilige, in dem betreffenden Krankenhaus geltende Aufgabenverteilung bzw. ausnahmsweise die davon wegen der Besonderheiten des Einzelfalles abweichende individuelle Absprache zwischen den beteiligten Ärzten. Fehlt es an speziellen Abmachungen, gelten subsidiär die von den beteiligten Berufsverbänden getroffenen Vereinbarungen[91]. Danach ist der Verantwortungsbereich des Anästhesisten auf die postnarkotische Phase bis zur Wiederherstellung der Vitalfunktionen beschränkt, „sofern ihm nicht vom Krankenhausträger weitergehende Aufgaben, z.B. die organisatorische Leitung der Wachstation übertragen“ sind. Nachuntersuchung und Nachbehandlung fallen dagegen nur dann in die Kompetenz des Anästhesisten, „sofern sie unmittelbar mit dem Betäubungsverfahren in Zusammenhang stehen“. Dagegen ist für Komplikationen, die sich aus der Operation selbst ergeben, wie z.B. Nachblutungen, der Chirurg verantwortlich, der auch bei Überschneidung der fachlichen Zuständigkeit die „Primärkompetenz“ hat[92].
Die Anästhesistin war daher im vorliegenden Fall freizusprechen, was das Landgericht in I. Instanz leider verkannt hatte, nach Aufhebung und Zurückverweisung des Urteils durch den BGH dann jedoch rechtskräftig aussprach.
233
Unrichtig ist dagegen das Urteil des LG Augsburg vom 1.3.2005,[93] in dem es heißt, „die Verantwortung für die postoperative Überwachung der Patientin“ sei „eindeutig in den Bereich des Anästhesisten gefallen“. Zwar habe es „eine abweichende hausinterne Regelung gegeben, wonach die postoperative Überwachung von Kaiserschnitt-Patientinnen der Hebamme oblag“, doch hätten die Sachverständigen überzeugend ausgeführt, dass „derartige Hausregeln nicht die Berufsregel aufheben und außer Kraft setzen können“, so dass es „bei der Verantwortlichkeit des Anästhesisten“ verbleibe. Diese Ausführungen stehen in krassem Widerspruch zu der – zutreffenden – Rechtsansicht des BGH, wonach die Vereinbarungen, Empfehlungen und Entschließungen der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und/oder der Berufsverbände nur subsidiär[94] gelten, die individuelle Regelung des betreffenden Krankenhauses dagegen Vorrang hat.
Für den angeklagten Gynäkologen kam es auf diese Frage nicht an: „Weder nach der Berufsregel noch nach der hausinternen Regelung war er für die Überwachung der Patientin nach Beendigung der Operation verantwortlich, so dass er mit Recht freigesprochen wurde.
234
(c) Die vorstehenden Grundsätze hat der BGH vielfach, zusammenfassend in einer – zivilrechtlichen – Entscheidung betreffend eine HNO-Operation bestätigt, der folgender Sachverhalt zugrunde lag:[95]
Der Patient litt an einer Insuffizienz der Nebennierenrinde (sog. Morbus Addison). Er nahm auf ärztliche Verordnung seit 1982 zur Substituierung der fehlenden Hormone u.a. morgens und abends ein Cortisol-Präparat ein. Wegen wiederholten Nasenblutens wurde er als Kassenpatient in der HNO-Klinik stationär aufgenommen. Er legte dort seinen Notfallausweis vor, in dem sein Leiden bezeichnet und vermerkt war, dass im Falle einer Erkrankung oder bei einem Unfall der Corticoidmangel auszugleichen sei.
Als nach vorübergehender Besserung erneut stärkeres Nasenbluten auftrat, legten zwei HNO-Ärzte am Abend eine sog. Bellocq-Tamponade, bei der unter Vollnarkose der Durchgang zwischen Nasen- und Rachenraum verschlossen wurde. Die Narkose, die eine Anästhesistin vornahm, dauerte 75 Minuten, der Eingriff selbst war nach ca. 35 Minuten beendet. Nach der Operation kam der Patient wieder auf die Station, wo er einige Stunden später von einem Pfleger ohne Atmung und Puls aufgefunden wurde. Die Reanimationsbemühungen der Ärzte blieben erfolglos.
Weder während noch nach der Operation erhielt der Patient Cortisol-Präparate, so dass sich die Frage stellte, welchem der Ärzte, den Operateuren (HNO-Ärzten) oder der Anästhesistin, dieser Behandlungsfehler zuzurechnen war.
Das OLG hatte alle drei Ärzte sowie den Krankenhausträger zu Schadensersatz verurteilt. Der BGH hingegen hob das Urteil gegen die HNO-Ärzte auf und verwies die Sache an das OLG zur weiteren Sachaufklärung und Entscheidung zurück. Im Übrigen beließ er es bei der Verurteilung der Anästhesistin und des Krankenhausträgers.
In den Urteilsgründen heißt es zur Abgrenzung der Verantwortung von Operateur und Anästhesist in der prä-, intra- und postoperativen Phase:
| • | „Wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt, ist in der präoperativen Phase der Anästhesist für die Vorbereitung der Narkose zuständig. Seine Sache ist es, das geeignete Betäubungsmittel auszuwählen und den Patienten durch sorgfältige Prämedikation hierauf einzustellen. Dazu gehört auch, dem Patienten diejenigen Medikamente zu verabreichen, die ihm aufgrund seines Gesundheitszustands schon zu diesem Zeitpunkt zur Aufrechterhaltung seiner vitalen Funktionen in der Narkose gegeben werden müssen. Präoperativ waren deshalb […] allein die Anästhesistin und nicht die (HNO-Ärzte) für die Substituierung der fehlenden NNB-Hormone bei dem Patienten verantwortlich“. |
| • | „In der intraoperativen Phase, also während der Dauer des chirurgischen Eingriffs selbst, waren sowohl die Operateure als auch die […] Anästhesistin mit der Behandlung […] befasst. Auch für diesen Zeitraum gilt der […] Grundsatz der horizontalen Arbeitsteilung, und zwar dahin, dass der Chirurg für den operativen Eingriff mit den sich daraus ergebenden Risiken, der Anästhesist für die Narkose einschließlich der Überwachung und Aufrechterhaltung der vitalen Funktionen des Patienten zuständig ist“ […] Die HNO-Ärzte durften „mangels gegenteiliger Umstände vor Beginn des operativen Eingriffs von einer sorgfältigen Prämedikation“ des Patienten „einschließlich der erforderlichen Substituierung der fehlenden NNR-Hormone durch ausreichend dosierte Cortisolgaben seitens der Anästhesistin ausgehen. Das entspricht dem dargelegten Grundsatz der Arbeitsteilung […] Auch die längere Dauer des Eingriffs und der relativ hohe Blutverlust des Patienten führen hier zu keiner anderen Betrachtung […]“ |
| • | Ob bei der postoperativen Behandlung des Patienten den HNO-Ärzten ein Fehlverhalten zur Last gelegt werden kann, entschied der BGH nicht. Zwar ist die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Narkoseärzten und Operateuren regelmäßig so gestaltet, „dass der Patient dann, wenn er nach der Operation auf die normale Krankenstation zurückgelangt, von dem Anästhesisten wieder in die Obhut der jeweiligen Operationsärzte entlassen wird“. Die Rücknahme des Patienten auf die Krankenstation bedeutet jedoch „nicht ohne weiteres, dass nunmehr stets der dortige Stationsarzt sofort wieder für die Medikation zuständig wird. Vielmehr wird in der Regel vom Anästhesisten angeordnet, welche Medikamente der Patient im Anschluss an die Operation erhalten soll“. |
Der Verantwortungsbereich der Anästhesistin in der postoperativen Phase scheint uns hier nicht richtig bestimmt. Denn ob der Anästhesist auf der HNO-Station „Anordnungen“ treffen darf, ist fraglich, und außerdem lag der Notfallausweis des Patienten auf der Station vor, so dass dessen Krankheit den dort tätigen Ärzten und dem Pflegepersonal bekannt war.[96]
235
(d) Die vorstehenden Beispiele zeigen, dass gerade die unmittelbare postoperative und speziell postanästhesiologische Phase besonders haftungsträchtig sind. Auch alle bislang durchgeführten Untersuchungen haben übereinstimmend ergeben, dass in diesem kritischen Zeitraum ein erhöhtes Zwischenfallrisiko mit schwerwiegenden gesundheitlichen, oftmals auch tödlichen Folgen besteht, wenn es nicht rasch entdeckt und sachgemäß bekämpft wird. „Für den chirurgischen Patienten ist zu keiner Zeit seines Klinikaufenthalts die Gefahr einer Hypoxie so groß“ wie in dem unmittelbar postoperativen Stadium, betont auch die Rechtsprechung seit langem.[97] Deshalb muss gegen Überwachungsmängel, unzureichende Betreuung und Kontrolle des Patienten, Nachlässigkeiten des eingesetzten ärztlichen und nichtärztlichen Pflegepersonals, die zu frühe Verlegung vom Aufwachraum oder von der Intensiveinheit auf die Normalstation und gegen Zuständigkeitslücken Vorsorge getroffen werden.[98] Da der Patient in den ersten Stunden nach der Narkose einer kontinuierlichen Überwachung bedarf, muss nicht nur eine speziell unterwiesene Pflegekraft, sondern auch der für die Anästhesie verantwortliche Arzt jederzeit sofort einsatzbereit zur Verfügung stehen.[99] Konkret: Der Anästhesist bleibt auch nach der Extubation des Patienten verantwortlich, wenn er die Weiterbehandlung (infolge einer Atemdepression) übernommen hat oder „solange noch weiter die Gefahr unerwünschter Nachwirkungen der Narkose besteht“.[100] Er muss deshalb „etwa erforderliche ärztliche Kontrollen und die Beobachtung des Patienten vornehmen oder sicherstellen“ und „den in der chirurgischen Abteilung tätigen Arzt informieren“.[101] Keinesfalls darf der Anästhesist im Interesse des regulären Ablaufs des Operationsprogramms den von einer Atemstörung betroffenen Patienten verlassen, vielmehr ist dessen ständige Überwachung durch den erfahrenen und zuständigen Narkosearzt persönlich ein unabdingbares Gebot.[102]
Dies bedeutet, dass sich der Anästhesist u.U. ständig im Aufwachraum aufhalten muss, um notfalls sofort eingreifen zu können.[103] Die Verlegung eines Patienten auf die Krankenstation setzt eine „ausdrückliche ärztliche Anordnung“ voraus und darf nur geschehen, wenn sich der für den Aufwachraum zuständige Anästhesist „durch persönlichen Augenschein vom unbedenklichen Zustand des Patienten überzeugt hat“.[104] Hat ein Krankenhaus keinen Aufwachraum, muss der Patient für zumindest eine Stunde auf der Station eine Sitzwache erhalten, wodurch das Auftreten eines Zwischenfalls zwar nicht oder nicht immer verhindert, aber doch sofort bemerkt und dadurch sofort behandelt werden kann.[105] Ist ein Patient aufgrund seiner Krankengeschichte akut gefährdet und kommt es auf das rechtzeitige Erkennen von Symptomen an, müssen die Personen, die ihn überwachen, die dazu erforderliche fachliche Qualifikation haben. „Es darf jedenfalls nicht geschehen, dass – noch dazu in einer Universitätsklinik – ein Patient, bei dem mit einem lebensbedrohenden Zustand gerechnet werden muss, in eine Situation gelangt, in der ein solcher Zustand nach der Ausstattung dieser Station nicht (rechtzeitig) erkannt werden kann“.[106]
236
(e) Für die ärztliche Praxis bedeuten diese Grundsätze, dass die Aufgaben- bzw. Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche zwischen den leitenden Ärzten im Krankenhaus im Allgemeinen und, soweit erforderlich, im konkreten Fall durch klare Absprachen, und zwar aus Beweisgründen schriftlich, festgelegt werden sollten, damit die jeweiligen Sorgfaltspflichten bestimmbar und für den Einzelnen voraussehbar sind. Das gilt z.B. auch für die Periduralanästhesie unter der Geburt. In der Frage, wer hier wann aufklären sollte, bedarf es einer klaren Regelung.[107] Dies gilt auch für die Aufklärung vor Bluttransfusionen[108]. Dadurch können zum einen unnötige Kompetenzkonflikte, zum anderen aber auch Lücken in der Patientenbetreuung und damit erhebliche Strafbarkeitsrisiken unter dem Gesichtspunkt der fahrlässigen Körperverletzung oder fahrlässigen Tötung vermieden werden.
237
Wie wichtig insoweit exakte, allgemeine oder individuelle Abmachungen zwischen den beteiligten Ärzten oder Anordnungen des Krankenhausträgers sind, zeigt eine Entscheidung des LG Gießen[109]. Hier ging es um die Frage, ob der Anästhesist für den Tod eines 5-jährigen Kindes verantwortlich war, das nach einer Mandeloperation auf der Station in erheblichem Umfang nachgeblutet und dabei nach Ansicht des Sachverständigen bereits so viel Blut verloren hatte, dass auch eine Bluttransfusion etwa 2 Stunden später, als das Kind wieder in den Operationssaal kam, dessen Tod nicht mehr hätte verhindern können.
Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Schöffengericht hatten fälschlicherweise keinerlei Abgrenzung zwischen den Zuständigkeitsbereichen des HNO-Arztes und des Anästhesisten vorgenommen, sondern gingen ohne nähere Auseinandersetzung mit dieser Frage einfach davon aus, dass der Anästhesist – trotz Fehlens einer konkreten Absprache oder Anordnung – für die Überwachung des Kindes auf der HNO-Station verantwortlich sei. Das Landgericht Gießen hat erfreulicherweise in der Berufungsinstanz die Unhaltbarkeit dieser Auffassung erkannt und den Anästhesisten freigesprochen, da das Kind sich nach dem Eingriff auf der Station im Aufgaben- und Verantwortungsbereich des – nicht einmal angeklagten(!) – HNO-Arztes befand und dieser daher für die postoperative Überwachung des Kindes Sorge zu tragen hatte.
Derartige Fälle mit zu Unrecht beschuldigten Anästhesisten sind keine Seltenheit. Wenn jedoch der Zustand des Patienten eine lückenlose Überwachung erforderlich macht, wegen des fehlenden Aufwachraums der Patient aber sofort auf die (z.B. chirurgische) Station kommt, gelangt er in die Obhut und damit Verantwortung der zuständigen Ärzte und Pflegekräfte der bettenführenden Abteilung. Insoweit fehlt dem Anästhesisten die Anordnungskompetenz auf der Station, es sei denn, dass entsprechende Absprachen zwischen den Abteilungen getroffen worden sind.[110]
In diesen Zusammenhang gehört auch eine Entscheidung des LG Aurich[111]. Nach einer Ohrmuschel-Korrekturoperation kam es bei einem 3 Jahre alten Kind postoperativ in einem Krankenhaus ohne Aufwachraum zu einem tödlichen Zwischenfall, bei dem sich eine schleichende Ateminsuffizienz entwickelte, die von dem mit der Überwachung beauftragten Pflegepersonal nicht erkannt wurde. Das LG verneinte im Gegensatz zum Amtsgericht ein Überwachungs- und Organisationsverschulden des Anästhesisten.
„Dies folgt nicht etwa daraus, dass Komplikationen, die sich aus der Operation selbst ergeben, in die Verantwortung des HNO-Arztes fallen, denn die Störung bei dem Patienten war narkosebedingt. Die Zuständigkeitsverteilung in der postoperativen Phase ergibt sich im […] Hospital aus den räumlichen Umständen und den Absprachen zwischen Anästhesisten und Operateuren. Da kein Aufwachraum vorhanden war, dessen organisatorische Leitung in die Hände des Anästhesisten fiel, wurden die Patienten auf die jeweiligen Stationen verbracht. Der Leiter der Anästhesieabteilung hat bekundet, dass die Abgrenzung der Zuständigkeiten so geregelt gewesen sei, dass mit Übernahme der Patienten auf die Station die postoperative Überwachung von dort aus durchgeführt werde. Damit habe die Verantwortlichkeit des Anästhesisten geendet, schon deshalb, weil der Anästhesist auf der Station keinerlei Kompetenzen und Weisungsbefugnisse gehabt habe“.
238
(f) Nach denselben Grundsätzen bejahte der BGH[112] die Verantwortung des Operateurs, der einen vom Anästhesisten zur Narkose gelegten zentralvenösen Zugang in Gestalt einer Verweilkanüle nach der Operation zur Infundierung von Medikamenten weiterverwandte, dabei aber nicht genügend fixierte bzw. überwachte, so dass die Patientin – ein 4 Monate altes Mädchen – an einem Entblutungsschock starb. Wörtlich heißt es:
„Zwar ist die Kanüle in der Operation von dem Anästhesisten gelegt worden, um die Narkose der Patientin zu ermöglichen; die Entscheidung zu dieser Maßnahme, ihre Durchführung und eine gefahrenvorbeugende Kontrolle in der operativen und in der postnarkotischen Phase bis zur Wiedererlangung der Schutzreflexe der Patientin und bis zu ihrer Verlegung in die Krankenstation waren dessen Sache, nicht die Aufgabe des Urologen. Hier hat sich der Zwischenfall aber zu einem Zeitpunkt ereignet, zu dem die Patientin schon 2 Tage auf der Kinderchirurgischen Station lag, die Narkose und ihre Nachwirkungen längst nicht mehr in Frage standen und es nunmehr nur noch um die therapeutische Nachbehandlung des operativen Eingriffs ging […] Dieser Behandlungsabschnitt gehört grundsätzlich nicht mehr zum Verantwortungsbereich der Anästhesie, sondern zur fachlichen Zuständigkeit des hier die Nachbehandlung weiterführenden Operateurs. Die Entscheidung über das Belassen der Kanüle zur Applikation von Medikamenten ebenso wie die Anwendung von Maßnahmen zur Sicherung vor Komplikationen, die mit der Weiterverwendung der Kanüle verbunden sein könnten, waren – soweit diese Entscheidungen von einem Arzt zu treffen waren – in dieser Phase“ dem Urologen zugewachsen. [113]
Ein weiteres instruktives Beispiel für die postoperative Kompetenzverteilung bietet eine Entscheidung des LG Karlsruhe[114]:
Nach Entfernung eines gutartigen Tumors an der Bauchspeicheldrüse in Allgemeinnarkose, kombiniert mit einer Katheterperiduralanästhesie (sog. Epiduralanästhesie), wurde der Patient auf die Chirurgische Station (zurück-)verlegt. Dort entwickelte sich im Bereich der Kathetereinstichstelle über Tage ein Abszess und eine Querschnittslähmung, die trotz der Klagen des Patienten über anhaltende Rückenschmerzen nicht rechtzeitig erkannt wurden. Erst am 10. postoperativen Tag stellte man die Diagnose „Querschnittslähmung“, die jedoch auch durch eine neurochirurgische Operation nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, so dass der Patient heute an den Rollstuhl gefesselt ist.
Auch in diesem Falle ist nicht der Anästhesist, der durch die Periduralanästhesie den Abszess verursacht hatte, für die eingetretene Körperverletzung verantwortlich, vielmehr war der Patient bereits auf die Chirurgische Station zurückverlegt, für die die dort tätigen Chirurgen die Verantwortung tragen. Das Landgericht Karlsruhe wertete die unterbliebene Hinzuziehung der Anästhesisten durch die Chirurgen deshalb als (groben) Behandlungsfehler. Eine Haftung des zuständigen Anästhesisten käme jedoch dann in Betracht, wenn er am 2. postoperativen Tag über die Rückenschmerzen des Patienten informiert wurde, den Periduralkatheter entfernte und dabei einen auffälligen Befund (Rötung an der Einstichstelle) bemerkte, darüber aber seine chirurgischen Kollegen nicht informiert hätte.
239
(g) Um die Abgrenzung der Verantwortlichkeit zwischen Gynäkologen und Anästhesisten für den Tod einer Patientin nach einer Kaiserschnittoperation ging es in der (zivilrechtlichen) Entscheidung BGH NJW 1987, 2293[115]. Dort heißt es unter Bestätigung der oben dargelegten Grundsätze:
„Für die unterlassenen diagnostischen Maßnahmen während der postoperativen Phase der Behandlung der Patientin nach der Kaiserschnittoperation ist der Zweitbeklagte nicht verantwortlich. Er ist nur als Anästhesist tätig geworden, und nur insoweit ist er an der Behandlung der Patientin beteiligt gewesen. Die Anästhesie bei der Kaiserschnittentbindung hatte nicht er geführt, so dass ihn auch deswegen keine nachwirkenden Pflichten bei der postoperativen Beobachtung und Weiterbehandlung der Patientin trafen. Es war nach allem nicht seine Aufgabe, sich an diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu beteiligen, die nicht mit der Vorbereitung und Durchführung der Anästhesie bei der Wundrevision zusammenhingen. Vielmehr war die Behandlung der Patientin im Übrigen nach der Arbeitsteilung zwischen dem Gynäkologen und ihm als Anästhesisten allein die Aufgabe des Gynäkologen.
Es begründet aber keine Haftung für Unterlassungen bei der Behandlung der Patientin, dass er in seinem anästhesiologischen Aufgabenbereich die Befunde nicht erhoben hat. Er war für die Therapie im Übrigen nicht zuständig und hatte in sie allenfalls einzugreifen, wenn er über zusätzliches und besseres Wissen verfügte oder wenn er offensichtliche ärztliche Versäumnisse erkannte, auf die er dann seine Kollegen hinzuweisen hatte.“
240
(h) Von besonderer Haftungsrelevanz sind alle „Schnittstellen“ im Krankenhaus und deshalb unbedingt regelungsbedürftig. Subsidiär wird in der Judikatur auf die interdisziplinären Absprachen zwischen den beteiligten Fachverbänden bzw. Fachgesellschaften, z.B. über die Lagerung des Patienten auf dem OP-Tisch, die Vornahme von Bluttransfusionen oder die postoperative Schmerztherapie zurückgegriffen[116]. Wurde der Patient entsprechend den Vorgaben des Operateurs vom Operationspfleger gelagert, haben Operateur und Anästhesist eine Kontrollpflicht[117]. Während die Durchführung der Lagerung zum Verantwortungsbereich des Operateurs gehört, ist der Anästhesist für die Lagerung der Extremitäten verantwortlich, die er für die Narkoseüberwachung sowie für die Applikation von Anästhetika und Infusionen benötigt.[118] Für die postoperative Lagerung und Umlagerung bis zur Beendigung der postanästhesiologischen Überwachung liegt die Verantwortung beim Anästhesisten, soweit nicht besondere Umstände die Mitwirkung des Operateurs erfordern. Hinsichtlich der postoperativen Schmerztherapie gilt: „Zuständig ist im Aufwachraum und auf interdisziplinären Intensiveinheiten unter seiner Leitung der Anästhesist, auf Bettenstationen und fachgebundenen Intensivstationen dagegen der Operateur.[119]
241
(i) Weitere Beispiele zur horizontalen Arbeitsteilung:
| • | zwischen Chirurg und Radiologen: Beruht die fehlerhafte Indikationsstellung für eine Operation auf einer unzutreffenden Befundung des Röntgenbildes durch den Radiologen, so haftet der Chirurg nicht.[120] Der Orthopäde muss die MRT-Auswertung des Radiologen nicht überprüfen.[121] Handelt es sich jedoch um einen schwerwiegenden, gefährlichen Eingriff und ist die zusätzliche Überprüfung „von Zeit und Schwierigkeitsgrad her dem Operateur zumutbar“, muss der Chirurg die Gegenkontrolle von Röntgenaufnahme, Computer- oder Kernspintomogrammen und anderen technischen Aufzeichnungen vornehmen[122]. Den Radiologen trifft hingegen keine Pflicht zur Überprüfung der Indikation, wenn ihm ein Patient zur Hirnangiographie[123] oder zum Darmröntgen[124] überwiesen wird; |
| • | zwischen Neurologie und Neurochirurgie;[125] |
| • | zwischen Gynäkologen und Pathologen;[126] |
| • | zwischen Neurologie und Orthopädie;[127] |
| • | zwischen Augenarzt und Kinderarzt[128]. |
242
(j) Ebenfalls zum Problemkreis „horizontale Arbeitsteilung“ zwischen Ärzten verschiedener Fachrichtungen gehört die Frage, inwieweit eine Beiziehung von Unterlagen zur Vorbehandlung in einer anderen Klinik oder in einer anderen Abteilung desselben Krankenhauses erfolgen muss. Dazu heißt es in der Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 30.4.1987[129]:
„Eine generelle Verpflichtung zur Beiziehung von Vorbehandlungsunterlagen besteht nicht. Dies würde in der Praxis auf eine Behinderung der laufenden Therapie hinauslaufen, vornehmlich dann, wenn Behandlungsunterlagen nicht oder nicht in kurzer Frist herbeigeschafft werden können. Ärztliche Aufzeichnungen über Erkrankungen und Maßnahmen der Therapie sind deshalb nur beizuziehen, wenn die Kenntnis der dort vermerkten Einzelheiten im Rahmen der Behandlung einer neuerlichen Erkrankung oder Gesundheitsschädigung medizinisch notwendig ist. Die Gründe für eine medizinisch unumgängliche Kenntnis und Auswertung der Behandlungsunterlagen können sicherlich vielfältig sein. Pflichtwidrig ist die Nichtbeiziehung indes nur dann, wenn der Arzt nach den ihm mitgeteilten oder erkennbaren Umständen davon ausgehen muss, eine einwandfreie Behandlung sei allenfalls bei Kenntnis und Auswertung der alten Befunde und Unterlagen gewährleistet.“