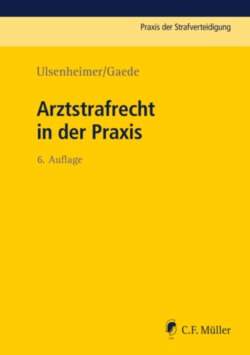Читать книгу Arztstrafrecht in der Praxis - Klaus Ulsenheimer - Страница 91
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Praktische Systematisierung von Organisationsfehlern
Оглавление194
Es resultiert aus der Natur der Sache, dass staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) oder der fahrlässigen Tötung (§ 222 StGB) regelmäßig auf die Frage fokussiert sind, konkret wessen medizinisches Agieren – im Sinne einer etwa unrichtigen Behandlungsentscheidung oder eines etwa fehlerhaften methodischen Vorgehens – zum tatbestandlichen Erfolg geführt hat. So unterliegt dann z.B. der Ermittlung,
| • | wer auf der Intensivstation keine Bluttransfusion oder Revisionsoperation indiziert hat, weil laut Obduktionsprotokoll ein für den Tod des Patienten ursächliches Verblutungsgeschehen zu konstatieren ist, |
| • | wem im Kreißsaal relevante CTG-Auffälligkeiten früher hätten auffallen müssen, damit laut geburtsmedizinischem Fachgutachten bei zeitgerechter Durchführung einer Notsectio die schwerste Hirnschädigung des Neugeborenen vermieden worden wäre, oder |
| • | wer die Bluttransfusion mit für den Patienten inkompatibler Blutgruppe, die zu dessen Tode führte, ausgeführt hat. |
Dergestalt lassen sich individuelle Behandlungsfehler[1] bestimmbarer Behandlungsakteure identifizieren, wenn diese in konkreten Behandlungssituationen nicht die geforderte Sorgfalt walten ließen[2] (z.B. keine Hinzuziehung des chirurgischen Bereitschaftsdienstes durch den diensthabenden Anästhesisten der Intensivstation zur interdisziplinären Erörterung des aktuellen Befundbildes; Übersehen von CTG-Auffälligkeiten; Absehen vom Bed-side-Test wegen besonderer Eilbedürftigkeit der Bluttransfusion).
Dabei wird oft verkannt, dass individuelle Fehlentscheidungen bei der Patientenbehandlung – gleiches gilt im Übrigen für Aufklärungsmängel[3] – auch aus organisatorischen Defiziten resultieren können[4] (z.B. der auf der Intensivstation diensthabende Weiterbildungsassistent ist noch nicht hinreichend qualifiziert, um Befundauffälligkeiten bei Patienten überhaupt adäquat beurteilen zu können; die im Kreißsaal diensthabende Hebamme ist durch die erforderliche Betreuung einer Mehrzahl von Schwangeren in Anspruch genommen; der die Bluttransfusion durchführende Arzt meint, die im OP-Bereich vorgehaltenen Blutkonserven seien ihm bereits „für seinen Patienten zur Verfügung gestellt“ worden). D.h., vielfach korreliert fehlerhaftes Behandlungsverhalten mit Organisationsmängeln wegen infrastruktureller Defizite hinsichtlich der personellen, räumlichen und apparativen Ausstattung oder bei der Planung und Gestaltung von Abläufen.[5]
Allerdings betreffen infrastrukturelle Defizite nicht nur die Ärzte und Pflegekräfte, die unmittelbar „am Patienten“ tätig werden, sondern auch Funktionsbereiche, die „für den Patienten“ adäquat organisiert vorzuhalten sind, damit insgesamt eine sorgfaltspflichtgerechte Behandlung erfolgen kann. Zu denken ist etwa an die Klinikapotheke, das Hauslabor, die Blutbank bzw. das Blutdepot, das „Medizinproduktewesen“, den „Hygienekomplex“ et cetera.
195
Zudem ist unter den heutigen Bedingungen medizinischen Fortschritts und der damit verbundenen wissenschaftlichen Spezialisierung und Subspezialisierung[6] „für alle Bereiche der Medizin Arbeitsteilung das Gebot der Stunde“.[7] Schon bei einer normalen Operation wirkt eine Vielzahl von Personen mit. Gleiches gilt für die präoperative Diagnostik und Indikationsstellung sowie hinsichtlich der postoperativen Absicherung durch die Arbeit der auf den Aufwach-, Intensiv- und Normalstationen Tätigen.[8] Die neuen Strukturen und gesetzlichen Vorgaben im Gesundheitswesen haben zudem die traditionelle Trennung zwischen Praxis- und Klinikbereich aufgelöst und durch die Verzahnung ambulanter und stationärer Versorgung neue Mischformen mit differenzierter Aufgabenteilung im Rahmen der integrierten Versorgung und der medizinischen Versorgungszentren (§ 95 und § 140a SGB V), geschaffen.[9] Die ständige Erweiterung und Vertiefung des Spezialwissens und der besonderen Erfahrungen auf einem bestimmten Fachgebiet sowie die Verwendung immer komplizierterer „Spezialapparaturen“[10] implizieren allerdings nicht nur eine Eliminierung „alter Risiken“ gerade aufgrund der großartigen Erfolge der Medizin, sondern auch eine Evozierung „neuer Risiken“ in Gestalt spezifischer Gefahrenquellen. Denn „je größer die Zahl der an Diagnose und Therapie beteiligten Ärzte, Techniker und Hilfskräfte, je komplizierter und gefährlicher die apparativen und medikamentösen Mittel, je komplexer das arbeitsteilige medizinische Geschehen in einem großen Betrieb, desto mehr Umsicht und Einsicht erfordern Planung, Koordination und Kontrolle der klinischen Abläufe“.[11] Untrennbar mit jeder Teamarbeit sind als typische Kooperationsrisiken verbunden, dass
| • | einzelne Mitarbeiter nicht den notwendigen Ausbildungs- und Erfahrungsstand haben, |
| • | zu treffende Maßnahmen nicht aufeinander abgestimmt sind, |
| • | die gegenseitige Unterrichtung nicht vollständig und klar genug ist, |
| • | an „Schnittstellen“ mit erforderlicher Aufgabenabgrenzung „Leerstellen“ verbleiben, für die sich keiner zuständig fühlt. |
196
Die daraus resultierenden Organisationsfehler[12] kann man systematisch als
| 1. | Qualifikationsmängel, |
| 2. | Koordinationsmängel, |
| 3. | Kommunikationsmängel, |
| 4. | Kompetenzabgrenzungsmängel und zudem als |
| 5. | Delegationsmängel (betreffend Auswahl, Anleitung und Überwachung von Mitarbeitern) |
umschreiben.
197
Die Mannigfaltigkeit der Fehlerquellen lässt unschwer erkennen, dass die Zusammenarbeit von Ärzten gleicher oder verschiedener Fachrichtung einerseits und des nichtärztlichen Personals (Pflegekräfte, Hebammen, technische Assistenzen) andererseits für die zu behandelnden Patienten gefahrenträchtig ist und damit auch für alle Behandlungsakteure Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken impliziert.
So verwundert nicht, dass innerhalb der für die Arzthaftung maßgebenden Fehlerquellen organisatorische Versäumnisse in den letzten Jahren sowohl straf- als auch zivilrechtlich erheblich an Bedeutung gewonnen haben. An der Spitze der erhobenen Vorwürfe stehen zwar nach wie vor die Behandlungsfehler, aber vielfach sind diese mit der Rüge organisatorischer Mängel verwoben und weisen allgemein auf strukturelle Defizite und insbesondere auf ungenügende personelle oder apparative Ausstattung,[13] mangelnde Koordination im Bereich der Schnittstellen, fehlende Absprachen zwischen den Abteilungen, unzureichende Überwachung des Patienten, den zu frühen selbstständigen Einsatz junger Ärzte oder auch auf Missverständnisse bzw. Missdeutungen der Ärzte untereinander hin, um nur einige Möglichkeiten zu erwähnen. Dabei sind die „Anforderungen der Haftungsrechtsprechung an den Organisationsbereich hoch“,[14] da die richterliche Argumentation stets aus Ex-post-Sicht erfolgt, auf deren Grundlage man natürlich relativ leicht Schwachstellen erkennen und notwendige Abhilfemaßnahmen fordern kann.