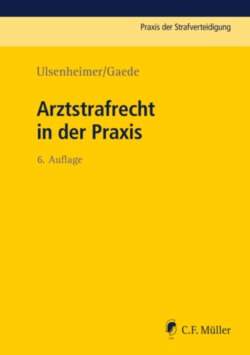Читать книгу Arztstrafrecht in der Praxis - Klaus Ulsenheimer - Страница 104
На сайте Литреса книга снята с продажи.
(3) Fallgruppen 2-4: Zusammenarbeit zwischen Facharzt für Allgemeinmedizin und anderen Fachärzten, niedergelassenem Arzt und Krankenhausarzt sowie bei Hinzuziehung eines Konsiliarius
Оглавление254
Der Vertrauensgrundsatz als tragendes haftungseinschränkendes Kriterium gilt auch in den übrigen Fällen horizontaler Arbeitsteilung:
255-
266
| 1. | Der Allgemeinmediziner/Hausarzt, der „seinen“ Patienten z.B. zum Internisten oder Röntgenologen schickt, damit dieser das unklare Krankheitsbild abklärt, darf auf die von diesen Fachärzten erhobenen Befunde bei der Weiterbehandlung des Kranken grundsätzlich – nach Maßgabe des Überweisungsauftrags[150] – ebenso vertrauen[151] wie die Krankenhausärzte etwa auf die Befunde des niedergelassenen Arztes, allerdings nur, wenn sie relativ kurz vor der Operation oder sonstigen ärztlichen Maßnahmen erhoben wurden. Denn die Befunde können sich „mit dem Gesundheits- oder Krankheitszustand ändern“.[152] Dabei gilt der Grundsatz, „dass der jeweils behandelnde Arzt die Verantwortung trägt“, sie also „auf ihn übergeht, wenn er einen Patienten übernimmt“.[153] Der hinzugezogene Arzt „haftet für Fehlleistungen in seinem Fachgebiet eigenständig“.[154] So träfe z.B. den Facharzt für Laboratoriumsmedizin, der bei der Untersuchung einer ihm vom Gynäkologen zugeleiteten Blutprobe einer schwangeren Frau zu falschen Werten gelangt (hier: Rhesus-Faktor „positiv“), die alleinige strafrechtliche Verantwortung, wenn der Fehler ihm in seiner Praxis unterlaufen ist.[155] Deshalb ist er nicht verpflichtet, „sich an diagnostische Ansichten und therapeutische Anweisungen des vorbehandelnden Arztes zu halten“, umgekehrt aber „berechtigt“, ihnen zu folgen, solange nicht „Bedenken gegen die Untersuchungsmethode oder die Qualität der Untersuchungsinstitution bestehen“ bzw. eine offenkundige Fehldiagnose oder ein offensichtlich fehlerhafter Therapievorschlag vorliegen. Lassen sich „die übernommenen Befunde mit dem bestehenden Krankheitsbild nicht in Übereinstimmung bringen oder weichen sie von anderen Befunden auffallend ab, so sind sie nicht verlässlich“[156], das heißt, sie können keine Vertrauensgrundlage sein und müssen deshalb im Interesse des Patienten wiederholt bzw. überprüft werden. Im Falle der Überweisung des Patienten zur weitergehenden Befunderhebung bestimmen sich die Behandlungspflichten – und umgekehrt der Umfang des Vertrauensgrundsatzes im Wechselspiel von Überweisendem und Überweisungsempfänger – nach Maßgabe des „in der Überweisung genannten Auftrag(s). Der Überweisungsempfänger ist an den Inhalt der Überweisung gebunden. Er darf ohne Einwilligung des überweisenden Arztes eigenmächtig gar keine weitergehenden Untersuchungen durchführen, weil er damit in die Behandlung des vom Patienten gewählten Arztes eingreifen würde (… mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen …). Deshalb ist zu unterscheiden: Erfolgt eine Überweisung zur eigenverantwortlichen Abklärung einer Verdachtsdiagnose, so entsteht mit der Übernahme dieses Auftrags eine Verpflichtung zur Erhebung aller notwendigen Befunde, um den Verdacht entweder zu bestätigen oder auszuschließen. Der Überweisungsauftrag umfasst dann auch die vollständige Auswertung der erhobenen Befunde. Wird hingegen die Überweisung zur Ausführung einer konkret benannten Diagnosemaßnahme vorgenommen, so beschränkt sich die geschuldete und erlaubte ärztliche Leistung auf diese Maßnahme. Es bleibt Sache des überweisenden Arztes, die Ergebnisse der Befunderhebung zu interpretieren und hieraus z.B. therapeutische Schlussfolgerungen abzuleiten“.[157] Einschränkungen des Vertrauensgrundsatzes gelten auch dann, wenn bestimmte Untersuchungen besonders fehlerträchtig oder (und) bestimmte Untersuchungsergebnisse, z.B. die falsche Blutgruppenbestimmung, für die Patienten mit besonderer Gefahr verbunden sind. Allgemein gilt hier der Satz: Je größer das Risiko eines Untersuchungsfehlers und je größer die daraus resultierende Gefährdung des Patienten, umso größere Skepsis ist geboten, anders formuliert, umso enger sind die Grenzen des Vertrauensgrundsatzes gesteckt, umso mehr Kontrolle ist anstatt unbesehener Übernahme früherer Befunde erforderlich.[158] Ein ärztlicher Urlaubsvertreter darf deshalb z.B. die von seinem Kollegen begonnene Therapie nicht ungeprüft weiterführen, wenn ausreichende Anhaltspunkte für ernste Zweifel an deren Richtigkeit für ihn erkennbar sind.[159] In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass derjenige, der an die Grenzen seines Wissens und seiner Erfahrung stößt,[160] rechtlich zur Hinzuziehung eines spezialisierten Facharztes oder Überweisung des Patienten an diesen verpflichtet ist (s.o. Rn. 96). Dann aber muss er auch auf dessen Befund oder Empfehlung vertrauen dürfen, wenn er die Behandlung fortführt, es sei denn, die Untersuchungsergebnisse oder Vorschläge des Facharztes sind offenkundig fehlerhaft oder elementare Kontrollbefunde wurden von ihm nicht erhoben (eine niedergelassene Kinderärztin unterließ im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung eines Neugeborenen die Feststellung der Blutgruppe von Mutter und Kind: Haftung auch des Geburtshelfers[161]). Deshalb darf der niedergelassene Arzt z.B. die Untersuchungsbefunde einer apparativ und personell weit besser als seine Praxis ausgestatteten Fachklinik seiner Behandlung zugrunde legen, sofern sich ihm nicht Bedenken an deren Richtigkeit aufdrängen müssen,[162] und ebenso wenig ist er dafür verantwortlich, wenn entgegen seiner Einweisungsdiagnose „Arthroskopie“ deren Vornahme im Krankenhaus – möglicherweise fehlerhaft – unterbleibt.[163] Wird dem Patienten vor der Operation aufgegeben, ein EKG vom Hausarzt anfertigen zu lassen, muss dieses entweder der Anästhesist oder der Operateur auswerten, sofern eine sachkundige Befundung noch nicht erfolgt ist.[164] Der „Arzt, der dem Patienten zu einer Operation geraten und ihn deshalb in ein Krankenhaus eingewiesen hatte“, hat damit nicht zugleich auch „die dafür notwendige Aufklärung übernommen, sondern darf davon ausgehen, die Aufklärung werde im Krankenhaus von dem operierenden Arzt oder jedenfalls von einem zum Chirurgenteam des Krankenhauses gehörenden Arzt vorgenommen werden“[165] (s. Rn. 430 ff.). Der weiterbehandelnde Arzt hat die Pflicht zu umfassender Risikoaufklärung.[166] Denn im Regelfall weiß der Einweiser nicht, welche Methode im Einzelfall gewählt wird, so dass er allenfalls eine mehr „allgemein“ gehaltene Information des Patienten vornehmen kann. Keinen Fall der horizontalen Arbeitsteilung stellt die Krankenhauseinweisung eines Patienten seitens eines niedergelassenen Arztes dar, deren Notwendigkeit später durch Gutachter bestritten wird. Denn „zwischen einweisendem Arzt und Krankenhausträger“ besteht kein Auftragsverhältnis, so dass „die Krankenhausärzte in diesen Fällen nicht Erfüllungsgehilfen des einweisenden Arztes sind“ und deshalb dieser auch „nicht für deren Verschulden gem. § 278 BGB haftet“.[167] Ob die vollstationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich ist, müssen die zuständigen Krankenhausärzte prüfen (§ 39 Abs. 1 SGB V). Zusammenfassend stellt der BGH zur Abgrenzung der Verantwortungsbereiche zwischen Hausarzt und Krankenhausarzt fest: |
| „Die Verantwortung für die Behandlung des Patienten geht mit dessen Überweisung an das Krankenhaus auf die Ärzte dieses Krankenhauses über, die weder seine Erfüllungs- noch Verrichtungsgehilfen sind […] Im Allgemeinen wird der Hausarzt sich zwar darauf verlassen dürfen, dass die Klinikärzte seine Patienten richtig behandelt und beraten haben, und meist wird er auf deren bessere Sachkunde und größere Erfahrung vertrauen dürfen. Anders ist es aber dann, wenn der Hausarzt ohne besondere weitere Untersuchungen aufgrund der bei ihm vorauszusetzenden Kenntnisse und Erfahrungen erkennt oder erkennen muss, dass ernste Zweifel an der Richtigkeit der Krankenhausbehandlung und der dort seinem Patienten gegebenen ärztlichen Ratschläge bestehen. Er darf im Rahmen seiner eigenen ärztlichen Sorgfaltspflichten dem Patienten gegenüber offenbare Versehen oder ins Auge springende Unrichtigkeiten nicht unterdrücken“. Diese muss er, „gegebenenfalls nach Rücksprache mit den Kollegen im Krankenhaus, mit seinem Patienten erörtern. Kein Arzt, der es besser weiß, darf sehenden Auges eine Gefährdung seines Patienten hinnehmen, wenn ein anderer Arzt seiner Ansicht nach etwas falsch gemacht hat oder er jedenfalls den dringenden Verdacht haben muss, es könne ein Fehler vorgekommen sein. Das gebietet der Schutz des dem Arzt anvertrauten Patienten“. [168] |
| Ähnlich deutlich stellt der BGH im Falle einer Überweisung eines Kindes vom Augenarzt in die Augenklinik fest: |
| „Grundsätzlich ist der hinzugezogene Arzt an den Auftrag des überweisenden Arztes gebunden und darf eigenmächtig keine weitergehenden Untersuchungs- oder Behandlungsmaßnahmen durchführen […] Diese Bindung des hinzugezogenen Arztes an den Überweisungsauftrag bedeutet indessen nicht, dass dessen Tätigkeit lediglich auf die technische Ausführung des Auftrags begrenzt, die Funktion des zugezogenen Arztes also lediglich in der eines Werkzeuges ohne eigene Verantwortung zu sehen wäre. Der hinzugezogene Arzt übernimmt vielmehr im Rahmen des Überweisungsauftrags in gewissem Umfang auch eigenständige Pflichten. Er bestimmt in eigener Verantwortung nicht nur die Art und Weise der Leistungserbringung (z.B. die Bestimmung der Strahlendosis durch den Radiologen), sondern er muss auch prüfen, ob die von ihm erbetene Leistung den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht und nicht etwa kontraindiziert ist. Ebenso muss er prüfen, ob die von ihm erbetene Leistung ärztlich sinnvoll ist, ob also der Auftrag von dem überweisenden Arzt richtig gestellt ist und dem Krankheitsbild entspricht. Im Allgemeinen kann sich zwar der zur Vornahme einer bestimmten Leistung hinzugezogene Arzt darauf verlassen, dass der überweisende Arzt, jedenfalls wenn er derselben Fachrichtung angehört, den Patienten in seinem Verantwortungsbereich sorgfältig und ordnungsgemäß untersucht und behandelt hat und die Indikation zu der erbetenen Leistung zutreffend gestellt ist. Hat der hinzugezogene Arzt jedoch aufgrund bestimmter Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit der ihm übermittelten Diagnose, dann muss er diesem Zweifel nachgehen und darf sie nicht auf sich beruhen lassen. Das gilt insbesondere dann, wenn sich der überweisende Arzt an einen Spezialisten oder an eine Klinik wegen einer Leistung wendet, die er selbst nicht erbringen kann“. [169] |
| Im Rahmen eines gemäß § 39 Abs. 1a SGB V umfassend zu etablierenden Entlassmanagements (siehe dazu bereits Rn. 214) hat zum Abschluss stationärer Behandlung unter anderem eine ärztliche Untersuchung zu erfolgen. Insbesondere über deren Ergebnis ist sowohl der Patient (im Sinne therapeutischer Aufklärung) als auch der die Anschlussversorgung durchführende Arzt (z.B. Hausarzt, einweisender Arzt) vermittels eines (evtl. auch vorläufigen) Entlassbriefs zu unterrichten.[170]In diesem Entlassbrief sind insbesondere gestellte Diagnosen, der Entlassungsbefund und das weitere Prozedere bzw. „Empfehlungen“ dazu auszuführen. Allerdings ist der Weiterbehandelnde (z.B. niedergelassene Arzt) an solche Empfehlungen nicht wie ein „Befehlsempfänger“ gebunden. Er entscheidet vielmehr im Rahmen der Therapiefreiheit und Behandlungsnotwendigkeit über die jeweils indizierte Therapie samt Medikation auf der Grundlage eigener Prüfung und Erfahrung, darf aber andererseits auf die Richtigkeit der Therapieangaben oder Reha-Empfehlungen vertrauen, soweit sie nicht offensichtlich verfehlt sind. Erhält ein Arzt einen Arztbrief mit bedrohlichen Befunden, hat er sicherzustellten, dass der Patient von diesen Befunden und gegebenenfalls einer insoweit angeratenen Behandlung Kenntnis erhält, auch wenn diese Information nach einem etwaigen Ende des Behandlungsvertrages bei ihm eingeht. „Der Arzt, der als einziger eine solche Information bekommt, muss den Informationsfluss aufrecht erhalten, wenn sich aus der Information selbst nicht eindeutig ergibt, dass der Patient oder der diesen [tatsächlich] weiterbehandelnde Arzt sie ebenfalls erhalten hat“[171] | |
| 2. | Haftung des Konsiliarius. Es wäre zwar „für den betreffenden Patienten ideal“, ist jedoch in der Lebenswirklichkeit utopisch, das „jeder Arzt, der bei der Diagnose und Therapie in irgendeiner Weise beteiligt ist, alle medizinischen Zusammenhänge vollständig erfassen und aus eigener Sachkunde korrekt beurteilen“ kann[172]. Da eine „derartige Idealvorstellung“ im „arbeitsteilig organisierten Medizinbetrieb“ praktisch nicht zu realisieren ist, kann man nur verlangen, dass der primär behandelnde Arzt, wenn nötig, einen Konsiliarius hinzuzieht, „der über spezielle Techniken und Kenntnisse verfügt“. Dabei gelten hinsichtlich der Verantwortlichkeit für Fehler allgemein folgende Grundsätze:[173] • Im Gegensatz zum Zivilrecht gibt es im Strafrecht stets nur eine Haftung für eigenes Verschulden. Die Frage nach dem Einstehenmüssen für das Verschulden eines Verrichtungs- oder Erfüllungsgehilfen stellt sich daher in Strafverfahren nicht. Der den Konsiliararzt hinzuziehende Arzt haftet also für eigene Behandlungs-, aber auch Auswahlfehler. • Wer als Konsiliararzt einen Auftrag übernimmt, muss sicherstellen, dass er insoweit die notwendige Fachkunde und, falls erforderlich, die gebotene apparative Ausstattung besitzt. Anderenfalls läge ein Übernahmeverschulden vor. • Mit der konsiliarischen Hinzuziehung (zu einer rein beratenden Tätigkeit oder einer speziellen Maßnahme)[174] wird der betreffende Fachvertreter nicht zum mitbehandelnden oder behandelnden Arzt. Zuständig für die Aufklärung, Überwachung und Behandlung bleibt vielmehr derjenige Arzt, in dessen Obhut oder Abteilung der Patient sich befindet[175]. Das folgt schon daraus, dass der Konsiliarius meist nur „allgemein eine Behandlung vorschlägt, während die Einzelheiten wie Dosierung und Dauer der Medikation“ vom behandelnden Arzt bestimmt werden[176] und daher von ihm auch die vorgeschlagene Behandlung oder Medikation zu überprüfen ist[177]. • Der Konsiliarius ist grundsätzlich gehalten, den behandelnden Arzt in einem Arztbrief über das Ergebnis seiner Untersuchungen zu unterrichten bzw. sonst für einen umfassenden Informationsaustausch zu sorgen[178]. • Der Konsiliararzt, der um eine spezielle und konkret beschriebene Maßnahme gebeten wurde, darf von einer sorgfältigen Indikationsstellung ausgehen[179] und hat deshalb „die vom primär behandelnden Arzt gestellte Indikation zur konsiliarärztlichen Maßnahme grundsätzlich zu akzeptieren, es sei denn, der überweisende Arzt überlässt ihm die Prüfung der Frage, welche diagnostische oder therapeutische Maßnahme in Betracht zu ziehen ist.[180] Seinerseits muss der Facharzt, der selbstständig[181] und eigenverantwortlich seine Tätigkeit ausübt,[182] daher auch aufklären und natürlich den Patienten und überweisenden Kollegen über notwendige Weiterungen der Behandlung oder der Diagnostik informieren. Dabei bedeutet die Bindung des hinzugezogenen Arztes an den Überweisungsauftrag „nicht, dass dessen Tätigkeit lediglich auf die technische Ausführung des Auftrages begrenzt, die Funktion des hinzugezogenen Arztes also lediglich in der eines Werkzeuges ohne eigene Verantwortung zu sehen ist. Der hinzugezogene Arzt übernimmt vielmehr im Rahmen des Überweisungsauftrages in gewissem Umfang eigenständige Pflichten. Er bestimmt in eigener Verantwortung nicht nur die Art und Weise der Leistungserbringung, sondern er muss auch prüfen, ob die von ihm erbetene Leistung den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht und nicht etwa kontraindiziert ist. Ebenso muss er prüfen, ob der Auftrag von dem überweisenden Arzt richtig gestellt ist und dem Krankheitsbild entspricht. Keinesfalls darf ein Arzt, der an der Richtigkeit einer ihm übermittelten Diagnose oder Indikationsstellung Zweifel hat oder haben muss, diese auf sich beruhen lassen (… mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen …)“.[183] • Umgekehrt darf aber auch derjenige Arzt, der den Konsiliarius einschaltet, wie allgemein im Rahmen ärztlicher Teamarbeit,[184] auf dessen Fachwissen und besondere Erfahrung vertrauen, es sei denn, diesem unterläuft ein offensichtlicher Diagnose- oder Behandlungsfehler. Es widerspräche nicht nur dem Vertrauensgrundsatz, sondern auch den sich aus dem Übernahmeverschulden ergebenden Konsequenzen, wenn man denjenigen Arzt, der den Spezialisten als Konsiliarius hinzuzieht, nicht zugleich von seiner strafrechtlichen Verantwortung entlasten würde. Allerdings ist insoweit zwischen eindeutig bzw. leicht oder nur schwer diagnostizierbaren bzw. zu behandelnden Krankheiten zu unterscheiden: • Ist das Krankheitsbild klar, sind die Befunde zweifelsfrei im Sinne einer bestimmten Krankheit zu deuten, gehört ihre Kenntnis zum „Standardwissen“ jedes Arztes, erkennt es aber weder der primäre behandelnde noch der Konsiliararzt, haften beide strafrechtlich, wenn der Patient stirbt oder einen Gesundheitsschaden erleidet[185]. • Ist die Diagnose schwierig, das Krankheitsbild diffus, sind die Symptome nicht eindeutig und nur von einem Spezialisten mit dem nötigen Wissen und der nötigen Erfahrung zu erkennen, geht die Verantwortung vom primär behandelnden Arzt auf den Konsiliarius über mit der Folge, dass ihn allein der strafrechtliche Fahrlässigkeitsvorwurf trifft. • Zu berücksichtigen ist ferner, ob die eingetretene Komplikation in das Fachgebiet des primär behandelnden oder des Konsiliararztes fällt. Ist sie für den das Konsil beantragenden Arzt „fachfremd“, darf er auf den Rat des Kollegen vertrauen, es sei denn, es handelt sich um so evidente, geläufige Befunde, dass sie jeder Arzt erkennen muss (dann aber wird sich in der Praxis regelmäßig wohl kaum die Frage des Konsils stellen!). Ein praktisches Beispiel mag diese Grundsätze veranschaulichen: |
Im Anschluss an eine gynäkologische Operation waren am 3. und 4. postoperativen Tag mehrere Krankheitssymptome aufgetreten, die in gleicher Weise für eine Endomyometritis wie für eine Peritonitis sprachen. Der Gynäkologe zog daraufhin den Chirurgen als Konsiliarius hinzu, der jedoch die schleichende Peritonitis nicht erkannte, sondern zum Abwarten riet. Als sich am 5. postoperativen Tag die Situation plötzlich drastisch verschlimmerte und die typischen Peritonitis-Symptome (brettharter Bauch, Fieber, Erbrechen, frequenter Puls und Blutdruckabfall) auftraten, überwies der Gynäkologe die Patientin in ein größeres Krankenhaus, wo sie jedoch wenig später verstarb.
Sowohl der Gynäkologe als auch der Chirurg haben eine falsche Diagnose gestellt. Für die Frage, ob der Gynäkologe sich durch die Hinzuziehung des Chirurgen als Konsiliararzt von strafrechtlicher Verantwortlichkeit befreien kann, kommt es darauf an, ob das Krankheitsbild verschleiert, unklar, diffus oder „ganz klar“ und eindeutig war. Ist Letzteres anzunehmen, wäre auch der Gynäkologe wegen fahrlässiger Tötung strafbar, wenn die übrigen Strafbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere die Kausalität der unterlassenen frühzeitigeren Einweisung in ein großes Krankenhaus, für den Tod gegeben sind. Insoweit kann der Vertrauensgrundsatz keine Anwendung finden, zumal der Gynäkologe die klinische Vorgeschichte der Patientin und den genauen postoperativen Verlauf bis zum Konsil kannte.
War die Peritonitis dagegen nicht eindeutig am 3. und 4. postoperativen Tag und damit für jeden Arzt erkennbar, durfte der Gynäkologe auf den Rat des hinzugezogenen chirurgischen Konsiliarius vertrauen, so dass ihm keine Sorgfaltspflichtverletzung angelastet werden kann. Er hat vielmehr richtig gehandelt, da er seine Zweifel selbstkritisch durch die Einschaltung eines Facharztes manifestierte und damit klar zum Ausdruck brachte, dass er „nicht mehr weiterwußte“, sondern auf den Rat eines „Fachmannes“ angewiesen war. Dann aber muss insoweit auch der Vertrauensgrundsatz seine Wirkungen entfalten und ihn von strafrechtlicher Haftung freistellen.