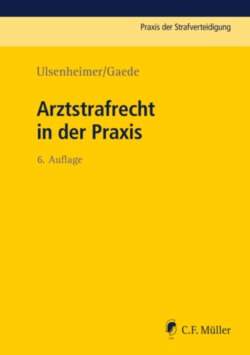Читать книгу Arztstrafrecht in der Praxis - Klaus Ulsenheimer - Страница 103
На сайте Литреса книга снята с продажи.
(2) Fallgruppe 1b: Interdisziplinäre ärztliche Zusammenarbeit im ambulanten Bereich
Оглавление243
Die vorstehend dargelegten Grundprinzipien horizontaler Arbeitsteilung: Teilbarkeit der Verantwortung, Vertrauensgrundsatz und Koordinationspflicht gelten in gleicher Weise für den Bereich ambulanter Eingriffsdurchführung, der angesichts der Entwicklung der minimal-invasiven Chirurgie und unter dem „Diktat leerer Kassen“ mit Hilfe gesetzlicher Förderung „ambulant vor stationär“ (§ 39 Abs. 1 S. 2 SGB V) eine ungeheure Ausweitung erfahren hat. Damit ging parallel ein erheblicher Anstieg der Arzthaftung bzw. -strafbarkeit im Zusammenhang mit ambulanten Eingriffen einher[130], für die dieselben rechtlichen Anforderungen und die gleichen medizinischen Qualitätsmaßstäbe angelegt werden wie an die stationäre Durchführung.[131]
244-
247
(a) Einige Beispiele aus der Rechtsprechung mögen dies verdeutlichen:
| • | LG Essen:[132] Ein 5-jähriger Junge, der seit seiner Geburt an der Muskeldystrophie Duchenne litt, verstarb bei einer ambulanten Polypenoperation. Zur Erleichterung der Intubation injizierte der Anästhesist – das hier kontraindizierte – Succinylcholin, ein muskelerschlaffendes Medikament, nach dessen intravenöser Gabe es 10 Minuten später zu einem trotz Wiederbelebungsbemühungen tödlichen Herzstillstand kam. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen die beiden an der Operation beteiligten HNO-Ärzte sowie den Anästhesisten, der als einziger rechtskräftig – und mit Recht – verurteilt wurde.[133] Denn ihm allein obliegt als Anästhesist die abschließende Beurteilung der Narkosefähigkeit eines Patienten. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hätte er sicherstellen müssen, dass auch anästhesierelevante Informationen tatsächlich erhoben werden und sicher an ihn herangelangen. Dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht geschehen. Ihm lag lediglich ein kleines Blutbild nebst Gerinnungsfaktor sowie das Krankenblatt und ein Überweisungsträger des Dr. Y vor. Diese Unterlagen waren nichtssagend. Aus ihnen ergaben sich weder narkoserelevante Fragen noch Antworten. Auch der von der Gemeinschaftspraxis Dr. Y herausgegebene Aufklärungsbogen, der mit „Liebe Eltern!“ überschrieben ist, enthält keinen für einen Anästhesisten wichtigen Fragenkomplex. Auch insoweit hätte sich der Angeklagte davon überzeugen müssen, dass für die Narkose bedeutsame Fragen, z.B. anhand eines ordentlichen Aufklärungsbogens, zu dem Patienten gestellt und auch dokumentiert werden. Im Hinblick auf die Narkosefähigkeit des Kindes hat die Praxis Dr. Y damit keinen Vertrauenstatbestand gesetzt, auf den der Angeklagte sich hätte verlassen dürfen. Vor diesem Hintergrund hätte er vor der Operation eine eigene Anamnese bei den Eltern erheben müssen, bei der das Vorliegen der Muskeldystrophie sofort zutage getreten wäre“ und er dadurch die Kontraindikation des Medikaments Succinylcholin erkannt hätte. „Bei Kenntnis der Muskelerkrankung hätte das Kind keinesfalls ambulant anästhesiert werden dürfen“. |
| • | Ambulante Zirkumzision bei einem 5-jährigen Kind zur Beseitigung einer Phimose unter Allgemeinnarkose, die ein Anästhesist, der regelmäßig mit der Operateurin zusammenarbeitet, durchführte. Nach dem Eingriff kam es im Aufwachraum zu einem Atem- und Kreislaufstillstand und einer schweren Schädigung des Hirns, die auf einer Überdosis von Rapifen und Überwachungsversäumnissen in der Aufwachphase beruhten. Mit Recht lehnte das OLG Naumburg eine Haftung der Chirurgin ab, da sie „grundsätzlich weder für eine fehlerhafte Dosierung eines Hypnotikums noch für eine unzureichende postoperative Kontrolle der Kreislauf- und Atmungsstabilität“ haftet. Denn „beide Aufgaben fallen in den Verantwortungsbereich des Anästhesisten“.[134] |
| • | Bei einer ambulant durchgeführten Operation wegen eines Postdissektomie-Syndroms wurde der Patient nicht auf dem Operationstisch fixiert und nur in einen Dämmerschlaf versetzt. Gegen Ende der Operation trat der Anästhesist vom Tisch ab, um im Nebenraum ein Medikament zur Blutdrucksenkung zu holen. Gleichzeitig trat der Operateur zur Seite, um den Bildwandler zu bedienen, und zeitgleich verließ auch die OP-Schwester den Patienten, um etwas zu holen. Genau in diesem Augenblick bäumte sich der noch unzurechnungsfähige Patient auf und fiel vom Tisch. Dabei zog er sich eine Schädelfraktur mit einem subduralen Hämatom und zusätzlich einen Hirninfarkt zu, in dessen Folge er ein Jahr später starb. Nach Einholung eines fachanästhesiologischen Gutachtens, das vor allem eine fehlende schriftliche Absprache zwischen Operateur und Anästhesist bezüglich der Überwachung des Patienten gerügt hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft gegen den Anästhesisten wegen fahrlässiger Tötung einen Strafbefehl, da er für eine lückenlose Beaufsichtigung des Patienten durch die beteiligten Personen bei der Operation hätte sorgen müssen. Als Anästhesist habe er „die übergeordnete Aufsichtspflicht über den anästhesierten Patienten“ gehabt und deshalb die Pflicht, die Kontrolle während seiner Abwesenheit sicherzustellen.[135]Die Verfahren gegen den Operateur und die OP-Schwester wurden nach § 153a StPO eingestellt. |
| • | Bei einer ambulant auf laparoskopischem Weg durchgeführten Fertilisationsdiagnose verletzte der Gynäkologe unbemerkt die Arteria epigastrica. Die Patientin kam 20 Minuten nach dem Eingriff aus eigener Kraft in den nicht überwachten Aufwachraum, wo die Anästhesistin ein Volumenersatzmittel routinemäßig infundierte. 35 Minuten später fand sie die Patientin blass und müde vor, so dass sie ihr nochmals eine Infusion gab, ohne allerdings Puls und Blutdruck zu messen. Weitere 20 Minuten später erbrach die Patientin, so dass der Ehemann die Anästhesistin rief. Diese stellte einen Blutdruck von nur noch 75/40 mmHg fest und injizierte Akrinor. Der Hb-Wert lag bei 6,5g/%. Die Patientin überlebte trotz eines Blutverlustes von 5l und nach Eintritt eines Herzstillstandes. Beide Ärzte bestritten ihre Zuständigkeit für die postoperative Überwachung, doch sah die Staatsanwaltschaft die Pflichtwidrigkeit beider in der fehlenden diesbezüglichen Absprache, wer für den Aufwachraum und die dort liegende Patientin rechtlich verantwortlich sei. Gegen Zahlung eines fühlbaren Geldbetrages wurden die Ermittlungsverfahren gemäß § 153a StPO eingestellt. Im Rahmen des Zivilprozesses führte der Senat aus, die Patientin, die eine Gefäßverletzung erlitten hatte, sei von den Nachwirkungen der Anästhesie nicht mehr beeinträchtigt gewesen. Die Überwachungspflicht habe sich „ausschließlich wegen des Risikos einer Nachblutung oder einer Verletzung sonstiger Organe“ ergeben, zwei Aspekte, die „grundsätzlich in den Verantwortungsbereich“ des Gynäkologen fielen. Dies sei in der Vereinbarung der beiden Fachgebiete über die Zusammenarbeit in der operativen Gynäkologie auch so geregelt, unabhängig von der rechtlichen Bedeutung solcher Absprachen aber auch im Interesse einer reibungslosen Zusammenarbeit selbstverständlich. Da vom Operateur keine besonderen und ausdrücklichen Anweisungen für die postoperative Betreuung der Patientinnen erteilt worden waren, sah das OLG in diesem Kontrolldefizit einen „grundlegenden Organisationsmangel“, der „in erster Linie dem verantwortlichen Gynäkologen anzulasten“ sei. Die Tatsache, dass die Anästhesistin „gewisse Kontrollmaßnahmen durchgeführt und dokumentiert“ habe, „entband den Gynäkologen nicht von der Verpflichtung, seinerseits eine funktionierende Überwachung zu gewährleisten“.[136] Die Klage hatte gegen beide Ärzte Erfolg. |
248
Wie bereits für den stationären Bereich hervorgehoben, ist die postoperative Phase auch bei ambulanten Operationen besonders haftungsträchtig, so dass hier strenge Sicherheitsanforderungen bestehen.[137]
249
(b) Es genügt deshalb nicht, dass ein kleines Kind nach dem Eingriff (Ohrkorrektur) ohne Pulsoxymeter und EKG nur vom Vater überwacht wird. Merkt dieser zu spät, dass mit dem Kind „etwas nicht stimmt“, und erleidet dieses dadurch einen Herzstillstand mit der Folge eines apallischen Syndroms, tragen die beiden für die Narkose und die Organisation zuständigen Anästhesisten die Verantwortung.[138]
250
(c) Ebensowenig entspricht es dem postoperativen anästhesiologischen Überwachungsstandard, wenn der noch nicht völlig ansprechbare Patient nach einer arthroskopischen Knieoperation mit Kreuzbandersatzplastik und dabei erfolgter Opioidapplikation ohne EKG und Pulsoxymeter im Aufwachraum von einer Auszubildenden im Hinblick auf Puls und Blutdruck kontrolliert wird, der Anästhesist den Patienten lediglich mittels Blickkontakt „im Auge“ behält und gelegentlich nach ihm schaut. Tritt unter diesen Umständen ein zu spät bemerkter respiratorischer Atemstillstand ein, der zu einer schweren Hirnschädigung führt, so liegt eine fahrlässige Körperverletzung vor, die das LG Stuttgart mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen ahndete.[139]
251
(d) Das forensische Risiko ambulanter Eingriffsdurchführung zeigt anschaulich folgender Fall, zu dem zunächst in I. Instanz eine Verurteilung der beiden Angeklagten durch das AG Limburg a. d. Lahn (Schöffengericht)[140] und auf Berufungen der Angeklagten in II. Instanz durch das LG Limburg a. d. Lahn[141] eine Verfahrenseinstellung gemäß § 153a Abs. 2 StPO – mithin ohne Schuldfeststellung – erfolgten:
| • | Der Anklagevorwurf bezog sich auf die Zahnbehandlung bei einem 10-jährigen Mädchen in der Praxis eines Zahnarztes/Oralchirurgen unter Beteiligung eines Anästhesisten zur Durchführung einer Vollnarkose. Nach Abschluss der Zahnbehandlung und Ausleitung der Narkose sei die kleine Patientin in einen Aufwachraum verlegt worden, wobei es sich um einen gewöhnlichen Zahnarztbehandlungsraum ohne apparative Vorrichtungen zur Überwachung von Patienten in der postoperativen Phase gehandelt haben soll. Dort habe die schlafende Patientin lediglich der kontinuierlichen Obhut ihrer Mutter unterlegen, wobei im weiteren Verlauf nur sporadische Nachfragen durch Zahnarzthelferinnen ohne fachliche Ausbildung zur Überwachung narkotisierter Patienten zum jeweils aktuellen Zustandsbild erfolgt seien. Während dessen seien der Zahnarzt und der Anästhesist durch die Behandlung eines anderen Patienten in Anspruch genommen gewesen. Nach gewisser Zeit sei die Atmung des Kindes unregelmäßig geworden und habe dann ganz ausgesetzt, was zu Reanimationsmaßnahmen führte. Anschließend erfolgte die Verlegung des Kindes in ein örtliches Krankenhaus sowie noch am gleichen Tage in eine anderweitige Kinderklinik. Dort sei sieben Tage später der Tod des Kindes wegen eines hypoxischen Hirnödems als Folge eines Herzkreislaufversagens eingetreten. Die Staatsanwaltschaft postulierte in der Anklageschrift, aufgrund eines möglichen schnellen Eingreifens habe bei dem Kind ein Herzkreislaufversagen und in der Folge der Eintritt eines hypoxischen Hirnödems mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert werden können, wenn es postoperativ durch Apparate und Fachpersonal adäquat überwacht worden wäre. Dabei habe die ordnungsgemäße postoperative Überwachung des Kindes grundsätzlich dem Verantwortungsbereich des beteiligten Anästhesisten unterlegen, allerdings habe auch der Zahnarzt als Betreiber der Praxis sorgfaltswidrig gehandelt. Für seine Person gelte der Vertrauensgrundsatz nicht unbegrenzt. Vielmehr sei ein Einschreiten geboten, wenn der fachbereichsfremde Arzt (hier: Zahnarzt) Fehlleistungen des weiteren Arztes (hier: Anästhesist) erkennt oder diese wegen Evidenz hätte erkennen können. Darüber hinaus habe der Zahnarzt erhöhten eigenen Sorgfaltspflichten unterlegen, da er auf seiner Homepage auch hinsichtlich einer anästhesiologisch adäquaten Behandlung seiner Patienten geworben habe. |
| • | Nach 8-tägiger Hauptverhandlung verurteilte das AG Limburg a.d. Lahn den Anästhesisten wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten und den Zahnarzt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, wobei die festgesetzten Freiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt wurden. Eine umfängliche Mitteilung des – nicht in Rechtskraft erwachsenen! – Urteils erfolgte unter der Überschrift „Organisationsverantwortung von Praxisinhabern“[142], welche wohl im Kontext der so bezeichneten Problematik von „Tätern hinter den Tätern“ in Gesundheitseinrichtungen[143] gesehen werden sollte. |
Das LG Limburg a. d. Lahn konstatierte in II. Instanz in seinem o. a. Beschluss zur Verfahrenseinstellung gem. § 153a Abs. 2 StPO allerdings unter anderem Folgendes:
„Die umfangreich durchgeführte Berufungshauptverhandlung hat zu neuen und ergänzenden Erkenntnissen zur Komplexität des zu beurteilenden Verfahrensgegenstandes geführt. Die Sachkunde der Kammer wurde gegenüber der erstinstanzlichen Bewertung durch die Vernehmung weiterer 4 Sachverständiger u.a. auf den Gebieten der Kardiologie und Oralchirurgie erheblich und zielführend erweitert.
Ergänzende Zeugenvernehmungen führten zudem zu neuen Erkenntnissen, die bei der Verurteilung der Angeklagten in erster Instanz nicht berücksichtigt werden konnten.
Ob deshalb der Tod des Kindes […] auf strukturellen Defiziten der postoperativen Patientenüberwachung des (angeklagten Zahnarztes) in dessen Praxis unter Berücksichtigung der Grundsätze des arbeitsteiligen Zusammenwirkens mit dem (angeklagten Anästhesisten) beruht, muss erheblichsten Bedenken begegnen“. [144]
Hinsichtlich des Behandlungsagierens des Anästhesisten wird in diesem Beschluss in Relation zum Agieren des Zahnarztes festgestellt, „naheliegender“ komme
„eher eine fehlerhafte medizinische Beurteilung zur Verlegungsfähigkeit des Kindes in den Ruheraum durch den (angeklagten Anästhesisten) in Frage, mithin eine einmalige Fehleinschätzung“.
Diese eventuell „einmalige Fehleinschätzung“ betraf den Aspekt, ob das Kind angesichts seines konkreten postnarkotischen Zustands „bereits“ in einen „Ruheraum“ (nicht: „Aufwachraum“, siehe oben) verlegt werden durfte.
Neben den „erheblichsten Bedenken“ hinsichtlich einer Strafbarkeit des Zahnarztes und der Annahme einer allenfalls „naheliegend eher“ in Rede stehenden einmaligen Fehleinschätzung des Anästhesisten waren für die Kammer für eine Verfahrenseinstellung gem. § 153a Abs. 2 StPO – mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der beiden Angeklagten – ein „(komplexer Ursachenzusammenhang) zwischen möglichem ärztlichen Fehlverhalten und dem Tod des Kindes“ maßgeblich. So war von den Sachverständigen in der II. (Tatsachen-)Instanz weitergehend problematisiert worden,
| • | dass das Kind unter einem Williams-Beuren-Syndrom litt, was eventuell Bedeutung für das Eintreten und die Beherrschbarkeit der postoperativen Komplikation hatte, und |
| • | wie sich die weitere Behandlung des Kindes bis zu seinem Tod in der Kinderklinik gestaltet hat. |
252
(e) Medizinisch und rechtlich risikoträchtig ist auch die Analgosedierung für diagnostische und therapeutische Maßnahmen, wozu es der Einhaltung struktur- und prozessqualitativer Mindestanforderungen bedarf.[145]
So führte in einem vom AG München entschiedenen Fall[146] ein niedergelassener Frauenarzt in seiner Praxis ambulant eine Gebärmutterausschabung unter „Sedierung ohne zweiten Arzt“[147] bei Einsatz des Medikaments Propofol durch. Nach Beendigung des Eingriffs bemerkte der Angeklagte, dass sich bei der Patientin aufgrund der Sedierung zwischenzeitlich ein Atemstillstand realisiert hatte, was zur Asystolie mit hypoxisch-hypoxämischer Schädigung des Gehirns und schließlichem Tod der Patientin führte. Das AG verurteilte den Gynäkologen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten (ohne Aussetzung der Vollstreckung), da er diese Behandlung ohne gehörige apparative Ausstattung (insbesondere: mangelnder Einsatz einer Pulsoxymetrie) und ohne Anwesenheit eines zweiten Arztes bzw. eines Anästhesisten zur Überwachung der Atmung der Patientin – auch bei fehlender Möglichkeit des kurzfristigen Hinzutretens eines Anästhesisten – nicht hätte durchführen dürfen.
Auf entsprechend begrenzte Berufung des Angeklagten wegen der Nicht-Aussetzung der Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewährung durch das Amtsgericht wurde diese vom LG München I unter Annahme einer Reihe besonderer (insbesondere persönlicher) Umstände im Sinne des § 56 Abs. 2 StGB gewährt.[148]
253
(f) Ein weiteres Beispiel bietet das – zivilrechtliche – Urteil des BGH zur Überwachung sedierter Patienten.
Der Chefarzt hatte seinen Patienten, bei dem eine Magenspiegelung durchgeführt werden sollte, vor der Sedierung über die Risiken des invasiven Eingriffs aufgeklärt und belehrt, dass er nach dem Eingriff kein Kraftfahrzeug führen dürfe. Eine entsprechende Belehrung hatte der Patient bereits durch seinen Hausarzt erhalten. Da am Untersuchungstag das Kind des Patienten erkrankt und seine Frau daher nicht abkömmlich war, kam er mit dem eigenen Wagen, sagte dem Arzt aber, er werde mit dem Taxi nach Hause fahren.
Der große und schwergewichtige Patient erhielt zur Sedierung 20 mg Buscopan und 30 mg Dormicum. Nach der gegen 8.30 Uhr vorgenommenen Untersuchung verblieb der Patient zunächst eine halbe Stunde im Untersuchungszimmer unter Aufsicht, danach hielt er sich auf dem Flur vor den Dienst- und Behandlungsräumen des Chefarztes auf, der wiederholt Blick- und Gesprächskontakt zu ihm hatte. Ohne vorher entlassen worden zu sein, entfernte er sich kurz vor 11.00 Uhr und fuhr mit seinem Pkw weg. Dabei geriet er nur wenig später aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lastzug zusammen. Bei dem Unfall erlitt er tödliche Verletzungen.
Der BGH stellte – im Gegensatz zu den beiden Vorinstanzen – fest:
„Jedenfalls die tatsächlich erfolgte Unterbringung auf dem Flur ohne die Möglichkeit einer ständigen Beobachtung reichte nicht aus, um den Patienten daran zu hindern, sich ggf. unbemerkt zu entfernen und die Gefahr eines selbst gefährdenden Verhaltens auszuschließen“. Die dem Chefarzt obliegende Garanten- und „Fürsorgepflicht hätte es erfordert, den Patienten in einem Raum unterzubringen, in dem er unter ständiger Überwachung stand und ggf. daran erinnert werden konnte, dass er das Krankenhaus nicht eigenmächtig verlassen durfte. In Betracht kam insoweit ein Vorzimmer oder ein besonderes Wartezimmer“. [149]